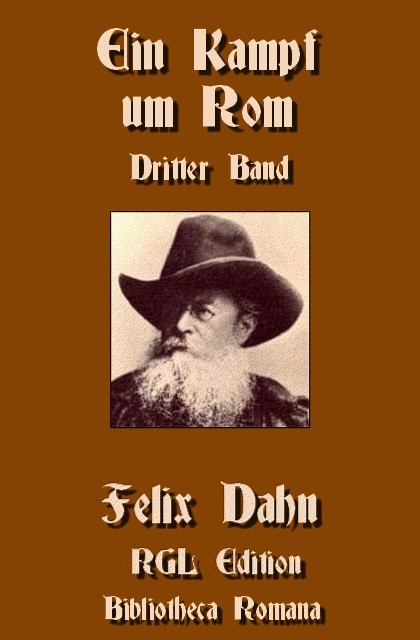
RGL e-Book Cover 2015©
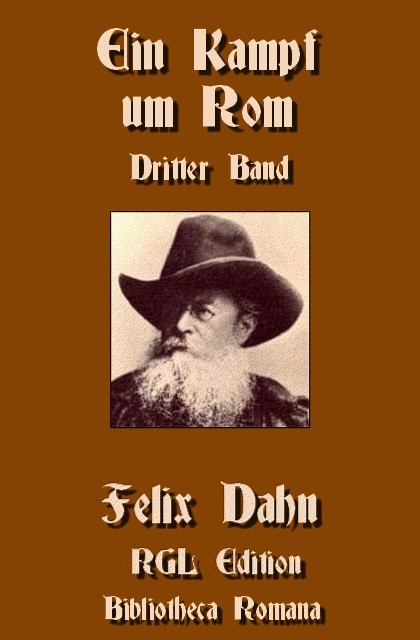
RGL e-Book Cover 2015©
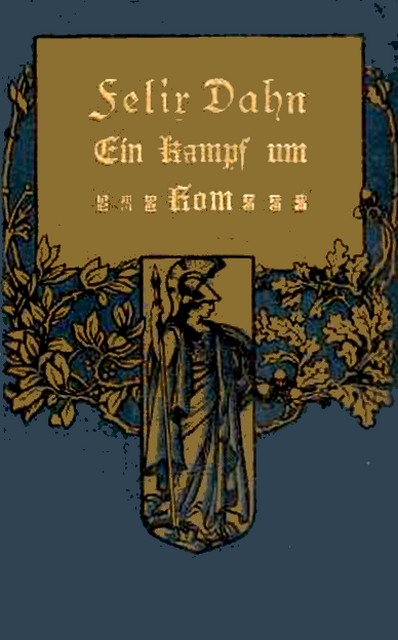
"Ein Kampf um Rom," Breitkopf & Härtel, Leipzig
«Heil, daß uns dieser Sonnen-Jüngling lebt»
Markgraf Rüdiger von Bechelaren
Wenige Tage nach dem Tode Mataswinthens und der Abreise des tieferschütterten Prinzen kam eine Botschaft aus Castra nova, die den Aufbruch byzantinischer Truppen von Ravenna notwendig machte.
Hildebad war durch flüchtige Goten, die sich durch die Linien der Belagerer geschlichen, von der verräterischen Gefangennehmung des Königs unterrichtet worden. Da ließ er durch Gefangene, die er freigab, Belisar und Cethegus, jeden einzeln oder beide zusammen, wie sie wollten, zum Zweikampf laden, «wenn sie eine Ader von Mut, einen Tropfen von Ehre im Leibe trügen».
«Er glaubt Belisar noch im Lande und scheint ihn nicht eben zu fürchten», sagte Bessas.—«Hier läge ein Mittel» erwiderte Cethegus lauernd, «den ungestümen Raufbold zu verderben. Aber freilich, Mut gehört dazu. Mut, wie ihn Belisar gehabt.»
«Du weißt, ich weiche ihm auch darin nicht.»
«Gut», sprach Cethegus, «folge mir in mein Gemach.
Ich will dir Rat und Mittel zeigen, den Riesen zu vernichten. Du sollst vollbringen, was Belisar mißlang.» Zu sich selber aber sprach er: «Bessas ist zwar ein löblich schlechter Feldherr, aber Demetrius kein besserer, und leichter zu leiten. Und Bessas schuld' ich noch Vergeltung für das tiburtinische Tor zu Rom.»
Nicht ohne Grund hatte der Präfekt gefürchtet, der schon fast erloschene Widerstand der Goten werde sich neu beleben bei der Kunde von der hinterlistigen Vernichtung des Königs.
Mit jedem Mittel hatte er daher jene Erklärung von Witichis erzwingen wollen, die jede Begeisterung der Rache erstickt haben würde. Noch war an den alten Hildebrand zu Verona, an Totila nach Tarvisium und an Teja zu Ticinum keine genauere Nachricht gelangt. Nur die Kunde, daß Ravenna gefallen, der König gefangen sei, hatte sie erreicht. Dunkel verlautete dabei der Verrat. Und der Schmerz und Zorn der Freunde ließen es sich nicht nehmen: mit rechten Dingen könne nicht die feste Stadt, der wackre König erlegen sein. Statt sie zu entmutigen, verstärkte das Unheil die Kraft ihres Widerstandes. In wiederholten glücklichen Ausfällen schwächten sie die Belagerer. Und diese sahen sich schon fast genötigt, die Einschließung aufzugeben.
Denn die Anzeichen einer bedeutsamen Veränderung der Verhältnisse in ganz Italien strömten von allen Seiten auf sie ein.
Diese Veränderung war ein sich rasch vollziehender Umschwung in Stimmung und Gesinnung der römischen Bevölkerung, wenigstens des gesamten Mittelstandes: der Kaufleute und Handwerker in den Städten, der Bauern und Colonen auf dem flachen Lande.
Die Italier hatten überall die Byzantiner jubelnd als Befreier begrüßt. Aber nach kürzester Zeit legte sich dieser Jubel. Im Gefolge Belisars zogen ganze Scharen von Finanzbeamten aus Byzanz, von Justinian gesendet, sofort die Früchte des Kampfes zu ernten und die immer leeren Kassen des Ostreichs mit den Reichtümern Italiens zu füllen. Mitten in den Leiden des Krieges begannen und betrieben diese Eifrigen ihr Werk. Sowie Belisar eine Stadt besetzt hatte, so berief der mit eingerückte Logothetes (Kassenrechnungsführer) alle freien Bürger in die Kurie oder auf das Forum, ließ die Bürger sich selbst nach dem Vermögen in sechs Klassen teilen und forderte nun je die ärmere Klasse auf, die nächst höhere nach ihrem Vermögen zu schätzen. Auf Grund dieser Schätzung legten dann die kaiserlichen Beamten jeder Klasse eine möglichst hochgegriffene Steuer auf.
Und da sie, schon durch die Vorenthaltung, Verkürzung, Verzögerung bei dem niemals pünktlich bezahlten Gehalte fast darauf angewiesen, stets neben den Kassen des Kaisers die eigne Tasche zu füllen bedacht waren, wurde der Druck unerträglich. Die Logotheten waren nicht zufrieden mit den hohen Steuersätzen, die der Kaiser für drei Jahre vorausbezahlt verlangten mit der besonderen, jeder befreiten Stadt Italiens auferlegten «Freiheits-, Dank- und Freudenschatzung»—neben den starken Beisteuern und Lieferungen, die Belisar und seine Heerführer zur Verpflegung des Heeres ausschreiben mußten—denn von Byzanz kam weder Geld noch Vorrat—, verlegten sich jene Finanzkünstler darauf, mit besonderen Mitteln den reicheren Bürgern noch besondere Zahlungen abzunötigen.
Sie stellten überall Nachprüfungen der Steuerlisten an, entdeckten Rückstände aus der Zeit der Gotenkönige oder gar noch aus den Tagen Odoakers und ließen den Bürgern nur die Wahl zwischen ungeheuren Abfindungssummen oder ungeheuren Rechtsstreiten mit dem Fiskus Justinians, der noch nie einen Prozeß verloren.
Waren aber die Steuerlisten unvollständig oder zerstört—was häufig genug in diesen Jahren der Kämpfe geschehen—, so stellten die Rechnungsführer sie nach eigner Willkür wieder her.
Kurz, alle Finanzkünste, welche die Provinzen des Ostreichs zugrunde richteten, wurden seit Belisars Landung in ganz Italien geübt, soweit die kaiserlichen Waffen reichten.
Ohne Rücksicht auf die Not des Krieges spannten die Steuerboten dem Bauer das pflügende Rind aus dem Pflug, nahmen dem Handwerker das Gerät aus der Werkstatt, dem Kaufmann die Waren aus der Halle. In manchen Städten erhob sich das Volk, die Steuerlisten verbrennend, in hellem Aufruhr gegen seine Peiniger, die freilich alsbald in größeren Scharen mit strengerer Härte wiederkehrten. Mit afrikanischen Bluthunden jagten die maurischen Reiter Justinians die verzweifelnden Bauern aus ihren Waldverstecken, wohin sie sich geflüchtet, den Steuererhebern zu entrinnen.
Cethegus aber, der allein in der Stellung gewesen wäre, Abhilfe zu versuchen, sah dem allen zu mit berechnender Ruhe. Ihm war es erwünscht, daß Italien schon vor Beendigung des Krieges die Tyrannei von Byzanz fühlbar kennenlernte. Desto leichter würde er es mit fortreißen können, sich zu erheben mit eigner Kraft und nach den Goten auch die Byzantiner abzuschütteln. Mit Achselzucken hörte er die Klagen der Städtegesandten an, die seine Vermittlung anriefen, und gab die lakonische Antwort: «Das ist byzantisch Regiment ihr müßt euch dran gewöhnen.»—«Nein», hatten die Abgeordneten von Rom gerufen, «das Unerträgliche gewöhnt man nicht. Und der Kaiser könnte ein Unerhörtes erleben, das er sich nicht träumen läßt.»
Dies Unerhörte konnte sich Cethegus nur als die Erhebung Italiens zur Selbständigkeit denken: er kannte kein Drittes. Aber er irrte. So klein er von seiner Zeit und seinen Landsleuten dachte—er hatte geglaubt, sie durch sein Beispiel gehoben zu haben. Jedoch den Gedanken: «Freiheit und Erneuerung Italiens», seinem Geist so geläufig, ja so notwendig wie der Brust das Atmen—dies Geschlecht vermochte ihn nicht mehr zu fassen. Nur zwischen verschiedenen Herren schwanken und wählen konnten die Entarteten. Und da das Joch von Byzanz sich als unertragbar erwies, fing man an, wieder der milden Gotenherrschaft zu gedenken: eine Möglichkeit, die dem Präfekten gar nicht in die Gedanken geriet. Und doch kam es so.
Vor Tarvisium, Ticinum und Verona geschah schon jetzt im kleinen, auf dem flachen Lande, was sich im großen in den Städten wie Neapolis und Rom vorbereitete: die italische Landbevölkerung erhob sich gegen die byzantinischen Beamten und Soldaten, wie die Bewohner jener drei Städte in jeder Weise die gotischen Besatzungen unterstützten.
So wurden die Belagerer von Tarvisium genötigt, ihre Angriffe aufzugeben und sich auf Verteidigung ihres Lagers zu beschränken, nachdem Totila in einem Ausfall, unterstützt von bewaffneten Colonen des Flachlands, ihre Werke zum großen Teil zerstört hatte. Aus der Landschaft zog er nun Vorräte und Streiter in seine Feste. Mit froherem Herzen als seit sehr langer Zeit hielt Totila seinen Abendrundgang auf den Wällen von Tarvisium.
Die Sonne, die hinter den venetischen Bergen niedersank, vergoldete die Ebene vor ihm, und rote Wolken flogen freundlich an dem Himmel hin. Mit gerührtem Herzen sah er, wie die Bauern von der Umgegend von Tarvisium durch das geöffnete Tor strömten und seinen ausgehungerten Goten Brot, Fleisch, Käse, Wein zutrugen, während diese ins Freie eilten und nun Germanen und Italier, mit verschlungenen Armen, die jüngst gemeinsam über die verhaßten Feinde erfochtenen Vorteile gemeinsam feierten.
«Und sollte es denn unmöglich sein», sagte der Sieger zu sich selbst, «diese Eintracht zu erhalten, zu erweitern über das ganze Land? Müssen denn die Völker beharren in unversöhnlichem Zwiespalt? Wie schön steht beiden diese Freundschaft! Haben nicht auch wir gefehlt, sie als Feinde, als Besiegte zu behandeln? Mit Argwohn ist man ihnen begegnet, statt mit ehrendem Vertrauen. Ihren Gehorsam haben wir verlangt, nicht ihre Liebe gesucht. Und diese wäre wohl des Suchens wert gewesen. War sie gewonnen—nie hätte Byzanz hier Fuß gefaßt. Die Lösung meines Gelübdes—Valeria!—, sie wäre nicht so unerreichbar fern. Wär' mir es noch vergönnt, auf meine Weise nach jenem Ziele zu ringen!»
Da unterbrach sein Denken und Träumen ein Bote von den vorgeschobenen Wachen mit der Meldung, die Feinde hätten ihr Lager eilig abgeräumt und seien in vollem Abzug nach Süden, gegen Ravenna—auf der Straße von Westen her wirble Staub, ein starker Haufe Reiter nahte, vermutlich Goten.
Erfreut, aber noch zweifelnd nahm Totila die Nachricht auf: er traf alle Vorkehrungen wider eine Kriegslist. Doch in der Nacht wurden seine Zweifel gelöst. Er wurde geweckt mit der Nachricht eines gotischen Sieges und des Eintreffens der Sieger. Er eilte in den Vorsaal und sah Hildebrand, Teja, Thorismut und Wachis.
Mit dem Zuruf «Sieg! Sieg!» begrüßten ihn die Freunde; und Teja und Hildebrand meldeten, daß auch bei Ticinum und Verona das Landvolk sich gegen die Byzantiner erhoben und ihnen geholfen habe, die Belagerer zu überfallen und, nach Zerstörung ihrer Werke, zum Abzug zu zwingen.
Aber bei diesem Bericht lag doch in Tejas Auge und Stimme noch tiefere, als die gewohnte Schwermut. «Was hast du neben dieser Freude Trauriges zu künden?» fragte Totila.
«Des besten Mannes schmähliches Verderben!» und er winkte Wachis, welcher nun die Leiden und den Tod des Königs und seines Weibes erzählte.
«Im Röhricht des Flusses», schloß er, «war ich den Pfeilen der Hunnen entgangen. So leb' ich noch. Aber nur zu dem einen Ende, meinen Herrn, meine Herrin zu rächen an ihrem Verräter und Mörder, dem Präfekten.»—«Nein, mir ist des Präfekten Haupt verfallen!» sprach Teja.—«Das nächste Recht auf ihn», sagte Hildebrand, «hast du, Totila. Denn einen Bruder hast du an ihm zu rächen.»
«Mein Bruder Hildebad!» rief Totila, «was ist mit ihm?»—«Schändlich ermordet ist er, Herr», sprach Thorismut, «von dem Präfekten! Vor meinen Augen! Und ich konnt's nicht wenden.»—«Mein starker Hildebad tot!» klagte Totila. «Rede!»
«Der Held lag mit uns in der Burg Castra Nova bei Mantua. Das Gerücht vom empörenden Untergang des Königs hatte uns erreicht. Da forderte Hildebad beide, Belisar und Cethegus, zum Zweikampf. Bald darauf erschien ein Herold, meldend, Belisar habe die Forderung angenommen und erwarte deinen Bruder zum Kampf auf der Ebene zwischen unserem Wall und ihrem Lager. Frohlockend eilte dein Bruder hinaus, wir Reiter alle folgten. Wirklich ritt aus dem Zelte in seiner goldnen Rüstung, mit geschlossenem Helm und weißem Roßschweif, mit dem runden Buckelschild, uns allen wohlbekannt, Belisarius.
Nur zwölf Reiter folgten ihm. Allen voran auf seinem Rappen Cethegus, der Präfekt. Die andern Byzantiner hielten vor ihrem Lager; Hildebad befahl mir, mit elf Reitern ihm in gleichem Abstand zu folgen.
Die beiden Kämpfer begrüßten sich mit dem Speere: die Tuba tönte, und Hildebad sprengte auf seinen Gegner los. Im Augenblick flog dieser durchstoßen vom Pferd.
Dein Bruder, völlig unverletzt, sprang ab, mit dem Ausruf: ‹Das war kein Stoß des Belisar!› und öffnete dem Sterbenden den Helm. ‹Bessas!› rief er und sah, ergrimmt über den Betrug, gegen die Feinde.
Dann winkte der Präfekt. Die zwölf maurischen Reiter schleuderten ihre Speere—und schwer getroffen stürzte dein Bruder zusammen.»
Totila verhüllte sein Haupt. Teja trat ihm teilnehmend näher.
«Hör' zu Ende», sprach Thorismut. «Da ergriff uns, die wir den Mord mit angesehen, grimmiger Schmerz. Wütend warfen wir uns auf die Feinde, die, auf unsre Entmutigung hoffend, aus dem Lager gedrungen waren. Nach wildem, heißem Kampf schlug sie unser Ingrimm in die Flucht. Nur seines Höllenrappens Schnelligkeit hat den von meinem Wurfspeer an der Schulter verwundeten Präfekten gerettet. Mit leuchtenden Augen sah dein Bruder noch unsern Sieg. Er ließ sich die Truhe, die er aus Ravenna entführt, vom Schloß herabbringen, öffnete und sprach zu mir: ‹Kronhelm, Schild und Schwert Theoderichs. Bring' sie meinem Bruder!›
Und mit letztem Atem sprach er: ‹Er soll mich rächen und das Reich erneuern. Sag' ihm, ich hab' ihn sehr geliebt!› Damit fiel er zurück auf seinen Schild, und seine treue Seele war dahin.»
«Mein Bruder! O mein lieber Bruder!» klagte Totila. Er lehnte sich an die Säule. Tränen brachen aus seinen Augen.
«Wohl ihm, der noch weinen kann!» sprach Teja leise.
Eine Pause des Schmerzes trat ein.
«Gedenke deiner Eidpflicht!» rief endlich Hildebrand. «Er war zwiefach dein Bruder! Du mußt ihn rächen!»
«Ja», rief Totila aufspringend; und unwillkürlich riß er das Schwert aus der Scheide, dessen Griff ihm Teja hinreichte. «Ich will ihn rächen!»
Es war das Schwert Theoderichs.
«Und das Reich erneuern!» sprach feierlich, sich hochaufrichtend, der alte Hildebrand und drückte fest die Krone auf Totilas Haupt. «Heil dir, König der Goten!»
Totila erschrak. Er griff rasch mit der Linken nach dem goldnen Reif «Was tut ihr?»
«Das Rechte! Der Sterbende hat Weissagung gesprochen. Du wirst das Reich erneuern. Drei Siege rufen dich, den Kampf aufzunehmen. Gedenke des Bluteids. Noch sind wir nicht wehrlos. Sollen wir die Waffen aus der Hand legen? Sie vor Verrat und Tücke strecken?»
«Nein», rief Totila, «das wollen wir nicht! und wohlgetan ist's, einen König wählen, als Zeichen neuer Hoffnung!—Aber hier steht Teja, würdiger, bewährter denn meine Jugend. Wählt Teja.»
«Mich als Bürgen der Hoffnung! Nein!» sagte dieser, das Haupt schüttelnd. «Erst trifft die Reihe dich! Dir hat der Bruder sterbend Schwert und Krone gesendet. Trage sie glücklich.
Ist dies Reich zu retten—wirst du es retten. Ist es nicht zu retten so muß noch ein Rächer übrig sein!»
«Jetzt aber», fiel Hildebrand ein, «jetzt gilt es, Siegeszuversicht in alle Herzen schimmernd ausstreuen. Das ist dein Amt, Totila. Sieh, leuchtend taucht der junge Tag empor. Der Sonne früheste Strahlen brechen in die Halle und küssen glänzend deine Stirn. Das ist ein Götterzeichen. Heil, König Totila—du sollst das Gotenreich erneuern.»
Und der Jüngling drückte sich den Kronhelm fest auf das goldne Lockenhaupt und schwang das Schwert Theoderichs blitzend der Morgensonne entgegen. «Ja», rief er, «wenn Menschenkraft es mag—ich will dies Reich erneuern.»
Und König Totila hat sein Wort gehalten.
Noch einmal hat er die Macht der Goten, deren ganzer Halt in Italien bei seiner Erhebung zusammengeschrumpft war auf drei kleine Städte mit wenigen Tausenden von Bewaffneten, gewaltig aufgerichtet: gewaltiger, als sie zur Zeit Theoderichs gewesen.
Er vertrieb die Byzantiner aus allen Städten der Halbinsel—mit einer verhängnisvollen Ausnahme. Er gewann die Inseln Sardinien, Sizilien, Corsica zurück. Ja, noch mehr: siegreich überschritt er die alten Grenzen des Reichs, und da der Kaiser hartnäckig die Anerkennung des gotischen Reiches und Besitzstandes verweigerte, trugen, ihn zu zwingen, des Gotenkönigs Flotten bis tief in die Provinzen des oströmischen Reiches Schreck und Zerstörung.
Italien aber gewann unter seinem milden Zepter, unerachtet des nie völlig erlöschenden Kriegs, eine Blüte wie in den Tagen Theoderichs.
Und es ist bezeichnend, daß die Sage der Goten und Italier den glücklichen König bald als einen Enkel des Numa Pompilius oder des Titus oder Theoderichs, bald als dessen zur Wiederherstellung und Beglückung seines Reiches in jugendlicher Gestalt auf die Erde zurückgekehrten Genius feierte.
Wie der Aufgang der Morgensonne aus dunklem Nachtgewölk, Licht und Segen bringend und unwiderstehlich, wirkte seine Erhebung. Die finstern Schatten wichen Schritt für Schritt vor seinem Nahen: Glück und Sieg flogen vor ihm her, und die Tore der Städte, die Herzen der Menschen erschlossen sich vor ihm fast ohne Widerstand.
Die Genialität des Feldherrn, des Herrschers und des Menschen, die in diesem blonden Jüngling geschlummert hatte, die nur von einzelnen, von Theoderich und Teja, geahnt, von niemand in ihrem ganzen Umfang erkannt war, entfaltete sich nun glänzend, da sie vollen Flügelraum erhalten. Das Heiter-Jugendliche seines Wesens war in den schweren Prüfungen dieser Jahre, in den Schmerzen, die er zu Neapolis, vor Rom erduldet, in der fortwährenden Entbehrung der Geliebten, die ihm jeder Sieg der Byzantiner ferner rückte, zwar nicht ausgelöscht, jedoch in ernstere Männlichkeit vertieft worden. Aber jener schimmernde Grundzug seines Wesens war geblieben und warf den Zauber der Anmut der herzgewinnenden Liebenswürdigkeit über all sein Tun.
Getragen von der eigenen Idealität wandte er sich vertrauend überall an das Ideale in den Menschen. Und unwiderstehlich fanden die meisten, fanden alle nicht von überlegenen feindseligen Dämonen beherrschten Menschen seine zuversichtliche Berufung auf das Edle und Schöne. Wie das Licht erhellt, was es berührt, so schien die Hochherzigkeit dieses lichten Königs sich seinem Hof, seiner Umgebung mitzuteilen und auch die Gegner versöhnend zu ergreifen.
«Er ist unwiderstehlich wie der Sonnengott», riefen die Italier.
Näher betrachtet lag das Geheimnis seiner großen und raschen Erfolge in der Kunst, mit welcher er, zugleich dem innersten Antrieb seiner Natur folgend, die neu vorgefundene Verbitterung der Italier über den Druck der Byzantiner überall zum Umschlag, zur Dankbarkeit für seine, für die gotische Milde zu steigern und umzulenken verstand.
Wir sehen, wie diese Stimmung das Landvolk, die reichen Kaufleute, die Handwerker in den Städten, die Colonen und kleinen und mittleren Bürger, also weitaus die Mehrzahl der Bevölkerung, bereits ergriffen hatte. Die Persönlichkeit des jungen Gotenkönigs zog sie dann vollends von den byzantinischen Drängern ab, von welchen auch das Waffenglück gewichen schien, seit die Goten mit dem helljauchzenden Schlachtruf: «Totila!» in den Kampf eilten.
Freilich blieb eine kleine Minderzahl unbeugsam: die rechtgläubige Kirche, die keinen Frieden mit den Ketzern kannte, starre Republikaner und der Kern der Katakombenverschwörung: die stolzen römischen Adelsgeschlechter, die Freunde des Präfekten. Aber diese kleine Zahl kam bei dem Abfall der Masse des Volkes nicht in Betracht.
Die erste Tat des neuen Königs war der Erlaß eines Aufrufs an die Goten und an die Italier. Jenen wurde genau dargetan, wie der Fall Ravennas und der Untergang des Königs Witichis nur das Werk überlegener Lüge, nicht überlegener Kraft gewesen, und eingeschärft wurde ihnen die Pflicht der Rache, die bereits drei Siege eröffnet hätten. Die Italier aber wurden aufgefordert, nun, nachdem sie erfahren, welchen Tausch sie durch den Abfall zu Byzanz gemacht, zu ihren alten Freunden zurückzukehren.
Dafür verhieß der König nicht nur volle Verzeihung, auch Gleichstellung mit den Goten. Aufhebung aller bisherigen gotischen Vorrechte, namentlich Bildung eines eignen italischen Heeres und, was durch den Gegensatz besonders wirkte: Befreiung alles italischen Bodens und Vermögens von jeder Steuer bis zur Beendigung des Krieges. Eine Maßregel höchster Klugheit war es ferner, daß, da der Adel byzantinisch, die Colonatbevölkerung gotisch gesinnt war, jeder römische Edle, der sich nicht binnen drei Wochen den Goten stellte und unterwarf, seines Grundeigentums, zugunsten seiner bisherigen Colonen verlustig erklärt wurde.
Und endlich setzte der König auf jede Mischehe zwischen Goten und Römern eine hohe, aus dem Königsschatz zu zahlende Prämie und versprach Ansiedelung des Paares auf konfisziertem Grundbesitz römischer Senatoren.
«Italia», schloß das Manifest, «blutend aus den Wunden, welche die Tyrannei von Byzanz ihr geschlagen, soll sich erheben unter meinem Schilde. Helft uns, Söhne Italias, unsere Brüder, von diesem heiligen Boden die gemeinsamen Feinde, die Hunnen und Skythen Justinians, vertreiben. Dann soll im neuen Reich der Italier und Goten, gezeugt aus italischen Schönheit und Bildung, aus gotischer Kraft und Treue, ein neues Volk entstehen, desgleichen an Adel und Herrlichkeit noch nie die Welt geschaut.»
Als Cethegus der Präfekt auf seinem Feldbett zu Ravenna, wo ihn die Wunde fesselte, morgens vom Schlaf erwachend, die Nachricht erfuhr von Totilas Erhebung, sprang er mit einer Verwünschung aus den Decken.
«Herr», warnte ihn der griechische Arzt, «du mußt dich schonen...»
«Hörst du nicht? Totila trägt die Gotenkrone! Jetzt ist nicht Zeit, sich zu schonen. Meinen Helm, Syphax.»
Und er riß Lucius Licinius, der die Botschaft gebracht, den Aufruf aus der Hand und las begierig.
«Ist das nicht lächerlich? Nicht Wahnsinn?» meinte dieser.
«Wahnsinn ist es, wenn die Römer noch Römer sind. Aber sind sie's noch? Sind sie es nicht mehr?—Dann schaffen wir—und nicht der Barbarenfürst—ein Werk des Wahns. Diese Probe darf gar nicht gemacht werden. Im Keime muß diese neue Gefahr zertreten werden. Der Streich gegen den Adel und für die Colonen ist ein Meisterstück. Er darf nicht Zeit haben zu wirken. Wo ist Demetrius?»
«Schon gestern abend aufgebrochen, Totila entgegen. Du schliefst, der Arzt verbot, dich zu wecken. Auch Demetrius verbot es.»
«Totila König, und ihr laßt mich schlafen! Wißt ihr nicht, daß dieser Blondkopf der Genius des Gotenvolkes ist? Demetrius will sich den Lorbeer allein holen. Wie stark ist er?»
«Den Goten mehr als zweimal unterlegen: Zwölftausend gegen Fünftausend.»—«Verloren ist Demetrius! Auf, zu Pferd! Bewaffnet alles, was eine Lanze tragen kann. Laßt nur die Wunden auf den Wällen. Dieser Brand Totila muß erstickt werden im ersten Knistern. Sonst löscht ihn kein Ozean von Blut mehr aus. Meine Waffen, zu Pferd.»
«So hab' ich den Präfekten nie gesehen», sagte Lucius Licinius zu dem Arzt. «Es ist wohl das Fieber? Er erbleichte.»
«Er ist fieberfrei.»
«Dann fass' ich's nicht. Denn Furcht kann es nicht sein. Syphax, laß uns ihm folgen.»
Rastlos trieb Cethegus seine Scharen vorwärts. So rastlos, daß nur ein kleines Reitergefolge mit seinem Ungestüm und Pluto, seinem raschen und unermüdlichen Rappen, Schritt halten konnte. In weiten Zwischenräumen folgten Marcus Licinius, Massurius mit des Cethegus Söldnern und Balbus mit den in Eile bewaffneten Bürgern von Ravenna. Denn wirklich nur Greise und Kinder hatte Cethegus neben den Wunden in der festen Stadt zurückgelassen.
Endlich hatte der Präfekt wenigstens Fühlung mit dem Nachtrab des byzantinischen Feldherrn gewonnen. Totila zog von Tarvisium her nach Süden gegen Ravenna. Zahlreiche Haufen bewaffneter Italier, aus den Provinzen Ligurien, Venetien, Ämilia stießen zu ihm, durch seine Worte aufgerufen zu neuer Hoffnung und neuen Entschlüssen. Sie verlangten seine erste Schlacht gegen die Byzantiner mit schlagen zu dürfen.
«Nein», hatte Totila ihren Führern erwidert, «erst nach der Schlacht faßt euren letzten Entschluß. Wir Goten fechten allein. Siegen wir, so mögt ihr uns folgen. Fallen wir, so soll euch nicht der Byzantiner Rache treffen. Wartet ab.»
Die Verbreitung solch hochsinniger Entscheidung zog neue italische Scharen zu den Goten heran.
Totilas Heer aber verstärkte sich von Stunde zu Stunde auf dem Marsche auch durch gotische Krieger, die einzeln oder in kleinen Scharen, aus der Gefangenschaft entkommen, oder auch aus ihren früher erreichten Verstecken wieder aufbrachen, nachdem sie den Verrat an Witichis und die Erhebung eines neuen Königs, das Wiederaufflammen des Krieges erfuhren.
Bei der Eile, mit welcher Totila vorwärts drängte, die frische Begeisterung seiner Scharen noch unverhüllt zu verwerten, und bei dem Eifer, mit dem Demetrius ihm entgegenflog, um ihn allein zu schlagen, stießen die beiden Heere bald aufeinander.
Bei Pons Padi war es.
Die Byzantiner standen in der Ebene, sie hatten den Fluß, den sie erst mit der Hälfte ihres Fußvolkes überschritten hatten, hinter sich. Da erschienen die Goten auf den sanft geneigten Höhen, den Rücken nach Nordwesten.
Die untergehende Sonne blendete die Byzantiner.
Totila übersah von dem Hügel, dicht vor den Feinden, deren Stellung. «Mein ist der Sieg»! rief er jauchzend, zog das Schwert und jagte mit seiner Reiterei auf die Feinde hernieder, wie der Falke auf seine Beute stößt.
Cethegus hatte bald nach Sonnenuntergang mit seinen Reitern das letzte, verlassene Lager der Byzantiner erreicht. Da jagten ihm schon die ersten Flüchtlinge entgegen. «Wende dein Roß, Präfekt», rief ihm der erste Reiter zu, der ihn erkannte, «und rette dich. Totila über uns! Er hat Artabazes, dem tapfersten Führer der Armenier, mit eigner Hand Helm und Kopf durchhauen.»
Und unaufhaltsam jagte der Flüchtling weiter.
«Ein Gott vom Himmel führte die Barbaren!» schrie ein zweiter. «Alles verloren! Der Feldherr gefangen! Alles in wilder Flucht.»
«Unwiderstehlich ist dieser König Totila!» rief ein dritter und wollte an dem Präfekten vorbei, der den Weg versperrte.
«Sag's in der Hölle weiter!» sprach Cethegus und stieß ihn nieder. «Vorwärts!»
Aber kaum ausgesprochen, nahm er den Befehl zurück.
Denn schon fluteten in dichten Massen die geschlagenen Byzantiner, den ganzen Wald erfüllend, zurück und ihm entgegen. Der Präfekt erkannte: unmöglich war's mit seinem Häuflein die Flucht der Tausende aufzuhalten. Eine Zeitlang sah er unschlüssig dem Gewoge zu.
Schon wurden die gotischen Verfolger in der Ferne sichtbar. Da erreichte ihn verwundet Vitalius, ein Heerführer des Demetrius. «O Freund», rief ihn dieser an. «Da ist kein Halten mehr! Das flutet fort bis Ravenna!»
«Ich glaub' es selbst», sprach Cethegus. «Sie werden die Meinen eher mit sich fortreißen als stehen.»
«Und doch verfolgt uns nur die Hälfte der Sieger, unter Teja und Hildebrand. Der König wandte noch auf dem Schlachtfeld um. Ich sah ihn abziehen. Er schwenkte nach Südwesten.»
«Wohin?» fragte Cethegus aufmerksam, «sag' nochmal an! In welcher Richtung?»
«Nach Südwesten bog er aus!»
«Er will nach Rom!» rief Cethegus und riß den Hengst herum, daß er bäumend hochstieg. «Folgt mir! Zur Küste!»
«Und das geschlagene Heer? Ohne Führer!» rief Lucius Licinius, «sieh, wie sie fliehen!»
«Laß sie fliehen! Ravenna ist fest! Es wird sich halten. Hört ihr denn nicht? Der Gote will nach Rom! Wir müssen vor ihm dort sein. Folgt mir! An die Küste, der Seeweg ist frei! Nach Rom!»
Lieblich ist—und weit berühmt ob seiner Lieblichkeit—das Tal, in welchem die Passara von Norden her in die von Westen nach Südosten eilende Athesis rinnt. Wie eine vorgebeugte, nach dem schönen Südland sehnende Gestalt neigt sich in der Ferne auf deren rechten Ufer die Mendola heran.
Hier, oberhalb des Einlaufs der Passara, lag die römische Siedlung Mansio Majä. Noch etwas weiter flußaufwärts, auf beherrschendem Fels die Burg Teriolis. Heute heißt—von einem Berg «Muhr» oder «Mar» (Rutsche)—die Stadt Meran. Die Burg hat der Grafschaft Tirol den Namen gegeben. «Mansio Majä» klingt heute noch fort in dem Orte Mais, dem villenreichen.
Damals aber lag in dem Castrum Teriolis ostgotische Besatzung: wie in all den alten rätischen Felsennestern an der Athesis, Isarcus und Önus zur Abwehr der räuberischen Sueven, Alamannen und Markomannen oder, wie sie bereits genannt wurden: «Bajuvaren», die in Rätien, am Licus und am untern Lauf des Önus saßen.
Aber auch abgesehen von der Besatzung der Kastelle waren gerade hier in dem fruchtreichen milden Tal, auf den nicht allzu schroffen, weidereichen Berghöhen ostgotische Sippen in großer Zahl angesiedelt worden.
Noch heute zeichnet die Bauern vom Meraner, Ultner und Sarntal eine seltne, edle, ernste Schönheit aus. Viel feiner, vornehmer und vertiefter als der bajuvarische Schlag am Inn, Lech und Isar sind die schweigsamen Leute. Mundart und Sage bestätigen die Annahme, daß hier ein Rest verschonter Goten fortblüht. Denn die Amalungensage, Dietrich von Bern und der Rosengarten lebt noch in den Ortsnamen und der Überlieferung des Volks.
Auf einem der höchsten Berge an dem linken Ufer der Athesis hatte sich voreinst der Gote Iffa niedergelassen: sein Geschlecht baute da fort. Der «Iffinger» heißt heute noch der Berg.
Auf dem Südabhang in halber Höhe des Berges war die schlichte Siedlung errichtet. Der gotische Einwanderer hatte bereits Kulturen hier angetroffen. Das rätische Alpenhaus, das schon Drusus vorgefunden, als er die sarenischen Bergvölker bezwang, charakteristisch und wohlgeeignet für die Alpen, hatte auf den Höhen keine Änderungen erfahren durch die römische Eroberung, die im Tal ihre Villen baute und auf den beherrschenden Felshügeln ihre Warttürme.
Die ganz romanisierten Bewohner des Etschtales waren nach der ostgotischen Einwanderung ruhig in ihren Sitzen geblieben. Denn nicht hier, sondern weiter östlich, von der Save her, über den Isonzo, waren die Goten in die Halbinsel eingedrungen, und erst nachdem Ravenna und Odoaker gefallen, hatte Theoderich in friedlich geregelter Ordnung seine Scharen auch über Norditalien und das Etschland verbreitet.
So hatten auch Iffa und die Seinen auf dem damals noch sarenisch benannten Berg sich mit den vorgefundenen römischen Ansässigen friedlich geteilt. Ein Drittel von Ackerland, Wiese und Wald, den dritten Teil von Haus, Sklaven und Vieh hatte auch hier, wie überall, der gotische Ankömmling vom römischen Wirt in Anspruch genommen. Im Lauf der Jahre jedoch hatte der römische Hospes diese nahe unfreiwillige Nachbarschaft mit den Barbaren unbequem gefunden. Er überließ den Goten gegen dreißig Paare der ausgezeichneten, aus Pannonien mitgeführten Rinder, die der Germane so trefflich zu züchten verstand, den Rest seines Eigens auf dem Berge und zog sich weiter gen Süden, wo die Römer dichter nebeneinander saßen.
So war nun der Berg der Iffinger ganz germanisch geworden. Denn plötzlich hatte einmal der jetzige Herr auch die wenigen römischen Sklaven verkauft und neue Knechte und Mägde germanischen Stammes, gefangene Gepiden, angeschafft. Dieser jetzige Herr der Siedlung hieß wieder Iffa, wie der Ahn. Er lebte einsam, ein silberhaariger Mann: ein Bruder, sein Weib und eine Schwiegertochter waren vor langen Jahren durch einen Bergsturz begraben worden. Ein Sohn, ein jüngerer Bruder und dessen Sohn waren König Witichis' Waffenruf gefolgt und nicht wiedergekehrt von der Belagerung Roms. So waren ihm nur seine beiden Enkelkinder geblieben, des gefallenen Sohnes Knabe und Mädchen.
Die Sonne war prachtvoll niedergegangen hinter den Bergen, die in weiter duftiger Ferne den Süden und Westen des unvergleichlichen Etschtales begrenzen.
Warmer rotgoldner Schimmer lag über dem mürben Porphyr der Berge, daß er erglühte wie dunkelroter Wein.
Da stieg langsam, Schritt vor Schritt, immer wieder anhaltend und, die Hand über die Augen gelegt, in den flimmernden Sonnenuntergang schauend, ein Kind—oder war es schon ein Mädchen?—, eine Schar Lämmer vor sich hertreibend, den Rasenhang hinan, auf dessen Höhe seitab vom Wohnhaus die Stallungen lagen.
Sie ließ ihren Schutzbefohlenen immer wieder Zeit, mit wählerischem Zahn die würzigen Alpenkräuter zu rupfen auf ihrem Weg, und schlug mit der Haselgerte, die sie statt des Hirtenstabes trug, den Takt zu der uralten und einfachen Melodie des Liedchens, das sie leise sang:
«Liebe Lämmer, laßt euch leiten
Von der Hirtin Hand, gehorsam,
Wie des Himmels lichte Lämmer,
Wie die Sterne still und stete
Fromm und friedlich ihrem hehren
Hirt gehorchen: mühlos meistert,
Mühlos mustert sie der Mond.»
Sie schwieg nun und sah mit vorgebeugtem Köpfchen in die tief eingeschnittene Schlucht zu ihrer Linken, die der hier abwärts fließende Wildbach in den Hang gefurcht hatte: jetzt, im Sommer, war er nur halb gefüllt: drüben stieg die Anhöhe wieder steil empor.
«Wo er nur ist?» fragte sie. «Sonst klettern seine Ziegen immer schon die Halde herab zurück, wann die Sonne zu Golde gegangen. Bald welken meine Blumen.»
Und sie setzte sich nun auf einen Steinblock am Wege, ließ die Lämmer noch grasen, legte die Haselgerte neben sich und ließ einen Schurz von Schaffell, den sie bisher mit der Linken aufgenommen hatte, niedergleiten: da fielen die schönsten Blumen der Alpen in dichten Flocken vor ihr nieder. Sie begann einen Kranz zu flechten.
«Der blaue Speik steht seinem braunen Haar am besten», sagte sie eifrig windend. «Ich werde viel früher müde, wenn ich allein treibe, als wenn er dabei ist. Und doch klettern wir dann viel höher. Möchte wohl wissen, wie das kommt. Und wie mich die nackten Füße brennen! Ich könnte wohl einmal hinabsteigen in den Wildbach, sie zu kühlen. Und da sehe ich ihn auch gleich, wenn er drüben auf den Hang treibt. Die Sonne sticht nicht mehr.»
Und sie streifte das breite große Lattichblatt ab, das sie bisher statt eines Hutes getragen. Da ward die schimmernde Farbe des ganz weißblonden Haares sichtbar, das sie, von den Schläfen zurückgestrichen, mit einem roten Bande hinter dem Wirbel zusammengebunden und bisher unter dem umgebogenen Blatt geborgen hatte. Wie eine Flut von Sonnenstrahlen rieselte es nun über ihren Nacken, den nur ein weißes Wollenhemd bedeckte, das, um die Hüften mit breitem Ledergurt zusammengehalten, nur wenig über die Knie reichte.
Sie maß die Länge ihres Kranzes an dem eignen Haupt. «Freilich», sagte sie, «sein Kopf ist größer! Noch diese Alpenrosen dazu!»
Und nun verknüpfte sie die beiden Enden des Kranzes mit zierlichem Bandgras, sprang auf, schüttelte die letzten Blumen aus dem Lederschurz, nahm den Kranz in die Linke und wandte sich, den steilen Abhang hinabzusteigen, an dessen Fuß der Bach an das Gestein toste.
«Nein, bleibt nur hier oben und wartet! Auch du bleib, Weiß-Elbchen, Liebling. Gleich komm' ich wieder.»
Und sie trieb die Lämmer zurück, die ihr folgen wollten und nun blökend der Herrin nachsahen.
Behend kletterte und sprang die Wohlgeübte den steinigen Abhang der Schlucht hinab, bald sich mit den Händen an zähem Gesträuch, Seidelbast und Goldweide haltend, bald kühnlich von Stein zu Steinplatte springend.
Unter ihrem Sprung bröckelte das mürbe Gestein, und die Trümmer polterten hinab—da, als sie den rollenden nachhüpfte, hörte sie plötzlich von unten ein scharfes, drohendes Zischen. Und eh' sie wenden konnte, bäumte sich, wohl von einem Stein unsanft aus der Sonnung gestört, eine große kupferbraune Schlange hoch gegen sie empor. Das Kind erschrak, die hurtigen Knie versagten, und laut aufschreiend rief sie: «Adalgoth, zu Hilfe! zu Hilfe!»
Auf diesen Angstton folgte sofort als Antwort ein heller Ruf: «Alarich! Alarich!» was wie ein Schlachtruf klang.—
Es knackte in den Gebüschen zur Rechten, Steine rollten den Hang hinab, und pfeilgeschwind flog zwischen die züngelnde Schlange und das ängstlich weichende Mädchen ein schlanker Bube in zottigem Wolfsvließ. Hoch schwang er den starken Bergstock gleich einem Speer, und so wohlgezielt war sein Stoß, daß die Eisenspitze den schmalen Kopf der Natter in die Erde bohrte. Ihr langer Lieb ringelte zuckend um den tödlichen Schaft.
«Gotho, du bist doch heil?»—«Dank dir, du Treuer!»—«Dann laß mich den Schlangenspruch sprechen, solang die Natter noch zuckt, das bannt ihre Gesippen auf drei Stunden im Umkreis.»
Und er sprach, die drei ersten Finger der rechten Hand wie beschwörend erhoben, den uralten Spruch:
«Warte, du Wolf-Wurm!
Zapple, Gezücht!
Beiße den Boden,
Giftigen Geifers;
Männer und Maide
Sollst du nicht sehren:
Nieder, du Neiding,
Du nichtige Natter,
Nieder zur Nacht:
Hoch ob den Häupten
Schuppiger Schlangen
Schreitet das schimmernde
Gotengeschlecht.»
Als er zu Ende gesprochen und sich neigte, die tote Schlange zu prüfen, drückte ihm rasch die Gerettete ihren Kranz auf das goldbraune, kurz-krause, dichte Haar.
«Heil, Held und Helfer! Sieh, der Siegeskranz war schon vorher gewunden. Eia, wie schön steht dir die blaue Krone.» Und sie schlug freudig bewundernd die Hände zusammen.
«Du blutest am Fuße!» sprach er besorgt, «laß mich die Wunde saugen—wenn dich der Giftwurm gebissen!»—«'s ist nur ein scharfer Stein. Möchtest wohl lieber du sterben?»
«Für dich, Gotho, wie gerne doch! Aber unschädlich wäre das Gift im Munde. Nun, laß dir die Wunde waschen: ich habe noch Essig und Wasser hier in der Lederflasche. Und dann leg' ich dir Salbei drauf oder heilsame Wegewarte.»
Und zärtlich drückte er sie nieder auf das Gestein, kniete vor ihr, hob den nackten Fuß sorgsam in seine linke Hand und pflegte ihn, die Mischung aus dem Kugelrund drauf träufend. Dann sprang er auf, suchte auf dem Rasen und kam bald mit den gefundenen Kräutern zu ihr zurück, mit den Lederriemen, die er sich vom eignen Fuße löste, die Blätter sorgsam über die kleine Wunde bindend.
«Wie gut du bist, Lieber!» sagte sie, sein Haupt streichelnd.—«Nun laß dich tragen—nur den Hang hinauf!» bat er. «Ich halte dich so gern auf meinen Armen.»
«Was nicht gar!» lachte sie aufspringend. «Bin kein wundes Lamm! Sieh, wie ich laufen kann. Aber wo sind deine Ziegen?»
«Dort kommen sie aus den Wacholderbüschen. Ich rufe sie!» Und er setzte das Hirtenrohr an den Mund und blies einen schrillen Ton, den Bergstock im Kreise über dem Haupte schwingend. In eilfertigen Sprüngen kamen die starken Ziegen herbei:—sie scheuten die Strafe! Und aus der Tasche einen dünnen Streifen Salz auf die Erde streuend, den die Tiere, gierig leckend, verfolgten, schritt er nun, den Arm zärtlich um des Mädchens Nacken gelegt, den Hang hinauf.
«Sag' mir nur, Lieber», fragte sie, oben angelangt und die Lämmer sammelnd, «weshalb du heute wieder den Drachen ansprangst mit dem Ruf: ‹Alarich! Alarich!› Wie neulich, da du mir den Steinadler von Weiß-Elbchen scheuchtest, das er schon in den Fängen hatte.»
«Das ist mein Schlachtruf!»
«Wer hat ihn dich gelehrt?»
«Der Ahn, da er mich zum erstenmal mitnahm auf die Wolfsjagd: als ich mir hier das Vließ von Meister Isgrimms Rippen holte. Da sprach er, als ich, ‹Iffa, Iffa!› schreiend, ebenso, wie ich ihn rufen hörte, auf den Wolf, der nicht mehr entweichen konnte und sich mir stellte, mit dem Schwerte sprang: ‹Du mußt nicht «Iffa» rufen, Adalgoth, wie ich. Wenn du Held oder Ungetier angehst, ruf du nur: «Alarich!» Das bringt dir Sieg.›»
«Heißt aber doch keiner unsrer Ahnen und Gesippen so, Bruder! Wir kennen doch ihre Namen alle.»
Und nun hatten sie die Stallungen erreicht, die Tiere hineingetrieben und sich vor der Türe des Wohnhauses, vor dem offenen Fenster, auf die Holzbank gesetzt, welche die Vorderseite des Hauses auf beiden Seiten der Haustüre umzog.
«Da ist», zählte das Mädchen nachdenkend auf, «Iffamer, unser Vater, Wargs der Ohm, den der Berg verschüttet hat, Iffa der Ahn, Iffamuth, der andre Ohm, Iffaswinth, dessen Sohn, unser Vetter, und Iffarich, der Großahn und wieder Iffa—aber kein Alarich.»
«Und doch ist mir noch wie ein Dämmertraum aus der Zeit, da ich zuerst auf dem Berg umherzulaufen anfing, aus der Zeit vor dem großen Bergfall, der den starken Oheim Wargs begrub, als hätte ich den Namen oft gehört. Und er gefällt mir. Und der Ahn hat mir erzählt von einem Heldenkönig dieses Namens, der zuerst vor allen Helden die Romaburg bezwang:—du weißt, die Stadt, von welcher unser Vater und der Oheim Iffamuth und der Vetter Iffaswinth nicht wiedergekehrt sind,—und der dann früh verstarb, wie Siegfried, der Schlangentöter und Baldur, der Heidengott. Und sein Grab ist in einem tiefen Fluß. Da liegt er, auf goldenem Schild, unter seinen Schätzen: und hohes Schilf wogt darüber hin. Und nun hat sich ein andrer König aufgetan, der heißt Totila, wie die Heermänner, welche die Besatzung drüben in Schloß Teriolis ablösten, erzählten. Der soll sein wie jener Alarich und wie Siegfried und wie der lichte Sonnengott. Und ich, hat der Ahn gesagt, soll auch ein Kriegsmann werden, und einst hinabziehn zu König Totila und unter die Feinde stürmen mit dem Ruf ‹Alarich, Alarich›. Und es ist mir auch schon lange verleidet, dies Umhersteigen hier auf dem Berg und das Ziegenhüten, wo kein Feind zu bekämpfen ist als der Wolf und höchstens ein Bär, der die Trauben und die Honigwaben benascht. Und ihr alle lobt mein Harfenschlagen und meine Lieder. Aber ich spüre, daß es damit nicht viel ist, und daß ich von dem Alten nichts mehr darin lernen kann.
Und ich möchte doch noch viel stolzere Weisen singen.
Und ich kann gar nicht genug erzählen hören von den Heermännern drüben in der Burg,von den Siegen des Sonnenkönigs Totila. Neulich hab' ich dem alten Hunibad, den der König zur Pflege seiner Wunden hierher in die Ruhe geschickt hat, den schönsten Berghirsch geschenkt, den ich erlegt, dafür daß er mir die Schlacht an der Padusbrücke zum drittenmal erzählt. Und wie König Totila selbst den finstern Höllenkönig, den schrecklichen Cethegus, überwindet. Und ich habe schon ein Harfenlied davon gedichtet, das hebt an:
‹Zittre und zage,
Zäher Cethegus:
Nicht taugt dir die Tücke:
Teja, der Tapfre,
Zertrümmert den Trotz dir:
Und taghell emportaucht,
Wie Maiglanz und Morgen
Aus Nacht und aus Nebel,
Der leuchtende Liebling
Des Himmels-Herrn:
Der schimmernd-schöne,
Der kühne König.›
Aber weiter geht es noch nicht. Und ich kann auch nicht allein weiter dichten. Ich brauche einen kundigen Meister für Wort und Harfe. Und auf den Speerschwinger Teja, den sie den schwarzen Grafen nennen, und der wunderbar die Harfe schlagen soll, möcht' ich auch ein halbfertiges Lied vollenden. Und ich wäre schon lang—aber das sag' ich nur dir—davongegangen, ohne den Ahn zu fragen, der immer noch sagt: ich bin zu jung. Wenn mich eins nicht hier hielte.» Und er sprang hastig auf.
«Was denn, Bruder?» fragte Gotho, ruhig sitzen bleibend und ihn aus großen hellblauen Augen voll ansehend.
«Ja, wenn du's nicht weißt»,—sprach er fast zornig, «sagen kann ich's dir nicht.—Ich muß hinüber und neue Pfeilspitzen schmieden in der Schmiedhütte. Gib mir noch einen Kuß, so! Und laß nun dir noch einen auf jedes Auge legen! Und einen auf das lichte Haar! Fahr wohl, lieb Schwesterlein, bis zum Nachtmahl.» Und er eilte hinweg von ihr nach einem Nebengebäude, vor dessen Tür ein Schleifstein und allerlei Arbeitsgerät stand.
Gotho stützte die Wange auf die Hand und sah vor sich hin, dann sagte sie laut: «Ich kann's nicht raten. Denn mich würd' er ja mitnehmen, natürlich. Wir könnten ja gar nicht leben ohne einander.»
Sie stand mit einem leichten Seufzer auf und wandte sich dem Wiesgrund neben dem Hause zu, nach dem Linnen zu sehen, das dort zur Bleiche lag.
Aber im Wohnhaus hinter dem offenen Fenster erhob sich jetzt der alte Iffa. Er hatte alles mit angehört. «Das tut kein gut mehr!» sprach er, sich lebhaft den Kopf reibend. «Hab's immer nicht über das Herz gebracht, die Kinder zu trennen. Waren ja Kinder! Hab' immer noch ein Weilchen gewartet. Und jetzt hätt' ich gar schon bald ein Weilchen zu lang gewartet. Fort mit dir, jung Adalgoth!»
Und er trat aus dem Wohnhaus und schritt langsam hinüber in die Schmiede.
Er fand den Knaben in eifriger Arbeit. Mit vollen Backen blies er in die Kohlenglut am Schmiedeherd und hielt dann die schon roh bearbeiteten Pfeilspitzen hinein, sie zu erweichen und hämmerbar zu glühen. Dann griff er mit der Zange die Spitze heraus, legte sie auf den Schmiedknecht, den Amboß, und hämmerte zierlich ihre Spitzen und Widerhaken zurecht.
Er nickte nur stumm dem eintretenden Großvater zu, ohne sich in der Arbeit stören zu lassen. Tapfer hieb er auf den Amboß, daß die Funken sprühten. «Nun», dachte der Alte bei sich, «jetzt denkt er doch nur an Pfeil und Eisen.»
Aber plötzlich schloß der junge Schmied mit einem sausenden Streich, warf den Hammer weg, strich sich über die glühende Stirn und fragte, rasch gegen Iffa sich wendend: «Ahn, woher kommen die Menschen?»
«Jesus, Wodan und Maria!» rief der Alte und trat erschrocken einen Schritt zurück. «Bub, wie kommst du auf solche Gedanken?»
«Die Gedanken kommen zu mir, nicht ich zu ihnen. Ich meine nämlich die ersten Menschen, die allerersten. Der lange Hermegisel da drüben in Teriolis, der aus der Arianerkirche zu Verona davongelaufen ist und schreiben und lesen kann, sagt: der Christengott habe in einem Baumgarten einen Mann aus Lehm gemacht und aus dessen Rippe, da er schlief, ein Weib. Das ist zum Lachen. Denn aus einer noch so langen Rippe kann man kein noch so kleines Mädchen machen.»
«Ja, ich glaub's auch nicht!» gestand der Alte, nachdenklich. «'s ist schwer vorzustellen. Und ich erinnere mich: mein Vater hat einmal gesagt, an einem Abend am Herdfeuer, die ersten Menschen seien auf den Bäumen gewachsen. Der alte Hildebrand aber, der sein Freund war, obzwar tüchtig älter—und der von Tridentum her auf einem Streifzug gegen die wilden Bajuvaren hier eingekehrt war, und der zunächst am Herde saß,—denn es war noch früh im Jahr und sehr rauh und kalt—, der sagte: mit den Bäumen, das sei richtig. Aber nicht gewachsen seien die Menschen darauf, sondern zwei Heidengötter—‹Dämonen› nennt sie Hermegisel—haben einst am Meeresufer den Eschenbaum und die Erle liegend gefunden: und aus ihnen bildeten sie Mann und Weib. Es geht auch noch ein altes Lied davon. Hildebrand wußte noch ein paar Worte draus. Mein Vater schon nicht mehr.»
«Das will ich schon lieber glauben! Aber jedenfalls waren da anfangs der Menschen sehr wenige?»—«Gewiß.»—«Und es gab nur eine Sippe anfangs?»—«Sicher!»—«Und die Alten starben meistens vor den Jungen?»—«Freilich.»—«Dann will ich dir was sagen, Ahn. Dann mußten die Menschen entweder aussterben. Oder, da sie noch da sind—und siehst du, da wollt' ich drauf hinaus—, mußten Bruder und Schwester sich oft heiraten, bis mehrere Sippen entstanden.»
«Adalgoth, dich reiten die Elben, du redest wirr.»
«Ganz und gar nicht. Und kurz und gut: wenn's früher geschehen konnte, kann's auch heute noch geschehen. Und ich will meine Schwester Gotho zum Weibe haben.»
Der Alte sprang auf ihn zu und wollte ihm den Mund verhalten.
Aber der Jüngling wich ihm aus. «Ich weiß schon alles, was du sagen willst.
Hier kämen die Priester von Tridentum wohl bald dahinter. Und dann des Königs Graf. Aber ich kann ja mit ihr in ein fernes Land ziehen, wo uns niemand kennt. Und sie geht schon mit, das weiß ich.»
«So, das weißt du auch schon?»
«Ja, das weiß ich.»
«Aber das weißt du noch nicht», sprach nun ernst und entscheidend der Alte, «daß diese Nacht die letzte ist, die du hier zubringst auf dem Berg der Iffinger. Auf, Adalgoth, ich gebiete dir: dein Ahn und dein Mundwalt. Du hast eine Ehrenpflicht, die Pflicht heiliger Rache, zu erfüllen am Hofe König Totilas und in seinem Heer: einen heiligen Auftrag des Oheim Wargs, der unterm Berg verschüttet liegt—einen Auftrag deines—Ahns. Du bist nun reif und stark genug, ihn zu erfüllen.
Morgen, mit dem ersten Tagesgrauen, brichst du auf nach Süden, nach Italia, wo König Totila das Unrecht straft, dem Recht zum Siege hilft und den Neiding Cethegus niederkämpft. Folg' mir in meine Kammer. Dort hab' ich dir ein Kleinod einzuhändigen von Oheim Wargs und manches Wort noch auf den Weg zu geben. Manch Wort des Rates und der Rache. Vor Gotho aber schweige. Mach' ihr das Herz nicht schwer. Befolgst du meine und deines Oheims Worte, wirst du ein starker, freudiger Held werden an König Totilas Hof. Und dann, aber auch nur dann, wirst du auch Gotho—wiedersehen.»
Tiefernst, bleich geworden folgte der Jüngling dem Ahn in das Haus. Lang sprachen sie dort leise in des Alten Kammer.
Bei dem Nachtmal fehlte Adalgoth. Er habe sich, mehr müde als hungrig, schon schlafen gelegt, ließ er der Schwester sagen durch den Ahn.
Aber nachts, da sie schlief, trat er auf leisen Zehen in ihr Gemach.
Der Mond warf einen zarten Strahl auf ihr engelhaftes Angesicht. Auf der Schwelle blieb er stehen. Nur die Rechte streckte er nach ihr aus.
«Ich seh' dich wieder», sprach er, «meine Gotho!»
Und er überschritt bald die Schwelle des schlichten Alpenhauses. Noch begannen kaum die Sterne zu bleichen: frisch, stählend wehte die Nachtluft des Berges um seine Schläfe. Er sah in den schweigenden Himmel. Da schoß ein Stern in hohem Bogen über sein Haupt. Gen Süden flog er nieder. Da erhob der Jüngling den Hirtenstab in der Rechten: «Dorthin rufen mich die Sterne! Nun wahre dich, Neiding Cethegus!»
Der Präfekt hatte nach der Schlacht an der Padusbrücke Boten seinen nachrückenden Scharen entgegengeschickt, die zunächst seine Söldner, dann auch die langsamer folgenden Bürger von Ravenna nach dieser Stadt zurückwiesen. Die flüchtenden Truppen des Demetrius überließ er ihrem Schicksal. Totila hatte alle Feldzeichen und Fahnen der zwölf Tausend erbeutet, «was den Römern nie zuvor geschah», schreibt Prokopius zürnend.
Cethegus selbst eilte mit seinem geringen Gefolge quer durch die Ämilia an die Westküste von Italien, die er bei Populonium erreichte, bestieg ein rasches Kriegsschiff und ließ sich von einem starken Nordnordwest, den, wie er sagte, die alten Götter Latiums gesendet, nach dem Hafen von Rom, Portus, tragen.
Auf dem Landweg hätte er nicht mehr durchdringen können: denn nach dem Sieg Totilas an der Padusbrücke fiel ganz Tuscia und ganz Valeria den Goten zu, das Flachland rückhaltlos, und auch die Städte, die nicht starke byzantinische Besatzung in Zaum hielt.
Bei Mucella, einen Tagmarsch von Florenz, schlug der König nochmal ein starkes Heer der Byzantiner unter elf uneinigen Führern, welche die kaiserlichen Besatzungen der tuscischen Städte zusammengerafft hatten, ihm den Weg zu verlegen. Mit Mühe entkam der Oberfeldherr Justinus nach Florentia. Der König behandelte seine zahlreichen Gefangenen mit solcher Güte, daß sehr viele derselben, Italier und kaiserliche Söldner, in seine Dienste traten. Und nun waren alle Straßen von Mittelitalien bedeckt von neu zu den Waffen eilenden Goten und von Colonen, die, unter deren Anführung, Totilas Märschen gegen Rom folgten.
In dieser Stadt angelangt, hatte Cethegus sofort alle Anstalten zur Verteidigung getroffen. Denn im Fluge nahte nun, nach dem zweiten Siege, bei Mucella, König Totila, aufgehalten fast nur noch durch die Huldigungen der Städte und Kastelle auf seinem Wege, die wetteifernd und jubelnd ihm die bei seinem Eintritt bekränzten Tore erschlossen. Die wenigen Burgen, die, von starken byzantinischen Besatzungen gehalten, widerstanden, wurden eingeschlossen von kleinen Abteilungen, die Totila aus Italiern bildete, durch wenige gotische Kerntruppen zusammengehalten.
Er konnte dies, da seine Macht während des Zuges auf Rom von allen Seiten, einem Strome gleich, große und kleine Zuflüsse von Goten und Italiern erhielt.
Zu Tausenden eilten die italischen Colonen, die er frei erklärt, zu seinen Fahnen. In kleinen Städten erhoben sich die Bürger gegen die byzantinische Besatzung, entwaffneten sie oder zwangen sie zum Abzug. Ja, sogar Söldner Belisars, die seit dessen Entfernung monatelang von den kaiserlichen Logotheten keinen Sold erhalten hatten, boten nun den Goten ihre Waffen an.
So war es ein sehr ansehnliches Heer von Goten und Italiern, das Totila, wenige Tage nach dem Eintreffen des Präfekten, vor die Tore Roms führte.
Mit lautem Jubel wurden bald darauf in dem gotischen Lager der tapfere Wölsung Herzog Guntharis, Wisand der Bandalarius, Graf Markja und der alte Grippa begrüßt, deren Auswechselung gegen den an der Padusbrücke gefangenen kaiserlichen Oberfeldherrn und mehrere seiner Heerführer Totila bei Constantianus und Johannes, den Befehlshabern von Ravenna, erwirkt hatte.
Auf Cethegus aber fiel nun die fast unlösbare Aufgabe, seine großartig angelegten Befestigungen hinlänglich zu bemannen. Fehlte ihm doch nicht bloß das ganze Heer Belisars—auch der größte Teil der eignen Söldner, die erst allmählich auf dem Seeweg von Ravenna her in dem Hafen Portus eintrafen. Um den ganzen Kreis der weiten Umwallung auch nur notdürftig zu decken, mußte Cethegus den römischen Legionären nicht nur ungewohnte und unerwartete Anstrengungen unabgelösten Wachdienstes zumuten—er mußte auch deren Zahl durch Gewaltmaßregeln erhöhen.
Vom sechzehnjährigen Knaben bis zum sechzigjährigen Greise rief er «alle Söhne des Romulus, Camillus und Cäsar zu den Waffen, die Heiligtümer der Väter zu schirmen wider die Barbaren».
Aber sein Aufruf wurde kaum gelesen und verbreitet und führte ihm nur wenige Freiwillige zu, während er mit Ingrimm sah, wie das Manifest des Gotenkönigs, das jede Nacht an vielen Stellen über die Mauern flog, überall umlief und vor dichten Gruppen verlesen wurde: so daß er zornig befahl, jeden mit Einziehung des Vermögens oder Verknechtung zu strafen, der das Manifest aufhöbe, anschläge, vorlese, verbreite. Aber es lief doch überall um, und seine in allen «Regionen» der Stadt ausgelegten Listen der Freiwilligen blieben leer.
Da schickte er seine Isaurier in alle Häuser und ließ Knaben und Greise mit Gewalt auf die Wälle schleppen: bald war er mehr gefürchtet, ja, gehaßt als geliebt. Nur seine eiserne Strenge und das allmähliche Eintreffen seiner isaurischen Söldner hielt noch die Unzufriedenheit der Römer nieder.
In dem Gotenlager aber überholte eine Glücksbotschaft die andre.
Teja und Hildebrand hatten die Byzantiner bis vor die Tore von Ravenna verfolgt. Diese Stadt verteidigten der wieder freigegebene Demetrius und Johannes der Blutige, und die Hafenstadt Constantianus gegen Hildebrand, der Ariminum im Vorüberziehen gewonnen, da die Bürger die armenischen Söldner des Artasires entwaffneten und die Tore öffneten. Teja aber schlug und tötete im Zweikampf den tapfern Byzantiner Feldherrn Verus, der mit auserlesenen pisidischen und kilikischen Söldnern ihm den Übergang des Santernus verwehren wollte, durchzog ganz Norditalien, den Aufruf Totilas in der Linken, das drohende Schwert in der Rechten: und in wenigen Wochen waren alle Städte und Burgen bis auf Mediolanum zur Unterwerfung gewonnen oder geschreckt.
Totila, durch die Erfahrung der ersten Belagerung gewitzigt, wollte sein Heer einem Sturm auf die furchtbaren Werke des Präfekten nicht aussetzen und auch seine künftige Hauptstadt nicht den Zerstörungen stürmender Einnahme preisgeben. «Auf hölzernen Brücken, auf linnenen Flügeln gelang' ich nach Rom!» so rief er eines Tages Herzog Guntharis zu, überließ diesem die Einschließung der Stadt, brach auf mit der ganzen Reiterei und eilte nach Neapolis. In diesem Hafen lag, schwach bemannt, eine kaiserliche Flotte.
Einem Triumphzug, nicht einem Feldzug, glich Totilas Marsch auf der appischen Straße durch Unteritalien. Diese Gegenden, die am längsten unter dem Joche der Byzantiner litten, waren am meisten bereit, nun die Goten als Befreier zu begrüßen.
Mit Blumengebinden zogen die Jungfrauen von Terracina dem schönen Gotenkönig entgegen. Das Volk von Minturnä fuhr, ihm zum Empfang, einen vergoldeten Wagen hinaus, hob ihn vom weißen Roß und zog ihn auf dem Wagen jubelnd in die Tore. «Sehet hin»—scholl es in den Straßen von Casilinum, einer alten Kultstätte der campanischen Diana—, «Phöbus Apollo ist niedergestiegen vom Olymp und hält befreienden Einzug in der Stadt seiner Schwester.» Die Bürger von Capua aber baten ihn, die ersten Goldmünzen seines Königsnamens in ihrer Münze zu prägen mit der Umschrift: «Capua revindicata».
So ging es fort bis Neapolis: dieselbe Straße, die er dereinst, ein Flüchtling, verwundet, in nächtlicher Hast zurückgelegt. Der Befehlshaber der armenischen Söldner in der Stadt, einer sehr tapfern, aber schwachen Schar, der Arsakide Phaza, wagte nicht, der Bevölkerung für den Fall einer Belagerung zu trauen.
Er führte seine Lanzenträger und bewaffnete Bürger von Neapolis dem König zur offenen Feldschlacht entgegen.
Da, vor dem Beginn des Gefechts, ritt ein Reiter auf weißem Roß aus der Schlachtreihe der Goten, nahm den Helm vom Haupt und rief: «Kennt ihr mich nicht mehr, ihr Männer der parthenopäischen Stadt? Ich bin Totila. Ihr habt mich geliebt, da ich der Seegraf eures Hafens war. Ihr sollt mich segnen als euren König. Gedenkt ihr nicht mehr, wie ich eure Weiber und Kinder auf meinen rettenden Schiffen geflüchtet vor den Hunnen Belisars? Vernehmt: diese eure Frauen und Töchter, sie sind abermals in meiner Hand; nicht als Schützlinge, als Gefangene. Nach Cumä habt ihr sie gebracht, in das feste Schloß, sie vor den Byzantinern zu schützen, vielleicht auch vor mir. Wisset aber: Cumä hat sich mir ergeben, und alle dorthin Geflüchteten sind in meine Gewalt gefallen.
Man riet mir: sie als Geiseln zu behalten, euch und die andern Städte zur Ergebung zu zwingen. Das widerstrebt mir. Frei ließ ich sie alle—nach Rom hab' ich die Frauen der römischen Senatoren geleiten lassen. Nur eure Weiber und Kinder, ihr Männer von Neapolis, hab' ich in mein Lager kommen lassen, nicht als Geiseln, nicht als Gefangene:—als meine Gäste. Sehet hin: dort strömen sie aus meinen Zelten. Öffnet die Arme, sie zu empfangen, sie sind frei.
Wollt ihr jetzt gegen mich kämpfen? Ich kann's nicht glauben! Wer ist der erste unter euch, der zielt auf diese Brust?» Und weit schlug er den weißen Mantel auseinander.
«Heil König Totila dem Gütigen!» war die jubelnde Antwort. Und das heißblütige Völklein warf die Waffen nieder, strömte heran, begrüßte jubelnd die befreiten Frauen und Kinder und küßte dem jungen König den Saum des Mantels und die Füße.
Der Führer der Söldner ritt zu ihm heran. «Meine Lanzen sind umringt und zu schwach, allein zu kämpfen. Hier, o König, nimm mein Schwert: ich bin dein Gefangener.»
«Nicht also, tapfrer Arsakide! Du bist unbesiegt—deshalb auch ungefangen. Zieh ab, wohin du willst, mit deiner Schar.»
«Ich bin besiegt und gefangen durch deines Herzens Hoheit und deiner Augen lichten Glanz: verstatte, daß wir fortan für deine Fahne fechten.» Eine auserlesene Kriegerschar war so Totila gewonnen, die fortan treu bei ihm aushielt.
Unter einem Regen von Blumen hielt er seinen Einzug durch die Porta nolana. Noch bevor Aratius, der Befehlshaber der Flotte im Hafen, die Anker seiner Kriegsschiffe lichten konnte, war deren Bemannung von den zahlreichen Matrosen der vielen neben ihnen liegenden Handelsschiffe der Kaufleute—alter Bewunderer und dankbarer Schützlinge Totilas—überwältigt und die Führer gefangen.
Ohne Blutvergießen hatte sich der Gotenkönig eine Flotte und die dritte Stadt des Reiches gewonnen.
Aber von dem Festmahl, das ihm am Abend die jubelnde Stadt bereitete, stahl er leise sich hinweg. Mit Staunen sahen gotische Wachen in der Stille der Nacht ihren König, ohne Gefolge, im halb eingestürzten Turmgemäuer hart am capuanischen Tor neben einem uralten Olivenbaum verschwinden.—
Am andern Tag erschien ein Erlaß Totilas, der die Frauen und Mädchen der Juden von Neapolis für immer von dem bisher entrichteten Kopfgeld befreite und, während ihnen sonst untersagt war, öffentlich Schmuck zu zeigen, verstattete, als Ehrenzeichen auf dem Brustgewand ein goldnes Herz zu tragen.
In dem dicht verwachsenen Gärtchen aber, in welchem verwilderter Efeu und Rosen das hohe Steinkreuz und einen tief eingesunkenen Grabstein völlig überwachsen hatten, erhob sich in Bälde ein Gedenkstein von edelstem schwarzem Marmor mit der einfachen Aufschrift: «Miriam Valeria».—
Und niemand lebte in Neapolis, der das zu deuten wußte.
Von allen Seiten strömten nun aus Campanien und Samnium, Bruttien und Lucanien, Apulien und Calabrien Abgesandte der Städte nach Neapolis, den Gotenkönig als Befreier in ihre Mauern zu laden. Auch das wichtige und starke Benevent ergab sich und die benachbarten Festen Asculum, Canusia und Acheruntia. Nach Tausenden zählten die Fälle, in welchen in diesen Landschaften die Colonen in die Ländereien ihrer gefallenen, entflohenen, nach Byzanz oder Rom gewanderten Herren eingewiesen wurden. Außer Rom und Ravenna waren von großen Plätzen jetzt nur noch Florentia unter Justinus, Spoletium unter Bonus und Herodianus, Perusia unter dem Hunnen Uldugant in den Händen der Byzantiner.
In wenigen Tagen hatte der seekundige König, durch viele Italier aus dem Süden der Halbinsel verstärkt, seine eroberte Flotte neu bemannt und führte sie, in vollem Schmuck der Segel und Flaggen, aus dem Hafen, indes die Reiterei seines Heeres auf dem Landweg (der Via appia) gegen Norden zog.
Rom war das Ziel der Schiffe und der Reiter: während Teja, nachdem er alles Land zwischen Ravenna und dem Tiber gewonnen—die festen Burgen Petra und Cäsena fielen ohne Schwertstreich—oder unterworfen und gesichert: die Ämilia und beide Tuscien (das annonarische und suburbikarische), auf der Via flaminia mit einem dritten Gotenheer gegen die Stadt des Cethegus heranzog.
Der Präfekt erkannte: nun ward es grimmiger Ernst. Und grimmig, gleich dem in seiner Höhle angegriffenen Drachen, wollte er sich wehren. Mit stolz zufriedenem Blick maß er die Schanzen und Wälle, sein ungeheures Werk: und zu den Waffenfreunden, welche die Annäherung der Goten beunruhigte, sprach er:
«Getrost! An diesen Mauern sollen sie zum zweitenmal zerschellen.»
Aber nicht so ruhig wie seine Reden und Mienen war im tiefsten Innern sein Geist. Nicht, daß er sein Tun jemals bereut, seinen Gedanken je als unausführbar erkannt hätte. Aber daß sein Werk, nach wiederholtem Scheitern der Vollendung so nahe geführt, nun nach Totilas Erhebung abermals so fern vom Ziele schien—diese Empfindung wirkte auf die eiserne Kraft auch des Cethegus. «Der Tropfen höhlt zuletzt den Fels!» antwortete er, als ihn Licinius einmal fragte, weshalb er so finster sehe. «Und dann—ich kann nicht mehr schlafen wie ehedem.»
«Seit wann?»
«Seit—Totila! Dieser blonde Königsknabe hat mir den Schlummer gestohlen.» So sicher und überlegen sich der Präfekt gegenüber all seinen Feinden und Gegnern gefühlt hatte—die leuchtende, offene Natur, die Siegfried-Natur dieses Jünglings und ihre spielend gewonnenen Erfolge reizten seinen Haß so schwer, daß ihm manchmal in heißer Leidenschaft die überlegene Eisesruhe schmolz—während Totila dem Allgefürchteten mit einer Siegeszuversicht entgegentrat, als könne es ihm gar nicht fehlen.
«Er hat Glück, dieser Milchbart!» knirschte Cethegus, als er die spielende Eroberung von Neapolis erfuhr. «Glück wie Achilleus und Alexandros. Aber vortrefflicherweise werden sie nicht alt, diese ewigen Jünglinge! Das weiche Gold dieser Seelen zermürbt:—wir Klumpen von gediegenem Erz halten länger. Ich habe dieses Schwärmers Rosen und Lorbeern gesehen: mir ist, bald seh' ich auch seine Zypressen. Es kann nicht sein, daß ich dieser mädchenhaften Seele erliege. Das Glück trug ihn rasch und schwindelhoch empor. Plötzlich und schwindelhoch wird er auch fallen. Trägt es ihn noch über die Zinnen meines Roms?—Fliege nur, junger Ikarus, mühelos, im wärmsten Sonnenschein. Ich klimme, Schritt für Schritt, durch Blut und Kampf, empor im Schatten.—Aber hoch aufatmend werd' ich oben stehn, wann dir der verräterische Sonnenkuß des Glücks das Wachs in den kühnen Fittichen geschmolzen hat. Wie ein fallender Stern wirst du unter mir erlöschen.»
Allein es hatte nicht das Ansehen, als ob dies schon bald geschehen solle.
Sehnlich erwartete Cethegus das Eintreffen einer starken Flotte aus Ravenna, die ihm den Rest seiner Söldner und alles, was selbst von Legionären und von dem Heere des Demetrius entbehrlich war, mit reichen Mundvorräten zuführen sollte. Waren diese Verstärkungen eingetroffen, konnte er das murrende letzte Aufgebot der Römer von seinem unterträglichen Dienst entlassen. Seit Wochen hatte er die immer drohender verbitterten Einwohner auf diese Flotte vertröstet. Endlich war sie von Ostia her durch einen vorausgeschickten Schnellsegler angemeldet worden. Cethegus ließ die Nachricht von Herolden unter Tubaschall durch alle Straßen rufen, ließ verkünden: an den nächsten Iden des Oktober würden achttausend Bürger von den Wällen an ihren Herd entlassen: er ließ doppelte Weinrationen auf den Mauern verteilen.
An den Iden des Oktober deckte dichter Nebel Ostia und das Meer.
Am Tage nach den Iden flog ein kleines Segelboot von Ostia nach Portus, in den Hafen von Rom. Seine zitternde Bemannung, Legionäre aus Ravenna, klagten: König Totila habe mit der Flotte aus Neapolis die ravennatischen Trieren im Schutz dichten Nebels überfallen, von den achtzig Schiffen zwanzig verbrannt oder in den Grund gebohrt, sechzig aber mit allem Seevolk und Mundvorrat genommen.
Cethegus wollte es nicht glauben. Er sprang an Bord seines eigenen Schnellruderes «Sagitta» und flog den Tiber hinab. Aber mit Not entkam er den Schiffen des Königs, die bereits den Hafen Portus sperrten und kleine Kreuzer tiberaufwärts schickten.
In höchster Eile ließ nun der Präfekt einen doppelten Stromriegel, den ersten aus gekappten Masten, den zweiten aus Eisenketten, einen Pfeilschuß weiter oben, wieder quer über den Tiber werfen, wie ihn Belisar bei der ersten Belagerung hatte fertigen lassen. Den Raum zwischen dem unteren, dem Balken-, und dem oberen, dem Eisenriegel, füllte er mit einer großen Zahl kleiner Boote aus.
Schwer empfand Cethegus die volle Wucht jenes Schlages. Nicht nur waren seine heiß ersehnten Verstärkungen in Feindeshand gefallen: nicht nur mußte er den ihn verfluchenden Römern, statt der versprochenen Erleichterung, noch schwerere Lasten auflegen—denn auch die Flußseite mußte nun gegen die unablässigen Durchbruchsversuche der gotischen Schiffe gedeckt werden—mit leisem Grauen sah Cethegus unaufhaltsam näher und näher dringen den furchtbaren Feind:—den Hunger.
Die Wasserstraße, auf welcher er, wie früher Belisar, alle Vorräte reichlich zugeführt hatte, war gesperrt. Italien hatte keine dritte Flotte mehr. Die von Neapolis und die von Ravenna sperrte unter gotischen Wimpeln Rom von der See ab.
Die letzten Reiter aber, die Marcus Licinius auf Kundschaft und Fouragierung die flaminische Straße hinauf geschickt, jagten erschrocken zurück und meldeten: ein starkes Gotenheer, geführt von dem fürchterlichen Teja, rückte im Eilmarsch heran. Seine Vorhut stehe schon in Reate. Tags darauf war Rom auch von der letzten, der Nordseite her, eingeschlossen und beschränkt auf seine eigenen Kräfte: seine Bürger. Diese aber waren schwach genug, so stark auch die Mauern des Präfekten und sein Mut. Noch durch Wochen, noch durch Monate hielt des Cethegus eiserner Zwang die Verzagenden gegen ihren Willen aufrecht. Aber schon erwartete man nicht durch Sturm, durch Hunger den baldigen Fall. Da trat ein allen unerwartetes Ereignis ein, das die Hoffnungen der Belagerten neu belebte und des jungen Königs Genius und Glück auf harte Probe stellte: auf dem Kriegsschauplatz erschien nochmal—Belisarius.
Als in dem goldenen Palaste der Cäsaren zu Byzanz nacheinander die schlimmen Nachrichten eintrafen von den Niederlagen an der Padusbrücke und bei Mucella, von der neuen Belagerung Roms, von dem Verlust von Neapolis und des größten Teils von Italien—da wurde Kaiser Justinian, der das Abendland schon wieder mit dem Osten vereinigt gesehen, furchtbar aus seinen Träumen geweckt.
Leicht war es damals den Freunden Belisars, den Beweis zu führen: die Abberufung dieses Helden sei der Grund aller Mißerfolge. Klar lag es vor Augen: solang Belisarius in Italien—Sieg auf Sieg, sowie er den Rücken wandte—Schlag auf Schlag des Unheils. Die byzantinischen Heerführer in Italien selbst erkannten nun offen an, daß sie Belisar zu ersetzen nicht vermochten. «Ich vermag nicht», schrieb Demetrius aus Ravenna, «vor Totila das offene Feld zu halten, kaum diese Festung der Sümpfe zu behaupten. Neapolis ist gefallen. Rom kann fallen jeden Tag. Sende uns wieder den löwenkühnen Mann, den wir in eitler Überhebung ersetzen zu können wähnten, der Vandalen und Goten Besieger.»
Und Belisar, obzwar er sich hoch verschworen, nie wieder diesem Kaiser des Undanks zu dienen, hatte alle Unbill Augenblicks vergessen, als Justinianus ihn wieder lächelnd anblickte. Und als er ihn vollends—nach dem Fall von Neapolis—umarmte und «sein treues Schwert» nannte—nie hatte er in Wahrheit an seine Untreue geglaubt, nur seine königgleiche Stellung nicht dulden wollen—da war Belisarius von Antonina und Prokop nicht mehr zurückzuhalten.
Da aber der Kaiser die Kosten einer zweiten Unternehmung gegen Italien scheute neben denen des Perserkrieges, den Narses glücklich, aber kostspielig, in Asien führte, so gerieten Geldgeiz und Ehrgeiz in seiner Brust in einen Widerstreit, der vielleicht länger gedauert hätte, als der Widerstand von Rom und von Ravenna, wenn ihm nicht Prinz Germanus und Belisar durch einen gemeinschaftlichen Vorschlag einen Ausweg gewiesen.
Den edlen Prinzen trug die Sehnsucht, Ravenna und das Grab Mataswinthens zu besuchen und die Unvergessene an dem rohen Barbarenvolk zu rächen. Denn Cethegus hatte ihm als Erklärung des tragischen Ausgangs der Unvergleichlichen angegeben: die erzwungene Ehe mit Witichis habe ihren Geist zerrüttet.
Belisar aber fand es unerträglich, durch Totilas Erfolge all seine eigenen Siege in Frage gestellt zu sehen. Denn, war ein Volk wirklich überwunden—so fragten seine Neider am Hofe—, das binnen eines Jahres sich so glänzend wieder erhoben hatte? Er hatte sein Wort gegeben, die Goten vernichten zu können:—das wollte er einlösen.
So machten Germanus und Belisar dem Kaiser den Vorschlag, Italien auf ihre Kosten für ihn erobern zu wollen. Der Prinz bot sein ganzes Vermögen zur Ausrüstung einer Flotte, Belisar alle seine neu verstärkten Leibwächter und Lanzenträger.
«Das ist ein Vorschlag nach dem Herzen Justinians!» rief Prokop, als Belisar ihm davon sprach. «Keinen Solidus aus seiner Tasche und vielleicht eine Provinz nebst Lorbeeren für die Erde und gottgefällige Ketzervertilgung für Theodora und den Himmel, ohne Auslagen! Sei gewiß: er nimmt es an und gibt euch seinen väterlichen Segen. Sonst aber nichts. Ich weiß es: du bist so wenig zu halten wie Balan, dein Schecke, wenn die Trompete bläst. Ich aber werde nicht zusehen, wie du kläglich erliegst.»
«Erliegen? Weshalb, du Rabe des Unheils?»
«Diesmal hast du die Goten und Italien gegen dich. Du hast jene aber nicht vernichtet, da du Italien für dich hattest.»
Aber Belisar schalt seine Feigheit und ging alsbald mit Germanus in See. Der Kaiser gab ihnen wirklich nichts mit als seinen Segen und den großen Zeh des heiligen Mazaspes.—
Hoch auf atmeten die Byzantiner in Italien bei der Nachricht, daß eine kaiserliche Flotte bei Salona in Dalmatien gelandet sei. Und selbst Cethegus, zu welchem Kundschafter die Botschaft getragen, seufzte: «Besser Belisar in Rom als Totila.»
Auch der Gotenkönig war schwer besorgt. Er mußte vor allem die Stärke von Belisars Heer zu erkunden suchen, um danach seine Beschlüsse einzurichten,—etwa gar die Einschließung Roms aufzugeben, um dem mächtigen Entsatzheer entgegenzuziehen.
Von Salona segelte Belisar nach Pola, wo er Schiffe und Mannschaft musterte. Dort kamen zu ihm zwei Männer, die sich als herulische Söldner zu erkennen gaben, also gotisch, aber auch sehr gut lateinisch sprachen, und erklärten: sie seien Boten von Bonus, dem einen Befehlshaber von Spoletium. Glücklich hätten sie sich durch die gotischen Linien geschlichen, und sie drängten den Feldherrn zu raschem Entsatz. Sie baten um genaue Auskunft über seine Stärke, die Zahl seiner Segel, Reiter und Fußtruppen, um durch genaue Nachrichten den sinkenden Mut der Belagerten zu heben.
«Ja, meine Freunde», sprach Belisar, «ihr müßt schon einiges hinzufügen in eurem Bericht. Denn die Wahrheit ist, daß mich der Kaiser ganz auf eigene Kraft angewiesen hat.» Einen Tag lang zeigte Belisar den beiden Boten Flotte, Lager und Heer. In der Nacht darauf waren sie verschwunden.
Es waren Thorismut und Aligern gewesen, die König Totila, der sie ausgesendet hatte, getreulich die gewünschte Auskunft hinterbrachten. Das war übel von Anfang an. Und auch der ganze Verlauf des Feldzuges entsprach nicht dem Ruhm des tapfern Feldherrn. Zwar gelang es, in die Hafenstadt von Ravenna einzulaufen und diese Stadt mit neuen Vorräten zu versehen.
Aber noch am Tage der Ankunft brach, in einem Anfall seines alten Leidens, Prinz Germanus an dem Sarkophage Mataswinthens zusammen. In den Gruftgewölben des Palastes, neben ihres jugendlichen Bruders, neben König Athalarichs Leiche, hatte man sie beigesetzt. Germanus starb: und er ward nach seinem letzten Wunsche bestattet an der schönen, nie erreichten Geliebten Seite.
Aber in einer kleinen unscheinbaren Nische der Gruft ruhte noch ein Herz, das treu für die Königin Schönhaar geschlagen. Aspa, die Numiderin, hatte die geliebte Herrin nicht überlebt. «In meiner Heimat», hatte sie gesagt, «springen die Dienerinnen der Sonnengöttin oft freiwillig in den Scheiterhaufen, drin die Gottheit versinkt. Auch Aspas Sonnengöttin, die schöne, schimmernde, gütevolle ist versunken. Aspa lebt nicht verlassen und in kaltem Dunkel fort. Aspa folgt ihrer Sonne nach.» Hügelhoch hatte sie stark duftende Blumen in der Gebieterin Totengemach—höher noch, als da derselbe kleine Raum zu ihrem Brautgemach gedient hatte—gehäuft und unbekannten Räucherstoff aus afrikanischem Harz entzündet, dessen betäubender Geruch die andern Sklavinnen verscheuchte. Sie aber blieb die Nacht über in dem engen Totengemach. Am andern Morgen stahl sich Syphax, gelockt durch den alt vertrauten, aber gefährlichen Duft, in Erinnerung heimischer Opferbräuche, leis heran. Er drang endlich in das wie ein Grab schweigende Gemach.—Zu den Füßen Mataswinthens, das Haupt unter Blumen vergraben, fand er ihre Antilope tot. «Sie starb», sprach er zu Cethegus, «ihrer Göttin nach. Nun hab' ich nur noch dich auf Erden.»
Nach der Bestattung des Germanus brach Belisar mit der ganzen Flotte von Ravenna auf.
Aber gleich das nächste Unternehmen, ein Versuch, Pisaurum zu überfallen, scheiterte mit blutigen Verlusten.
Vielmehr ließ König Totila, nun über die geringe Truppenzahl Belisars unterrichtet, fast unter dessen Augen, durch kühne entsendete Streifscharen unter Wisand zu Lande, die einige Segel unterstützten, an eben jenem Küstenstrich Firmum wegnehmen. Die Byzantiner Herodian und Bonus übergaben an Graf Grippa das wichtige Spoletium, nach Ablauf der Frist von dreißig Tagen, binnen welcher sie noch Entsatz von Belisar gehofft. In Assisium befehligte Sisifried, ein gotischer Überläufer, der in den Tagen von Witichis' Unstern sich Belisar angeschlossen hatte. Der Mann wußte, was ihm bevorstand, wenn er in Hildebrands Hände fiel, der ihn im Person belagerte:—der grimme Haß hatte den Alten von der Einschließung Ravennas zu dieser Aufgabe herangelockt. Der Gote verteidigte die Stadt hartnäckig. Aber als ihm bei einem Ausfall die Steinaxt des alten Waffenmeisters das Haupt zerschmettert hatte, zwangen die Bürger der Stadt die thrakische Besatzung zur Ergebung. Viele vornehme Italier, Glieder des alten Katakombenbundes, dreihundert illyrische Reiter und erlesene Leibwächter Belisars hatten die Besatzung gebildet. Grippa führte sie gefangen dem König zu.
Gleich darauf fiel Placentia, die letzte Stadt der Ämilia, die noch die sarazenische Besatzung für den Kaiser gehalten hatte: sie ergab sich dem Grafen Markja, der das kleine Belagerungsheer befehligte. In Bruttien aber ergab sich das feste Ruscia, der wichtige Hafenort für Thurii, dem kühnen Aligern.
Belisar verzweifelte nun daran, auf dem Landweg gegen Rom vorzudringen. Er versuchte jetzt, von der steigenden Not der Stadt vernehmend, ohne weiteren Verzug, Rom von der Seeseite her Entsatz zu bringen und die Einschließung durch die Gotenschiffe zu sprengen.
Aber auf der Höhe von Hydrunt, bei Umseglung der Südspitze Calabriens, zerstreute ein furchtbarer Sturm seine Schiffe: er selbst wurde mit einigen Trieren tief südlich, bis nach Sizilien, verschlagen. Und der größte Teil seiner Segel, der in der Bucht bei Croton Zuflucht gesucht, wurde hier von einem gotischen Geschwader, das der König von Rom entgegengeschickt und bei Squillacium in Hinterhalt gelegt hatte, überfallen und genommen—eine sehr bedeutende Verstärkung der gotischen Seemacht, die, wie wir sehen werden, dadurch in den Stand gesetzt wurde, bald die Byzantiner in ihren Inseln und Küstenstädten angreifend aufzusuchen.
Seit diesem Schlag war die von Anfang zu geringe Streitkraft Belisars völlig ohnmächtig. Alle Feldherrnkunst und Kühnheit vermochte nicht, die fehlenden Schiffe, Krieger, Rosse zu ersetzen. Die Hoffnung, daß sich Italien, wie bei dem ersten Feldzug, dem Feldherrn des Kaisers zuwenden werde, schlug völlig fehl. So mißlang das Unternehmen vollständig, wie uns Prokop in schonungslosen Worten überliefert hat. Auf die Bitten um Verstärkung antwortete der Kaiser gar nicht. Auf die dann dringend wiederholte Bitte Antoninens um Erlaubnis zur Rückkehr erwiderte die Kaiserin nur mit dem höhnischen Bescheid: man wage nicht, zum zweitenmal durch Abberufung den Helden in dem Laufe seiner Siege zu unterbrechen. So verbrachte Belisar bei Sizilien eine qualvolle Zeit der Tat- und Ratlosigkeit.
Inzwischen aber stieg in dem belagerten Rom die Not und die Erschöpfung der Bürger auf den höchsten Grad.
Der Hunger lichtete die ohnehin so dünne Besatzung der weiten Wälle. Umsonst tat der Präfekt sein Äußerstes. Umsonst griff er zu allen Mitteln, bald der Überredung, bald der Gewalt. Umsonst verschwendete er sein Gold, neue Lebensmittel in die Stadt zu schaffen. Denn bis auf die letzten Körner fast waren die Getreidevorräte aufgezehrt, die er aus Sizilien hatte kommen und auf dem Kapitole bergen lassen.
Unerhörte Belohnungen verhieß er jedem Schiff, dem es gelänge, sich mit Vorräten durch die Flotte des Königs zu stehlen, jedem Söldner, der es wagte, sich durch die Tore und die Zelte der Belagerer hinaus- und mit Mundvorrat zurückzuschleichen. Die Wachsamkeit Totilas war nicht zu täuschen. Anfangs hatten einzelne geldgierige Waghälse des Präfekten Lohn zur Nacht hinausgelockt. Als aber Graf Teja jeden Morgen darauf über die Wälle beim flaminischen Tor ihre Köpfe schleudern ließ, verging auch den Begehrlichsten die Lust.
Teuer wurde das Aas der gefallenen Maultiere verkauft. Um das Unkraut und die Brennesseln, die sie gierig aus den Schutthaufen rupften, schlugen sich die hungernden Weiber. Der Hunger hatte längst gelehrt, das Uneßbare gierig zu verschlingen. Und nicht mehr zu zählen waren die Überläufer, die aus den Häusern, von den Mauern zu den Goten eilten. Teja zwar wollte diese mit Speerrechen zurückgetrieben wissen in die Stadt, sie desto früher zum Fall zu bringen. Totila aber befahl, sie alle aufzunehmen, zu speisen und nur darüber fürsorglich zu wachen, daß sie nicht durch plötzliche, maßlose Befriedigung des maßlosen Heißhungers, wie anfangs oft geschehen war, dem Tode verfielen.
Cethegus verbrachte nun jede Nacht auf den Wällen.
In wechselnden Stunden beging er selbst, mit Speer und Schild, musternd die Wachen, auch wohl eine Schildwache ablösend, der Schlaf und Hunger den Lanzenschaft aus der Hand zu lösen drohten. Solch Beispiel wirkte dann freilich wieder eine Weile ermannend auf die Tüchtigen: begeistert standen auch jetzt die Licinier, Piso und Salvius Julianus zu dem Präfekten und die blind ergebenen Isaurier.
Nicht aber alle Römer: so nicht Balbus, der Schlemmer.
«Nein, Piso», sagte dieser einst, «ich halte es nicht länger mehr aus. Es ist nicht in Menschenart. Wenigstens nicht in meiner. Heiliger Lucullus! Wer hätte das je von mir geglaubt! Ich gab neulich meinen allerletzten, größten Diamanten für einen halben Steinmarder hin»
«Ich weiß die Zeit», lächelte Piso, «da du den Koch in Eisen schmieden ließest, hatte er den Meerkrebs eine Minute zu lang sieden lassen.»
«O Meerkrebs! Bei der Barmherzigkeit des blassen Heilands! Wie kannst du dies Wort, dies Bild heraufbeschwören! Meine ganze unsterbliche Seele geb' ich für eine Schere, ja für den Schweif. Und niemals ausschlafen! Weckt nicht der Hunger, weckt das Wächterhorn.»
«Sieh den Präfekten an! Seit vierzehn Tagen hat er nicht vierzehn Stunden geschlafen. Er liegt auf dem harten Schild und trinkt Regenwasser aus dem Helm.»
«Der Präfekt! Der braucht nicht zu essen. Er zehrt von seinem Stolz, wie der Bär von seinem Fett, und saugt an seiner Galle. Ist ja nichts an ihm als Sehnen und Muskeln, Stolz und Haß! Ich aber, ach, ich hatte so lieblich weißes Fett angehäuft, daß mich im Schlaf die Mäuschen anbissen: sie hielten mich für einen spanischen Mastschinken. Weißt du das Neueste? Im Gotenlager ist heute eine ganze Herde feister Rinder eingetrieben worden—lauter apulische: Lieblinge der Götter und Menschen!»
Am andern Morgen früh kam Piso mit Salvius Julianus, den Präfekten zu wecken, der auf dem Wall an der Porta portuensis lag, nahe dem gefährdetsten Punkt, dem Stromriegel. «Vergib, ich störe dich im seltnen Schlaf...»
«Ich schlief nicht. Ich wachte. Melde, Tribun.»
«Balbus ist mit zwanzig Bürgern heute nacht von seinem Posten entflohen. An Seilen haben sie sich herabgelassen an der Porta latina. Dort brüllten die ganze Nacht die apulischen Rinder. Ihr Ruf war, scheint's, unwiderstehlich.»
Aber das Lächeln verging dem Satirenschreiber, als ihn der Blick des Cethegus traf. «Ein Kreuz, dreißig Fuß hoch, wird errichtet vor dem Hause des Balbus an der Via sacra. Jeder Überläufer, der wieder in unsre Hand fällt, wird darangeschlagen.»
«Feldherr—Kaiser Constantinus hat die Kreuzigungsstrafe abgeschafft, zu Ehren des Heilands», warnte Salvius Julianus.
«So führ' ich sie wieder ein, zu Ehren Roms. Jener Kaiser hielt wohl nicht für möglich, daß ein römischer Ritter und Tribun die Stadt Rom um einen Braten verraten werde.»
«Aber noch mehr! Ich kann die Turmwache nicht mehr bestellen an der Porta pinciana. Von den sechzehn Legionären sind neun hungertot oder hungerkrank.»
«Das gleiche fast meldet Marcus Licinius von der Porta tiburtina», fügte Julianus bei. «Wer soll wehren der überallher drohenden Gefahr?»
«Ich! Und der Mut der Römer. Geh! Laß durch Herolde alle Bürger und alles, was noch in den Häusern ist, berufen an das Forum romanum.»
«Herr, es sind nur noch Weiber, Kinder und Kranke...»
«Gehorche, Tribun!»
Und finstern Blickes stieg der Präfekt vom Wall, schwang sich auf Pluto, sein edles, schwarzes, spanisches Roß, und zog langsam, von einer Schar berittener Isaurier gefolgt, überall die Wachsamkeit der Posten, die Zahl der Truppen prüfend, auf den weitesten Wegen durch einen großen Teil der Stadt: zugleich dadurch den Herolden und den Bürgern Zeit verstattend, zu rufen und zu folgen.
So ritt er auf langem Wege das rechte Tiberufer aufwärts. Aus den Häusern schlich nur spärlich zerlumptes Volk, die Reiter anstarrend in dumpfer Verzweiflung. An der Brücke des Cestius erst wurden die Haufen dichter. Cethegus hielt sein Pferd an, die dort ausgestellten Wachen zu mustern.
Da eilte plötzlich aus der Tür eines niedrigen Hauses ein Weib, mit fliegenden Haaren, ein Kind auf dem Arm. Ein älteres zerrte an den Lumpen ihres Gewandes. «Brot! Brot!» schrie sie. «Ja, werden Steine zu Brot durch Tränen? O nein! Sie bleiben hart! Hart wie—ha, hart wie jener da! Seht, Kinder: das ist der Präfekt von Rom. Der dort, auf dem schwarzen, Roß, mit dem purpurnen Helmbusch, mit dem furchtbaren Blick! Aber ich fürchte ihn nicht mehr. Seht, Kinder: der hat euren Vater auf die Wälle gezwungen, Tag und Nacht, bis er umfiel, tot. Fluch dir, Präfekt von Rom!» Und sie ballte die Fäuste gegen den unbeweglich haltenden Reiter.
«Brot, Mutter! Gib uns zu essen!» heulten die beiden Kinder.
«Zu essen hab' ich nicht für euch, aber zu trinken vollauf! Hier!» schrie das Weib, umklammerte das ältere Kind mit der Rechten, drückte das kleinere mit der Linken fester an die Brust und schwang sich mit beiden Kindern über das Geländer in die Flut. Ein Schrei des Entsetzens, gefolgt von Flüchen, lief durch die Menge.
«Sie war wahnsinnig!» sprach der Präfekt mit lauter Stimme und ritt weiter.
«Nein, sie war die klügste von uns allen!» antwortete eine Stimme aus der Menge.
«Schweigt! Ihr Legionäre, laßt die Tuba schmettern! Vorwärts! Auf das Forum!» befahl Cethegus, und sausend sprengte die Reiterschar davon.
Und über die fabricische Brücke, durch das carmentalische Tor gelangte der Präfekt an den Fuß des kapitolinischen Hügels auf das Forum romanum.
Leer sah der weite Raum aus: nicht gefüllt durch die paar tausend Menschen, die in elenden Kleidern auf den Stufen der Tempel und Hallen kauerten oder sich mühsam an Speeren und Stäben aufrecht hielten.
«Was will der Präfekt?»—«Was kann er noch wollen?»—«Wir haben nichts mehr als unser Leben.»—«Gerade das will er—»—«Wißt ihr schon? Vorgestern hat sich auch Centumcellä an der Küste den Goten ergeben.»—«Ja, die Bürger haben die Isaurier des Präfekten überwältigt und die Tore geöffnet.»—«Oh, könnten wir's nachtun.»—«Bald müssen wir's tun, sonst ist es zu spät.»—«Mein Bruder fiel gestern tot um, die gekochten Brennesseln noch im Munde: er konnte sie nicht mehr verschlingen.»—«Auf dem Forum Boarium ward gestern eine Maus in Gold aufgewogen.»—«Ich bezog heimlich eine Woche gebratenes Fleisch von einem Metzger—roh wollte er's nicht liefern...—»—«Sei froh! Sie stürmen ja das Haus, wo sie Bratendunst riechen—»—«Aber vorgestern ward er zerrissen vom Volk auf der Straße. Er hatte bettelnde Kinder in sein Haus gelockt—ihr Fleisch hatte er uns verkauft.»—«Der Gotenkönig aber, wißt ihr, wie der mit seinen Kriegsgefangenen umgeht?»—«Wie ein Vater mit seinen hilflosen Kindern.»—«Die meisten treten sofort in seine Dienste.»—«Ja, aber die, welche es nicht wollen, versieht er mit Reisegeld—»—«Ja, und mit Kleidern und Schuhen und Lebensmitteln.»—«Die Wunden und Kranken werden gepflegt.»—«Und er läßt sie durch Wegkundige bis an die Küstenstädte geleiten.»—«Auch die Überfahrt ins Ostreich auf Kauffahrerschiffen hat er ihnen schon bezahlt.»
«Seht, da steigt der Präfekt von dem schwarzen Roß.»—«Wie Pluto sieht er aus.»—«Nicht Princeps senatus mehr, Princeps inferorum.»
«Seht—seinen Blick!»—«Kalt: und doch wie Flammenpfeile.»—«Ja, meine Muhme hat recht. So kann nur blicken, wer kein Herz mehr hat.»—«Das ist was Altes. Strigen und Lamien haben ihm nachts das Herz ausgefressen.»—«Was nicht gar! Es gibt gar keine Lamien. Aber den Teufel gibt es: denn der steht in der Bibel. Und er hat ein Bündnis mit ihm geschlossen. Der Numider, der dort sein schwarzes Roß am Zügel hält, ist der Bote der Hölle, der ihn überall begleitet. Keine Waffe kann dem Präfekten die Haut ritzen. Nicht Nachtwachen noch Hunger verspürt er. Aber er kann auch nie mehr lächeln. Denn er hat seine Seele der Hölle verpfändet.»—«Woher weißt du's?»—«Der Diakon von Sankt Paul hat's uns neulich alles gedeutet. Und Sünde ist es, einem solchen länger zu dienen. Hat er doch auch unsern Bischof Silverius dem Kaiser verraten und in Ketten übers Meer geschickt.»
«Und hat er doch neulich sechzig Priester, rechtgläubige und arianische, als des Verrats verdächtig aus der Stadt gewiesen.»—«Das ist wahr.»—«Er muß aber auch dem Teufel gelobt haben, alle Qualen über Rom und die Römer zu bringen.»—«Aber wir wollen's nicht mehr dulden.»—«Wir sind frei, er hat's uns oft gesagt. Ich will ihn fragen, mit welchem Recht...»
Aber mitten im Wort verstummte der tapfere Redner:—ein Blick des Präfekten hatte ihn getroffen, der im Emporsteigen zur Rednerbühne die kleine murrende Gruppe streifte.
«Quiriten», hob er an, «ich rufe euch alle auf, Legionäre zu werden. Hunger und—schmählich zu sagen von römischen Männern!—Verrat lichten die Reihen unsrer Wachen.—Hört ihr die Hammerschläge? Ein Kreuz wird gezimmert für die Überläufer.—Noch größere Opfer fordert Rom von den Römern. Denn ihr habt keine Wahl. Bürger anderer Städte mochten schwanken zwischen Übergabe und Untergang. Wir, erwachsen im Schatten des Kapitols, haben diese Wahl nicht. Hier gehn die Schauer von mehr als tausendjährigem Heldentum. Hier kann kein feiger Gedanke laut werden. Ihr könnt nicht wieder die Barbaren ihre Rosse binden sehen an die Säulen des Trajan. Eine letzte Anstrengung gilt es. Früh reift das Heldenmark in den Knaben des Romulus und Cäsar; spät weicht die Kraft aus den tibertrinkenden Männern. Ich rufe die Knaben vom zwölften, die Männer bis zum achtzigsten Jahre auf die Wälle. Still! Murrt nicht! Ich werde meine Tribunen mit den Lanzenträgern von Haus zu Haus gehen lassen: nur um zu hindern, daß nicht allzu zarte Knaben, allzu müde Greise zu den Waffen greifen. Was murrt ihr da drüben? Weiß jemand bessern Rat der Verteidigung? Er gebe ihn: laut, von diesem Platz herab, den ich ihm dann räumen werde.»
Da ward es still an der Stelle, wohin der Blick des Präfekten geblitzt.
Aber hinter ihm erhob sich, bei denen, die sein Auge nicht bändigen konnte, grollendes Gemurmel. «Brot!»—«Übergabe!»—«Friede!»—«Brot!»
Cethegus wandte sich. «Schämt ihr euch nicht? So viel habt ihr ertragen, eures Namens würdig. Und nun, da es noch kurze Zeit gilt, auszuharren, wollt ihr erlahmen? In wenigen Tagen bringt Belisar Entsatz.»
«Das hast du uns schon siebenmal gesagt.»—«Und nach dem siebenten Male verlor Belisar fast alle Schiffe.»—«Die helfen jetzt mit, unsern Hafen sperren.»—«Du sollst uns eine Frist, ein Ende setzen dieses Elends. Denn mich erbarmt es dieses Volks.»
«Wer bist du?» fragte Cethegus den unsichtbaren Redner. «Du kannst kein Römer sein.»
«Ich bin Pelagius der Diakon, ein Christ und ein Priester des Herrn. Und ich fürchte nicht die Menschen, sondern Gott. Der König der Goten, obwohl ein Ketzer, soll versprochen haben, in allen Städten, die sich unterwerfen, die Kirchen, die seine Mitketzer, die Arianer, den Rechtgläubigen entrissen, zurückzugeben. Schon dreimal soll er Herolde an die Bürger Roms gesendet haben mit gütigsten Bedingungen—man hat sie nie zu uns sprechen lassen.»
«Schweig, Priester. Du hast kein Vaterland als den Himmel, keinen Staat als das Reich Gottes, kein Volk als die Gemeinde der Heiligen, kein Heer als die Engel. Bestelle du dein himmlisch Reich. Männern überlaß das Reich der Römer.»
«Aber der Mann Gottes hat recht.»—«Eine Frist!»—«Einen nahen Termin!»—«Bis dahin wollen wir noch ausharren.»—«Doch verläuft er ohne Entsatz—»—«Dann Übergabe!»—«Dann öffnen wir die Tore.»
Aber diesen Gedanken scheute Cethegus.
Wußte er doch, seit langen Wochen ohne alle Kunde von der Außenwelt, durchaus nicht, wann etwa Belisar vor der Tibermündung erscheinen konnte. «Wie?» rief er. «Soll ich euch eine Frist setzen, wie lang ihr noch Römer sein wollt und von wann ab Memmen und Sklaven? Die Ehre kennt keine Termine.»
«So sprichst du, weil du selbst nicht mehr an Entsatz glaubst.»
«So spreche ich, weil ich an Euch glaube.»
«Aber wir wollen es so. Wir alle. Hörst du? Du sprachst ja immer von der römischen Freiheit. Wohlan, sind wir frei oder dir verfallen, wie deine Söldner? Hörst du? Wir fordern einen Termin. Wir wollen es!»—«Wir wollen es!» wiederholte der Chor.
Da schollen, ehe Cethegus erwidern konnte, Tubarufe von der Südostecke des Forums her: von der sacra Via strömten Volk und Bewaffnete gemischt heran, in ihrer Mitte zwei Reiter in fremden Waffen.
Lucius Licinius sprengte ihnen allen voraus, sprang ab und flog die Rednerbühne hinan. «Ein Herold der Goten! Ich kam zu spät, ihn wieder, wie sonst, abzuweisen. Die verhungernden Legionäre am tiburtinischen Tor ließen ihn herein.»
«Nieder mit ihm! Er darf nicht reden», sprach Cethegus, sprang die Tribüne herab und zog das Schwert.
Aber die Menge erriet ihn. Jubelnd, schützend umdrängte sie den Herold. «Friede! Heil! Brot!»—«Friede! Hört den Herold!»
«Nein, hört ihn nicht», donnerte Cethegus. «Wer ist Präfekt von Rom? Wer verteidigt diese Stadt? Ich: Cornelius Cethegus Caesarius. Und ich sage: hört ihn nicht.»
Und mit dem Schwert warf er sich vorwärts.
Aber dicht, wie ein Bienenschwarm, geballt, hemmten Weiber und Greise seinen Weg, während die Bewaffneten den Herold schützend umwogten.
«Sprich, Bote, was bringst du?» forschten sie.
«Frieden und Erlösung», rief Thorismut und schwenkte seinen weißen Stab. «Totila, der Italier und der Goten König, entbietet euch Huld und Gruß und fordert freies Geleit, euch Wichtiges zu künden und den Frieden.»
«Heil ihm!»—«Hört ihn!»—«Er soll kommen!»
Cethegus war eilig zu Pferd gestiegen und ließ seine Tubabläser die Schlachtfanfare schmettern.
Da wurde es still auf dem Forum.
«Höre, Herold: ich, der Befehlshaber dieser Stadt, verweigere das Geleit. Jeden Goten, der die Stadt betritt, werd' ich als Feind behandeln.»
Aber da erscholl tausendstimmiges Geschrei der Wut.
Ein Bürger erklomm die Rednertribüne. «Cornelius Cethegus, bist du unser Tyrann oder unser Beamter? Wir sind frei. Und oft hast du's gerühmt: das Höchste ist in Rom des römischen Volkes Majestät. Wohlan, das römische Volk befiehlt, den König zu hören. Befiehlst du das nicht, Volk von Rom?»—
«Wir wollen es!»—«Es ist Gesetz», brüllten die Quiriten. «Hast du's vernommen? Willst du dem Volk von Rom gehorchen oder trotzen?»
Cethegus stieß das Schwert in die Scheide. Thorismut sprengte davon, seinen König zu holen.
Der Präfekt winkte die jungen Tribunen an sich heran.
«Lucius Licinius», befahl er, «aufs Kapitol. Salvius Julianus, du deckst den untern, den Balkenstromriegel. Quintus Piso, du deckst den oberen, den Kettenriegel. Marcus Licinius, du hältst die Schanze, die den Aufgang vom Forum zum kapitolinischen Hügel und mein Haus beschützt. Der Rest der Söldner schart sich dicht hinter mir.»
«Was willst du, Feldherr?» fragte Lucius Licinius, ehe er davoneilte.
«Die Barbaren überfallen und verderben.»
Es waren etwa noch fünfzig Reiter und hundert Lanzenträger, die nach Entsendung der Tribunen hinter dem Präfekten hielten.
Nach kurzer banger Spannung schmetterte das gotische Heerhorn die heilige Straße herauf.
Und von dorther bogen auf das Forum ein Thorismut und sechs Hornbläser, Wisand, der Bandalarius, mit der blauen Königsfahne der Goten, der König zwischen Herzog Guntharis und Graf Teja und noch etwa zehn Heerführer und Reiter, fast alle ohne Waffen: nur Teja zeigte deutlich das breite, gefürchtete Beil.
Als eben der Zug sich aus dem Lager der Goten in Bewegung gesetzt hatte, durchs metronische Tor in die Stadt zu reiten, fühlte sich Herzog Guntharis am Mantel gefaßt: er sah neben seinem Pferd einen Knaben oder Jüngling mit kurz-krausem, goldbraunem Haar und blauen Augen und einen Hirtenstock in der Hand.
«Bist du der König? Nein, du bist es nicht. Und jener dort? Das ist der tapfere Teja, der schwarze Graf, wie ihn die Lieder nennen.»
«Was willst du, Bursche, von dem König?»
«Ich will für ihn fechten unter seinen Heerleuten.»
«Du bist noch zu jung und zart. Geh und komm nach zwei Sommern wieder: und hüte derweilen die Ziegen.»
«Ich bin noch jung: aber nicht mehr schwach. Und Ziegen hab' ich mir genug gehütet. Ha, ich seh's: das ist der König.»
Und er trat vor Totila, neigte sich zierlich und sprach: «Mit Gunst, Herr König.» Und er langte nach des Pferdes Zügel, es zu führen: als müßte das alles so sein. Und der König sah mit Wohlgefallen auf ihn herab und lächelte ihm zu. Und der Knabe führte sein Pferd am Zaum.
Guntharis aber sprach vor sich hin: «Dieses Knaben Antlitz habe ich schon gesehen. Nein, er gleicht ihm nur,—: doch solche Ähnlichkeit sah ich noch nie: und wie adelig des jungen Hirten Haltung!»
«Heil König Totila! Frieden und Heil», jauchzte dem Gotenkönig das Volk entgegen.
Der junge Zügelführer aber sah empor in des Königs schimmervolles Antlitz und sang leise, doch mit silbertöniger Stimme, zu ihm hinauf:
«Zittre und zage,
Zäher Cethegus:
Nicht taugt dir die Tücke!
Es trümmert den Trotz dir
Teja, der Tapfere:
Und taghell empor taucht,
Wie Maiglanz und Morgen
Aus Nacht und aus Nebel,
Der leuchtende Liebling
Des Himmelsherrn:
Der schimmernd schöne,
Der kühne König.
Ihm öffnen sich alle
Die Türme, die Tore,
Die Hallen und Herzen:
Ihm weicht, überwunden,
Wut, Winter und Weh.»
Auf den Wink von des Königs Hand trat Stille ein.
Aber diesen erwarteten Augenblick nutzte Cethegus.
Er trieb seinen Rappen vorwärts in die Volksmenge und rief: «Was willst du, Gote, in dieser meiner Stadt?»
Nach einem lodernden Blick wandte sich Totila von ihm ab: «Mit ihm red' ich nur mehr mit dem Schwert, dem sechsfachen Lügner, dem Mörder! Zu dir sprech' ich, unseliges, betörtes Volk von Rom. Der Schmerz um euch zerreißt mein Herz. Ich kam, euer Elend zu enden. Ohne Waffen bin ich gekommen. Denn besser als Schwert und Schild schützt mich des Römervolkes Ehre.»
Er hielt inne. Cethegus unterbrach ihn nicht mehr.
«Quiriten, wohl habt ihr selbst erkannt: längst konnt' ich mit meinen Tausenden euere Mauern stürmen.
Denn ihr habt nur noch Steine, keine Männer mehr darauf. Aber fiel Rom durch Sturm, ging Rom in Flammen auf. Und ich gesteh's: lieber will ich niemals Rom betreten als Rom zerstören. Ich will euch nicht vorhalten, wie ihr Theoderichs und der Goten Güte vergolten. Habt ihr die Tage vergessen, da ihr dankbar Münzen schlugt mit der Umschrift: ‹Roma felix›? Wahrlich, ihr seid genug gestraft. Schwerer gestraft durch Hunger und Pest und Byzanz und jenen Dämon, als euch jemals unsere strengste Strafe getroffen hätte. Mehr als achttausend Männer von euch, Weiber und Kinder ungezählt, sind erlegen. Eure verödeten Häuser stürzen ein. Gierig rafft ihr das Gras, das in euren Tempeln wächst. Hohläugig schleicht durch eure Gassen die Verzweiflung.
Menschenfleisch, der eignen Kinder Fleisch, haben hungernde Mütter, römische Mütter verspeist. Und bis heute konnte man euren Widerstand beklagen, aber bewundern. Von heut' ab ist es Wahnsinn. Eure letzte Hoffnung war Belisar. Wohlan: Belisar ist heimgefahren von Sizilien nach Byzanz. Er gibt euch auf.»
Cethegus ließ die Trompeten schmettern, das Geheul des Volkes zu übertönen. Lang vergeblich. Endlich drangen die ehernen Tubastimmen durch. Als es stiller ward, rief der Präfekt: «Gelogen! Glaubt nicht so plumper Lüge!»
«Haben euch je die Goten, hab' ich euch belogen, ihr Römer? Aber nur euren eignen Augen und Ohren sollt ihr glauben. Vorwärts mit dir, Mann, nun sprich. Kennt ihr ihn?»
Ein Byzantiner, in reicher Rüstung, ward von den gotischen Reitern vorgeführt.
«Kanon!»—«Belisars Nauarch!»—«Wir kennen ihn!» rief die Menge.
Cethegus aber erbleichte.
«Ihr Männer von Rom», sprach der Byzantiner, «Belisar, der Magister Militum, hat mich an König Totila geschickt. Heute traf ich ein. Belisar mußte von Sizilien nach Byzanz zurück. Er hat scheidend Rom und Italien der bekannten Güte König Totilas empfohlen. Das mein Auftrag an ihn und an euch.»
«Wohlan», fiel Cethegus dröhnend ein, «und ist es so: dann ist der Tag gekommen, zu zeigen, ob ihr Römer seid oder Bastarde. Hört es und wißt es wohl! Cethegus, der Präfekt, ergibt sich und sein Rom nie, niemals den Barbaren. Oh, gedenkt der Zeiten nur noch einmal, da ich euch alles war. Da ihr meinen Namen neben Christus, von den Heiligen genannt. Wer hat euch jahrelang Arbeit, Brot und—was mehr ist—Waffen gegeben? Wer hat euch geschirmt—Belisar oder Cethegus?—als dieser Barbaren fünfzehn Myriaden vor euren Wällen lagen? Wer hat Rom mit seinem Herzblut gerettet vor König Witichis? Wohlan, zum letztenmal ruf' ich euch zum Kampf.
Hört mich, ihr Enkel des Camillus. Wie er die Gallier, die schon die Stadt gewonnen, vom Kapitol herab hinweggefegt, mit der Kraft des römischen Schwertes, so will ich diese Goten hinwegfegen. Schart euch um mich! Zum Ausfall! Und erprobt, was Römerkraft vermag, wenn sie Cethegus führt und die Verzweiflung. Wählt!»
«Ja, wählt!» rief Totila, sich hoch erhebend in den Bügeln. «Wählt zwischen sicherem Untergang und sicherer Freiheit. Folgt ihr noch einmal diesem Wahnwitzigen, kann ich euch nicht mehr schützen. Hört hier Graf Teja von Tarent zu meiner Rechten, ihr kennt ihn, denk' ich. Ich kann euch nicht länger schützen.»
«Nein», rief Teja, das mächtige Schlachtbeil erhebend, «dann keine allzu gnädige Gnade mehr, beim Gott des Hasses. Verwerft ihr diese allerletzte Gunst: kein Leben wird verschont in diesen Mauern. Ich hab's geschworen und Tausende mit mir!»
«Ich biete euch volles Vergessen eurer Schuld und will euch ein milder König sein. Fragt in Neapolis, ob ich's verstehe. Wählt zwischen mir und dem Präfekten.»
«Heil König Totila! Zum Tode den Präfekten!» scholl es einstimmig in der Runde.
Und, wie auf ein gegebenes Zeichen, warfen sich die Weiber und Kinder, mit erhobenen Händen, wie anbetend, auf die Knie vor dem König, während alle die Tausende von Bewaffneten drohend, fluchend ihre Speere und Schwerter wider den Präfekten erhoben und mancher Wurfspieß gegen ihn flog: es waren die Waffen, die er ihnen selbst geschenkt.
«Hunde sind es! Nicht Römer!» So sprach Cethegus im tiefsten Zornesdrang und riß sein Roß herum. «Aufs Kapitol!»
Und in gewaltigem Satz, hochausgreifend, sprang sein edler Rappe über die Reihe der knienden, kreischenden Frauen hinweg, durch den Hagel von Geschossen, die ihm jetzt die Römer nachschleuderten, die wenigen Beherzten niedertretend, die mit Lanzen ihm den Weg verrennen wollten.
Bald war sein roter Helmbusch verschwunden. Sausend folgten ihm seine Reiter. Die Lanzenträger wichen langsam, in guter Ordnung, manchmal wendend und die Speere fällend. So erreichten sie die hohe Schanze, die, besetzt von Marcus Licinius, den Aufgang auf das Kapitol und den Weg zu des Präfekten Hause sperrte.—
«Was zunächst? Sollen wir folgen?» fragten die Römer den König.
«Nein! Halt! Alle Tore reißt auf. Wagen mit Brot und Fleisch und Wein stehen bereit in unsern Lagern. Diese fahrt in alle Regionen der Stadt. Speiset und tränket drei Tage lang das Volk von Rom. Meine Goten überwachen euch und verhüten das Unmaß.»
«Und der Präfekt?» fragte Herzog Guntharis.
«Cethegus Cäsarius, der Ex-Präfekt von Rom, wird dem Gott der Rache nicht entgehn!» rief Totila sich wendend.
«Und nicht mir!» rief der Hirtenknabe.
«Und nicht mir!» sprach Teja, und sprengte davon.
Die meisten Regionen von Rom waren durch die Entscheidung auf dem Forum romanum in die Hand der Goten gefallen.
Was Cethegus noch besetzt hielt, war nur der Stadtteil auf dem rechten Tiberufer vom Grabmal Hadrians im Norden bis zur Porta portuensis im Süden, bei welcher über den Fluß der Riegel von Masten und dahinter der zweite von straffgespannten Ketten gezogen war.
Auf dem linken Tiberufer hatte der Präfekt nur noch den kleinen, aber beherrschenden Abschnitt westlich vom Forum romanum inne, dessen Mittelpunkt das Kapitol bildete: abgegrenzt durch Mauern und hohe Schanzen, die sich von dem Tiberufer an den Fluß des kapitolinischen Hügels und um diesen östlich her bis an das Forum Trajans im Norden erstreckten, während sie im Rücken, im Westen des Kapitols, zwischen dem Circus flaminus und dem Theater des Marcellus, jenen preisgebend, dieses noch einschließend, bis an die fabricische Brücke und die Tiberinsel reichten.
Der Rest des Tages verging den befreiten Römern in der Stadt mit jubelnden Festen bei Schmaus und Gelag. Auf den Hauptplätzen der ihm geöffneten Regionen ließ der König die achtzig vierspännigen Wagen voller Vorräte auffahren. Und um sie her lagerte sich auf den Steinen und rasch gezimmerten Bänken das hungernde Volk, Gott, den Heiligen und dem «besten König» dankend.
Der Präfekt hatte sofort die Tore, die von jenem gotisch gewordenen Teil der Stadt durch die Mauern- und Schanzenreihen in sein Rom führten, zumal die Zugänge vom Forum romanum zum Kapitol, dann die porta flumentana, carmentalis und ratumena, sorgfältig verrammeln lassen und die geringe, ihm verbliebene Mannschaft mit raschem Feldherrnblick auf die wichtigsten Punkte verteilt: war es doch ungefähr derselbe Teil von Rom, den er schon früher, unter und gegen Belisar, besetzt gehalten hatte.
«Salvius Julianus erhält noch hundert Isaurier für den Balkenriegel im Fluß! Die abasgischen Pfeilschützen eilen zu Piso an den Fluß an dem Kettenriegel. Marcus Licinius, der Rest der Schanze beim Forum.»
Aber da meldete Lucius Licinius, der Rest der Legionäre, der an der Entscheidung auf dem Forum romanum nicht hatte teilnehmen können, weil er damals in dem nun abgesperrten Teil der Stadt auf Wache stand, werde sehr schwierig.
«Ah», rief Cethegus, «der Dunst der Braten, um die ihre Vettern da unten die römische Ehre verkauft haben, steigt ihnen kitzelnd in die Nasen. Ich komme.»
Und er ritt aufs Kapitol, wo diese Legionäre, etwa fünfhundert Mann, in Reih und Glied aufgestellt in finsterer, drohender Haltung standen.
Langsam, prüfenden Auges ritt Cethegus die Front entlang. Endlich sprach er:
«Euch wollte ich den Ruhm zuwenden, die Laren und Penaten des Kapitols gegen die Barbaren zu verteidigen. Ich hörte zwar, ihr zieht die Rinderkeulen da unten vor. Aber ich will's nicht glauben von euch. Ihr werdet den Mann nicht verlassen, der euch nach Jahrhunderten wieder kämpfen und siegen gelehrt hat. Wer's mit Cethegus hält und mit dem Kapitol,—der hebe das Schwert.»
Aber keiner rührte sich.
«Der Hunger ist ein stärkrer Gott, als der kapitolinische Jupiter», sagte er verächtlich.
Da trat ein Centurio vor. «Es ist nicht das, Präfekt von Rom. Aber wir wollen nicht fechten gegen unsre Väter und Brüder, die nun auf Seite der Goten stehen.»
«Als Geiseln sollte ich euch behalten für eure Väter und Brüder. Und ihnen, wenn sie stürmen, eure Köpfe entgegenwerfen. Aber ich besorge: es hielte sie nicht auf in ihrer Begeisterung, die aus dem Magen kommt. Geht! Ihr seid nicht würdig, Rom zu retten! Auf, Licinius, mit dem Tor! Laß sie dem Kapitol den Rücken wenden und der Ehre!»
Und die Legionäre zogen ab: bis auf etwa hundert Mann, die unschlüssig stehen blieben, an ihre Speere gelehnt.
«Nun? Was wollt ihr noch hier?» rief Cethegus, dicht an sie heranreitend.
«Sterben mit dir, Präfekt von Rom!» rief einer.
Und die andern wiederholten: «Sterben mit dir!»
«Ich danke euch! Siehst du, Licinius, hundert Römer! Sind sie nicht genug, um neu ein Römerreich zu gründen? Euch geb' ich den Ehrenplatz: ihr schirmt die Schanze, die ich mit Julius Cäsars Namen geschmückt.»
Er sprang vom Pferd, warf die Zügel Syphax zu, rief seine Tribunen näher an sich heran und sprach: «Nun hört meinen Plan!»
«Du hast schon deinen Plan?»
«Ja, wir greifen an! Wie ich die Barbaren kenne, sind wir heute nacht vor jedem Angriff sicher. Sie haben eine Stadt gewonnen zu drei Vierteln. Dieser Sieg muß erst in hunderttausend Räuschen gefeiert werden, ehe sie an das letzte Viertel denken. Um Mitternacht wird das ganze Heer von goldlockigen Helden und Säufern in Jubel, Wein und Schlaf begraben sein. Und die hungrigen Quiriten da unten werden ihnen heute nicht nachstehen an Völlerei. Seht, wie sie schmausen und springen, mit Kränzen geschmückt. Und nur ein kleiner Teil der Barbaren erst ist in die Stadt gerückt. Das ist unsre Siegeshoffnung! Um Mitternacht brechen wir aus allen unsern Toren auf sie nieder—sie versehen sich keines Angriffs solcher Minderzahl—und schlachten sie im Schlaf.»
«Dein Plan ist todeskühn», sprach Lucius Licinius. «Doch wenn wir fallen—das Kapitol wird unser Leichenstein.»
«Du lernst von mir», lächelte Cethegus:—«die Worte, wie die Streiche. Mein Plan ist verzweifelt. Aber er ist der einzig mögliche. Jetzt—die Wachen sind bestellt?—gehe ich in mein Haus und schlafe zwei Stunden. Niemand wecke mich vorher. Nach zwei Stunden weckt mich.»
«Du kannst jetzt schlafen, Feldherr?»
«Ja, ich muß. Und ich hoffe: ich schlafe gut. Ich muß mich, wachend und schlafend, in mir selbst versammeln—nachdem ich das Forum romanum dem Barbarenkönig geräumt. Das war zuviel. Das heischt Erholung! Syphax, ich fragte schon gestern: ist kein Wein mehr aufzutreiben, rechts vom Tiber?»
«Ich forschte, Herr: Nur in den Tempeln eures Gottes. Aber er ist, so sagten eure Priester, bereits geweiht, bestimmt zum Wunder des Altars.»
«Das wird ihn nicht verdorben haben. Nehmt ihn den Priestern fort. Verteilt ihn unter die hundert Römer auf der Schanze des Cäsar. Es ist der einzige Dank, der mir zu spenden geblieben.»
Und langsam ritt er, gefolgt von Syphax, seinem Hause zu. Vor dem Haupteingang hielt er an: auf Syphax' Ruf erschien der Roßwärter Thrax. Cethegus sprang ab und klopfte des edeln Rappen Bug. «Der nächste Ritt wird scharf, mein Pluto, ob zum Sieg oder in die Flucht. Gebt ihm das weiße Brot, das für mich gespart ward.»
Das Pferd ward in die Ställe neben dem Hauptgebäude abgeführt. Die Marmorraufen waren leer. Pluto teilte den weiten Stall nur noch mit des Syphax Braunen. Alle andern Rosse des Präfekten waren geschlachtet und von den Söldnern verzehrt.
Durch das prachtvolle Vestibulum und Atrium schritt der Hausherr in die Bibliothek. Der alte Ostiarius und Schreibsklave Fidus, der den Speer nicht mehr tragen konnte, war der einzige Diener im Hause. Alle andern Sklaven und Freigelassenen lagen auf den Wällen:—lebend oder tot.
«Reiche mir die Rolle mit dem Cäsar Plutarchs! Und den großen, mit Amethysten besetzten Becher—freilich wird's kaum des Zaubers der Steine bedürfen—voll Wasser aus dem Springbrunnen.»
Noch weilte der Präfekt in dem Büchersaal. Den Kandelaber, mit köstlichem Nardenöl gefüllt, hatte der Alte, wie in den Tagen des Friedens, entzündet. Cethegus warf einen langen Blick auf die Büsten, Hermen, kleinen Statuen, deren dunkle Schatten das Licht scharf auf den Estrich von kostbaren Mosaiken legte.
Da prangten sie fast alle, die Helden Roms in Krieg und Frieden, in kleinen Marmorbüsten auf Sockeln und Fußgestellen mit kurzen Andeutungen der Namen. Von den mythischen Königen an durch die lange Reihe der Konsuln und Cäsaren bis auf Trajan, Hadrian und Constantin.
Eine besondere dicht gedrängte Gruppe bildeten die eigenen Ahnen der «Cethegi». Schon war das leere Postament an die Wand gefestigt, das dereinst seine Büste aufnehmen sollte, die letzte an dieser Seite des Saales.
Denn er war der letzte seines Stammes.
Aber zur Linken zeigte sich noch, zur Fortsetzung bestimmt, ein ganzer Bogengang mit leeren Nischen. Nicht Ehe, aber Adoption sollte des Cethegus Namen weiterführen in glänzende Jahrhunderte.—
Zu seinem Erstaunen sah er, an der Reihe der Büsten langsam, gedankenvoll vorüberschreitend, auf dem leeren Sockel, der dereinst seine Büste aufnehmen sollte, ein solches Brustbild heute stehen.
«Was bedeutet das?» fragte er. «Hebe die Lampe hierher, Alter. Welche Büste steht an meinem Platz?»
«Vergib, o Herr! Das Postament des einen, da oben, von den ganz alten, muß ausgebessert werden. Ich mußte es abnehmen. Und da hob ich die Büste, damit sie einstweilen nicht zu Schaden komme, auf diesen leeren Sockel.»
«Leuchte! Noch höher! Wer mag es sein?»
Und Cethegus las auf der Büste die kurzen Worte:
«Tarquinius Superbus, Tyrann von Rom, starb, wegen unerträglicher Gewalt von den Bürgern vertrieben, ferne der Stadt im Exil. Zur Warnung späterer Geschlechter.»
Cethegus selbst hatte—in seiner Jugend—diese Inschrift verfaßt und unter die Büste setzen lassen.
Rasch hob er nun den Marmorkopf herab und stellte ihn abseits nieder. «Fort mit dem Omen», sprach er.
In ernster Vertiefung trat er in das Studiergemach.
Helm, Schild und Schwert lehnte er an das Lager.
Der Sklave entzündete die auf dem Schildpatt-Tisch stehende Lampe, brachte den Becher und das verlangte Buch und ging. Cethegus ergriff die Rolle.
Aber er legte sie wieder weg.
Die Erzwingung der Ruhe versagte ihm diesmal doch. Sie war zu unnatürlich. Auf dem römischen Forum tranken die Quiriten mit den Barbaren auf das Heil des Gotenkönigs, auf den Untergang des Präfekten von Rom, des princeps Senatus! In zwei Stunden wollte er den Versuch wagen, Rom den Germanen zu entreißen. Er konnte nicht die kurze Pause mit Wiederholung einer Lebensbeschreibung ausfüllen, die er halb auswendig wußte.
Er trank heißdurstig Wasser aus dem Becher. Dann warf er sich auf das Lager. «War es ein Omen?» fragte er sich. «Aber es gibt kein Omen für den, der nicht daran glaubt. Ein Wahrzeichen nur gilt: für die Erde der Heimat zu kämpfen, sagt Homer. Freilich, Cethegus kämpft nicht nur für die Erde der Heimat. Er kämpft fast noch mehr für sich. Aber hat es nicht dieser Tag beschämend gezeigt?—Rom ist Cethegus: und Cethegus ist Rom. Nicht jene Namen-vergessenen Römer. Rom ist heute noch viel mehr Cethegus als—damals Rom Cäsar gewesen. War er nicht auch ein Tyrann im Sinne der Toren?»
Und er sprang unruhig wieder auf und trat an die Kolossalstatue des großen Ahnherrn heran.
«Göttlicher Julius, könnte ich beten:—heute würd' ich beten—beten zu dir. Hilf, vollende deines Enkels Werk! Wie schwer, wie blutig, wie hart hab' ich gerungen seit jenem Tage, da mir zuerst aus deinem Marmorhaupt der Gedanke der Erneuerung deines Rom entgegensprang: fertig, in Waffen klirrend, wie Pallas Athene aus dem Haupte des Zeus!
Wie hab' ich gekämpft mit dem Schwert und dem mehr ermüdenden Gedanken Tag und Nacht!
Und war ich siebenmal zu Boden gerungen von der Übermacht zweier Völker, hab' ich mich siebenmal wieder emporgerafft: unbezwungen und unverzagt! Vor einem Jahr schien mir das Ziel so nahe. Und jetzt, heute nacht, muß ich um die letzten Häuser Roms, um mein Haus, um mein Leben kämpfen mit diesem Knaben im blonden Haar. Wär' es denkbar? Sollt' ich erliegen müssen? Nach soviel Arbeit? Nach solchen Taten? Vor dem Glücksstern eines Jünglings? Soll es denn wirklich unmöglich sein, auch für deinen Enkel unerzwingbar, daß ein Mann sein Volk ersetze, bis er es erneuern, bis es sich selbst erneuern kann? Daß ein Mann der Barbaren- und der Griechen-Welt obsiege? Soll nicht Cethegus das Rad der Dinge erst halten und dann rückwärts rollen können? Muß ich erliegen, weil ich allein stehe, ein Feldherr ohne Heer, ein Mann ohne Volk an seiner Schulter? Soll ich weichen müssen aus deinem, aus meinem Rom? Ich kann es, ich will es nicht denken! Hat nicht auch dein Stern sich verdunkelt kurz vor Pharsalus? Und schwammst du nicht blutend, das Leben zu retten, unter hundert Pfeilen über den Nil? Und doch hast du's vollbracht. Und zogst im Triumphe wieder ein in deinem Rom. Nicht schlimmer wird es mir, deinem Enkel, ergehen! Nein, ich werde mein Rom nicht verlieren. Nicht mein Haus, nicht dies dein göttergleiches Bild, das mir oft, wie den Christen ihres Kreuzes Anblick, Trost und Hoffnung gespendet.
Und dem zum Wahrzeichen—bleibe dir anvertraut, was unter deinem Schild am sichersten geborgen:—wo auf Erden wäre Sicherheit, wenn nicht bei dir?
Es war eine Stunde der Verzagtheit, da ich diese Geheimnisse und manchen Schatz Syphax zum Vergraben in der Erde anvertrauen wollte. Geht Rom, dies Haus, dies Heiligtum mir verloren, mögen auch diese Aufzeichnungen verloren sein.
Und dann—wer wird die Geheimschrift entziffern?
Nein, wie die Briefe, das Tagebuch, sollst du mir auch diese Schätze wahren.»
Und er zog ein ziemlich großes Ledersäckchen, das er unter dem Panzer und der Tunika auf der Brust getragen, hervor. Kostbarste Perlen und edelste Edelsteine hatte er darin verborgen.
Dann rührte er an die Feder an den linken Rippen der Statue, unterhalb des Schildrandes.
Und er holte aus der schmalen Öffnung, die sich auftat, ein längliches Kästchen von Elfenbein mit kunstvoll geschnitzten Gestalten und mit goldenem Verschluß, das allerlei Aufzeichnungen in kleinen Papyrusrollen enthielt.
Er legte das Säckchen in dies Kästchen.
«Hier, großer Ahnherr: wahre mir Geheimnisse und Schätze. Bei wem sollten sie sicher sein, wenn nicht bei dir?»—
Damit schloß er wieder die Klappe, welche nun nicht durch die schmalste Fuge eine Öffnung verriet.—
«Unter deinem Schild! An deinem Herzen! Zum Pfande, daß ich dir vertraue und meinem cäsarischen Glück.—Daß ich nicht von dir, Rom, abzudrängen bin.—Wenigstens nicht auf die Dauer! Müßte ich selbst weichen,—ich kehre wieder. Und wer sucht meine Schätze und meine Geheimnisse bei dem toten Cäsar! Hüte sie mir.»
Wäre das Wasser in dem Amethystkelch schwerster Wein gewesen, der Trunk hätte nicht berauschender erregen können als dieses ringende Gespräch: halb Selbstgespräch, halb Zwiegespräch mit der wie ein Dämon verehrten Statue.
Die übermenschliche Anspannung aller Kräfte des Geistes und des Leibes in den letzten Wochen: das sieglose Ringen des heutigen Tages auf dem Forum: der sofort nach dem Erliegen neu gefaßte, fast verzweifelte Plan: die Spannung, mit der dessen Ausführung herbeigesehnt wurde, hatte in dem eisernen Mann die Erregung und zugleich die mühsam bekämpfte Erschöpfung aufs äußerste gesteigert. Er dachte, sprach und handelte wie im Fieber.
Ermüdet warf er sich aufs Lager zu Füßen der Statue. Und fast im Augenblick befiel ihn Schlaf.
Aber es war nicht der Schlaf, wie er ihn nach jeder Schuldtat, vor jeder drohenden Gefahr bisher gefunden: die Frucht seiner gewaltigen, allen Erregungen überlegenen Natur. Unruhig war dieser Schlaf. Qualvoll durch wechselnde Träume, die, hastig wie die Gedankenflucht des Fieberkranken, einander jagten.—
Endlich kam Stete in die Gesichte des Träumenden.
Er sah die Cäsarstatue, zu deren Füßen er lag, wachsen und wachsen. Immer höher ragte das majestätische Haupt. Schon hatte sie das Dach des Hauses durchdrungen.
Das Haupt mit dem Lorbeerkranz verschwand jenseits des Nachtgewölks hoch in den Sternen.
«Nimm mich mit dir!» bat Cethegus.
Aber der Halbgott erwiderte: «Ich sehe dich kaum aus meiner Höhe. Du bist zu klein! Du kannst mir nicht nachfolgen.»
Da schien dem Träumenden plötzlich krachend ein Donnerstreich das Dach des Hauses zu treffen.
Und in schmetternden Schlägen fielen die Balken über ihm zusammen, unter den Trümmern dieses Gemaches ihn begrabend. Auch die Cäsarstatue schien zerschlagen zu stürzen.
Noch immer hallten die Schläge:—auf sprang Cethegus und sah um sich.
Noch hallten die dröhnenden Schläge. Sie waren wirklich—nicht geträumt!
Aber sie schmetterten gegen die Tore seines Hauses. Cethegus ergriff Helm und Schwert. Da flogen Syphax und Lucius Licinius in das Gemach. «Auf, Feldherr!»—«Auf, Cethegus!»
«Es können noch nicht zwei Stunden sein. In zwei Stunden erst wollte ich angreifen—»
«Ja, aber die Goten! Sie kamen uns zuvor! Sie stürmen!»
«Verderben über sie! Wo stürmen sie?» Und schon war Cethegus an der Haustüre. «Wo stürmt der König?»
«An der Hafenstadt. Am Stromriegel. Er hat Brander den Fluß hinaufgeschickt. Dromonen mit brennenden Türmen auf Deck, voll Harz, Pech und Schwefel. Der erste Riegel, der Balkenriegel, und alle Schiffe dahinter stehn in Flammen! Salvius Julianus ist verwundet und gefangen. Da, sieh die Lohe steigen im Südost.»
«Der Kettenriegel—hält er noch?»
«Noch hält er! Aber wenn er reißt?»—
«Bin ich, wie einmal schon, der Riegel Roms! Vorwärts!»
Syphax führte den schnaubenden Rappen vor. Cethegus schwang sich hinauf. «Da rechts hinab! Wo ist dein Bruder Marcus?»
«An der Schanze beim Forum.»
Da stießen sie auf die Söldner, Isaurier und Abasgen, die von der Hafenstadt her flüchteten. «Flieht!» riefen diese. «Rettet den Präfekten!»—«Wo ist Cethegus?»
«Hier—um euch zu retten! Wendet euch! Zum Fluß!»
Er sprengte voran. Der Flammenschein der brennenden Balken und Schiffe bezeichnete das Ziel. Am Ufer des Flusses angelangt, sprang er vom Pferd.
Syphax barg es sorgfältig in einer leeren Warenhalle.
«Fackeln her! In die Boote! Dort liegt ein Dutzend kleiner Nachen! Längst bereitet für solche Gefahr. Alle Pfeilschützen hinein! Mir nach! Licinius, du ins zweite Boot. Rudert bis an die Kette! Legt euch hart oberhalb an die Kette. Wer der Kette, den Fluß herauf, nahe kommt—ein Hagel von Pfeilen über ihn. Die turmhohen Wallmauern gehen links und rechts senkrecht in den Fluß. Sie müssen hierher, an die Kette!»
Schon hatten sich einzelne kleine Kähne der Goten zu nahen versucht.
Aber die einen wurden vom Feuer des Balkenriegels und der Boote ergriffen. Andere schlugen in dem Gedräng, in der Dunkelheit, um. Eines, das bis auf halbe Pfeilschußweite dem furchtbar besetzen Kettenriegel genaht war—trieb wieder steuerlos stromabwärts: alle Leute der Bemannung waren den Pfeilen der Abasgen erlegen.
«Seht ihr? Da schwimmt ein Schiff der Toten!
Harret aus! Nichts ist verloren! Aber schafft Fackeln, Brände herbei. Entzündet dort die Schiffswerft. Feuer gegen Feuer!»
«Sieh dorthin, Herr!» warnte Syphax, der nicht von seiner Ferse wich.
«Ja, da schwimmt die Entscheidung heran.»
Es war ein herrlicher Anblick.
Die Goten hatten erkannt, daß durch kleine Nachen die Riegelkette nicht zu überschreiten war. Da hatten sie von der brennenden Balkenkette mit Beilhieben so viel hinweggehauen, daß in der Mitte des Flusses knapp genügender Raum frei wurde, zwischen den brennenden Balkenenden ein großes, ein Kriegsschiff hindurchzusteuern.
Aber mit der Kraft der Ruder allein durch die nahen Flammen langsam stromaufwärts dringen, dem Pfeilregen der Abasgen ausgesetzt—das konnte für das große Schiff noch schlimmer als für den «Nachen der Toten» enden.
Zaudernd hielten die Goten unterhalb der brennenden Balken. Da plötzlich erhob sich ein starker Südwind, die Wellen des Flusses aufwärts kräuselnd.
«Spürt ihr den Hauch? Das ist des Siegesgottes Atem. Die Segel gehißt! Nun folgt mir, meine Goten», so rief eine frohlockende Stimme.
Die Segel flogen empor und spannten weit die Flügel des gewaltigen Kriegsschiffes der Goten, des «wilden Schwans».
Und ein prachtvolles Schauspiel war es nun, als das mächtige Fahrzeug, mit aller Leinwand fliegend und von hundert Ruderern geschoben, den Strom heraufkam, von beiden Seiten schauerlich beleuchtet durch die brennenden Balken und Boote der Römer.
Mit ungestümer, verderbendrohender Eile trieb das Schiff stromaufwärts. Zu beiden Seiten des Oberdecks, hoch über dem geschlossenen Unterdeck der Ruderknechte, knieten, dicht geschart, gotische Krieger, die Schilde dicht aneinander gedrängt: eine eherne Schirmwand wider die Pfeile. An dem Schiffsschnabel vorn erhob sich ein riesiger Schwan mit hochgewölbten Schwingen. Zwischen diesen Schwingen aber, auf des Schwanes Rücken, stand König Totila, das Schwert in der Rechten.
«Vorwärts!» befahl er. «Zieht, ihr Ruderer! Mit aller Kraft! Haltet euch bereit, ihr Goten.»
Cethegus erkannte die jugendliche hohe Gestalt. Er erkannte schon auch die Stimme. «Laßt das Schiff nur heran.
Ganz nahe. Auf zwanzig Schritt. Dann erst schießt. Noch nicht. Jetzt. Jetzt! Pfeile los!»
«Deckt euch, ihr Goten!»
Ein Hagel von Pfeilen schlug gegen das Schiff. Aber an der Schildburg prallten sie machtlos ab.
«Verflucht!» rief Piso hinter dem Präfekten. «Sie wollen die Kette sprengen durch des Schiffes Stoß. Und sie werden es sicher, fielen auch alle Mann auf Deck. Die Ruderer sind ja unerreichbar. Und unverwundbar ist dieser Südwind.»
«Feuer in die Segel! Feuer auf das Schiff! Brände herbei!» befahl Cethegus.
Immer näher rauschte der drohende Schwan. Immer näher drohte der verderbliche Prall gegen die straff gespannte Kette. Schon erreichten nun die geschleuderten Brände das Schiff. Einer flog in das Segel des Fockmastes: es brannte rasch auf, dann erlosch es.
Ein zweiter—Cethegus hatte ihn selbst geschleudert—streifte des Gotenkönigs langes flatterndes Goldhaar.
Neben ihm fiel der Brand nieder. Er hatte es nicht bemerkt.
Da sprang ein Knabe hinzu, der, statt aller Schutz und Trutzwaffen, nur einen derben Hirtenstecken führte. Mit den Füßen trat er den Brand aus. Die anderen Brände prallten von den Schilden ins Wasser und erloschen.
Nur acht Schritte noch war der Vorderstachel der Galeere von der Kette entfernt. Die Römer bebten vor dem Anprall.
Da trat Cethegus ganz vor, an die Spitze seines Bootes, einen schweren Wurfspeer erhebend und sorgfältig zielend.
«Gebt acht», sagte er. «Sowie der König der Barbaren stürzt—rasch neue Brände.»
Nie hatte der waffenkundige Mann besser gezielt.
Und noch einmal den Speer zurückziehend, schleuderte er ihn mit der ganzen Kraft seines Hasses und seines Arms.
Atemlos harrte seine Umgebung. Aber der König stürzte nicht. Er hatte den Zielenden scharf erkannt. Gleichwohl warf er den langen, schmalen Schild nieder. Er sah der Spitze des Speeres entgegen mit zurückgehaltener schildloser Linker. Sausend kam der Speer geflogen, gerade in der Höhe, wo aus dem Panzer der nackte Hals sich hob.
Hart am Leibe erst fing ihn der König mit der linken Hand und—warf ihn sofort mit der Rechten auf den Werfer zurück: er traf den Präfekten in den linken Arm, oberhalb des Schildes: Cethegus fiel ins Knie.
Im gleichen Augenblick traf der Stoß des Schiffes die straffe Kette. Sie barst. Die Römerboote, die an derselben geruht, schlugen um, auch das des Cethegus, oder schossen meisterlos den Fluß herab.
«Sieg!» jauchzte Totila. «Ergebt euch mir, ihr Söldner.»
Cethegus erreichte schwimmend, blutend, das linke Tiberufer. Er sah, wie das Gotenschiff zwei kleine Boote herabließ, in deren eines der König sprang.
Er sah, wie eine ganze Flotille leichter gotischer Fahrzeuge, unter dem Schutz der Königsgaleere heraufgesegelt, nun ebenfalls die Reihe der Boote seiner Pfeilschützen durchbrach und auf beiden Ufern Mannschaften landete.
Er sah, wie seine Abasgen, für den Nahkampf weder gerüstet noch gestimmt, in Scharen sich einzelnen schwertschwingenden Goten ergaben.
Er sah, wie von dem Königsschiff aus nun ein Pfeilregen die Verteidiger des linken Ufers traf.
Er sah, wie das kleine Boot des Königs sich dem Ufer näherte wo er, wassertriefend, stand.
Er hatte den Helm im Wasser verloren, den Schild fallenlassen, um rascher das Land zu gewinnen. Mit dem Schwert wollte er sich dem eben landenden König entgegenwerfen. Da streifte ein Gotenpfeil seinen Hals.
«Getroffen, Haduswinth», jauchzte ein junger Schütze, «besser als damals am Marmorgrab.»—«Brav, Gunthamund.»
Cethegus wankte. Syphax fing ihn auf.
Gleichzeitig legte sich eine Hand auf seine Schulter. Er erkannte Marcus Licinius. «Du hier! Wo sind deine Krieger?»
«Tot», sagte Marcus. «Die hundert Römer fielen auf der Schanze. Teja, der schreckliche Teja, hat sie gestürmt. Die Hälfte deiner Isaurier fiel auf dem Wege nach dem Kapitol. Der Rest hält noch die Pforte des Kapitols und die Halbschanze vor deinem Hause. Ich kann nicht mehr. Tejas Beil drang durch meinen Schild in die Rippen. Leb' wohl, o großer Cethegus! Rette das Kapitol. Aber: siehe hin. Teja ist rasch.» Und Marcus sank zu Boden.
Flammen schlugen hoch in die Nacht vom kapitolinischen Berg.
«Hier am Fluß ist nichts mehr zu retten», sprach der Präfekt mühsam. Denn sein Blutverlust war groß und schwächte ihn rasch. «Ich rette das Kapitol! Dir, Piso, befehl' ich den Barbaren-König.
Du hast schon einen Gotenkönig auf der Schwelle Roms getroffen. Triff einen zweiten! Und triff ihn tödlich! Du, räche deinen Bruder, Lucius. Folge mir nicht.»
Cethegus warf noch einen grimmigen Blick auf den König, um dessen Füße sich flehend die Abasgen drängten.
Tief seufzte er auf
«Du wankest, o Herr?» fragte Syphax schmerzlich.
«Rom wankt!» antwortete Cethegus. «Aufs Kapitol!»
Lucius Licinius drückte seinem sterbenden Bruder noch einmal die Hand. «Ich folge ihm doch», sagte er dann. «Er ist wund.»
Während Cethegus, Syphax, Lucius Licinius in der Nacht verschwanden, duckte sich Piso hinter die Säule einer Basilika, an welcher hart vorbei der Weg den Fluß aufwärts führte.
Inzwischen hatte der König die sich ihm ergebenden Abasgen seinen Gefolgen überwiesen. Er machte einige Schritte stromaufwärts und wies mit dem Schwert nach den Flammen, die vom Kapitol aufstiegen.
Dann wandte er sich, das Antlitz dem Fluß und den langsamer landenden Goten zugekehrt.
«Vorwärts», mahnte er. «Eile. Es gilt löschen da oben. Der Kampf ist aus. Nun, ihr Goten, schirmt, erhaltet Rom. Denn es ist euer.»
Diesen Augenblick ersah Piso. «Helfer Apollo», dachte er, «traf je mein Jambus, jetzt laß mein Schwert treffen.»
Und hinter der Säule hervor sprang er mit gezücktem Schwert auf den König zu, der ihm den Rücken zuwandte.
Aber wenige Zoll vor des Königs Leib ließ er, laut aufschreiend, die Klinge fallen. Ein derber Stockhieb hatte seine Hand gelähmt.
Gleich darauf sprang ein junger Hirt an ihm empor und riß ihn nieder. Der Sieger kniete ihm auf der Brust.
«Gib dich, römischer Wolf!» rief eine helle Knabenstimme.
«Ei, Piso, der Jambenpoet...! Er ist dein Gefangener, Knabe», sprach der König, der nun herzugetreten war. «Und soll sich lösen mit schwerem Gold. Wer aber bist du, junger Hirt, mein Zügelführer?»
«Dein Lebensretter ist er, o Herr», fiel der alte Haduswinth ein. «Wir sahen den Römer auf dich stürzen. Aber wir waren zu weit zurück, dir zu rufen oder zu helfen. Dem Knaben danken wir dein Leben.»
«Wie heißt du, junger Held?»
«Adalgoth.»
«Was suchst du hier?»
«Cethegus, den Neiding, den Präfekten von Rom! Wo ist er, Herr König? Das sage du mir. Hierher, auf das Schiff, ward ich gewiesen. Hier, hört' ich, werd' er deinem Ansturm wehren.»
«Er war hier. Er ist entflohen. Wohl in sein Haus.»
«Willst du mit diesem Stecken den Höllenkönig bezwingen?» fragte Haduswinth.
«Nein», rief Adalgoth, «nun hab' ich ja ein Schwert.»
Und er hob vom Boden seines Gefangenen Waffe, schwang sie empor und war in der Nacht verschwunden.
Totila übergab Piso den Goten, die nun in dichten Scharen auf beiden Seiten des Flusses gelandet waren.
«Eilt», wiederholte er. «Rettet das Kapitol, das die Römer verbrennen.»
Inzwischen hatte der Präfekt das Flußufer verlassen und den Weg nach dem Kapitol eingeschlagen.
Durch die Porta trigemina gelangte er nach dem Forum boarium. An dem Janustempel traf er auf ein Volksgedränge, das ihn eine Weile aufhielt. Trotz seiner Verwundung war er so geeilt, daß ihm Licinius und Syphax kaum zu folgen vermochten. Wiederholt hatten sie ihn aus den Augen verloren. Erst jetzt holten sie ihn ein. Er wollte nun durch die Porta carmentalis eilen und so die Rückseite des Kapitols gewinnen.
Aber er fand es schon dicht von Goten besetzt. Darunter war Wachis. Der erkannte ihn von fern.
«Rache für Rauthgundis!» rief er. Ein schwerer Stein traf des Präfekten helmloses Haupt. Der wandte sich und floh.
Nun erinnerte er sich einer Mauersenkung nordöstlich von jenem Tor. Dort wollte er versuchen, über den Wall zu steigen.
Als er sich aber dem Mauerrand näherte, schlugen abermals die Flammen auf dem Kapitol empor.
Drei Männer sprangen ihm gegenüber über die Mauersenkung. Es waren Isaurier. Sie erkannten ihn. «Flieh, o Herr! Das ganze Kapitol ist verloren! Der schwarze Gotenteufel!»
«Hat er—hat Teja den Brand gestiftet?»
«Nein: wir selbst zündeten eine Holzschanze an, darin sich die Barbaren festgesetzt. Die Goten löschen.»
«Die Barbaren retten mein Kapitol.» Bittern Schmerzes voll stützte sich Cethegus auf den Speer, den ein Söldner dem Wankenden reichte. «Nun muß ich noch in mein Haus.»
Und er wandte sich nach rechts, auf dem nächsten Weg den Haupteingang seines Hauses zu erreichen.
«O Herr, das ist gefährlich!» warnte einer der Söldner. «Bald werden die Goten auch dort sein. Ich hörte, wie der schwarze Gotenfürst immer nach dir rief und fragte. Er suchte dich überall auf dem Kapitol. Bald wird er dich in deinem Hause suchen.»
«Ich muß noch einmal in mein Haus!»
Aber kaum hatte er ein paar Schritte vorwärts gemacht, als eine Schar Goten, mit Römern gemischt, mit Fackeln und Bränden, von der Stadt her, ihm gerade entgegenkam.
Die vordersten, es waren Römer, erkannten ihn. «Der Präfekt!»—«Der Verderber Roms!»—«Er hat das Kapitol anzünden lassen!»—«Nieder mit ihm!»
Pfeile, Steine, Speere flogen ihm entgegen. Ein Söldner fiel, zwei entflohn. Cethegus traf ein Pfeil: er drang ihm nur leicht in die linke Schulter. Er riß ihn heraus. «Ein Römerpfeil! Mit meinem Stempel», lachte er auf.
Mit Mühe entkam er ins Dunkel der nächsten schmalen Gasse. Vor seinem Hause lärmte nun der Haufe, vergeblich bemüht, die mächtige Haupttüre zu sprengen. Ihre Schwerter und Speere reichten dazu nicht aus. Cethegus vernahm es wohl und die Rufe des Zorns über das vergebliche Mühen.
«Die Tür ist fest!» sagte er sich. «Bevor sie eindringen, bin ich lange wieder aus dem Hause.» Durch die enge Seitengasse gelangte er an den Hintereingang seines Hauses, drückte an eine geheime Feder, trat in den Hof und eilte, die Türe offen lassend, in das Gebäude.
«Horch!» da donnerte von dem Haupttore her ein ganz andres, ein gewaltigeres Schlagen als bisher.
«Eine Streitaxt!» sagte Cethegus. «Das ist Teja.»
Cethegus eilte an eine schmale Mauerlücke, die von dem Eckgemach auf die Hauptstraße einen Blick gewährte.
Es war Teja.
Sein schwarzes, langes Haar flatterte um das unbehelmte Haupt. In der Linken trug er einen aus dem Feuer des Kapitols gerafften Brand, in der Rechten das gefürchtete Schlachtbeil. Über und über war es mit Blut bespritzt.
«Cethegus!» rief er laut bei jedem Schlag seines Beils wider die ächzende Haustür. «Cornelius Cethegus Cäsarius! Wo bist du? Ich suche dich im Kapitol, Präfekt von Rom! Wo bist du? Muß Teja dich an deinem Hausherd suchen?»
Da hörte der lauschende Cethegus eilende Schritte hinter sich. Syphax hatte das Haus erreicht und war durch die Hintertür ihm gefolgt. Er erblickte seinen Herrn. «Flieh, o Herr! Ich decke deine Schwelle mit meinem Leib.»
Und er eilte an ihm vorüber, durch eine Reihe von Gemächern, an die Haupttüre.
Cethegus wandte sich nach rechts. Kaum konnte er sich noch aufrecht halten.
Er erreichte noch den Zeussaal. Hier sank er zusammen. Doch augenblicklich sprang er wieder auf.
Denn krachend und schmetternd scholl es vom Haupteingang her. Das feste Tor war endlich eingeschlagen. Dröhnend fiel es nach innen: und Teja betrat das Haus seines Feindes.
Auf der Schwelle sprang ihm, aus geduckt kauernder Stellung aufschnellend wie ein Panther, der Maure an den Hals, mit der Linken seine Gurgel umkrallend, in der Rechten blitzte das Messer. Aber der Gote ließ die Axt fallen: ein Ruck seiner Rechten, und wie eine fortgeschleuderte Kugel flog der Angreifer zur Seite, die Tür hinaus, und rollte die Stufen hinab auf die Straße.
«Wo bist du, Cethegus?» scholl nun Tejas Stimme näher und näher dringend im Atrium, im Vestibulum.
Einige Türen, die der Schreibsklave Fidus verriegelt hatte, sprengte rasch sein Beil.
Nur wenige Schritte trennten die beiden Männer.
Mühsam hatte sich Cethegus bis in die Mitte des Zeussaals geschleppt. Er hoffte immer noch das Schreibgemach erreichen und aus der Cäsarstatue die anvertrauten Schriften und Schätze nehmen zu können.
Da krachte nochmals eine gesprengte Tür, und Cethegus hörte Tejas Stimme aus dem Schreibgemach: «Wo bist du, Cethegus, Hausherr?»
Atemlos lauschte Cethegus.
Er hörte, wie in der Bibliothek der Teja nachdringende Haufe die Ahnenbilder und die Büsten zerschlug.
«Wo ist dein Herr, Alter?» rief Tejas Stimme.
Der Sklave hatte sich in das Schreibgemach geflüchtet.
«Ich weiß es nicht, bei meiner Seele.»
«Auch hier nicht? Cethegus, Feigling! Wo steckst du?»
Da hatte auch die Menge offenbar das Schreibgemach erreicht.
Cethegus vermochte nicht mehr zu stehen. Er lehnte sich an den marmornen Jupiter.
«Was wird mit dem Hause?»
«Verbrannt wird es!» antwortete Teja.
«Der König hat das Brennen verboten», mahnte Thorismut.
«Ja! Dies Haus aber hab' ich mir vom König erbeten. Es wird verbrannt und der Erde gleichgemacht. Nieder mit dem Tempel des Teufels! Nieder mit seinem Allerheiligsten:—dem Götzen hier!»
Und ein furchtbarer Schlag erscholl.
Krachend, schmetternd stürzte die Cäsarstatue in vielen Trümmern auf den Mosaikboden. Goldstücke, Kästchen, Kapseln rollten umher.
«Ah, der Barbar!» schrie Cethegus außer sich.
Und alles vergessend wollte er mit dem Schwert in das Schreibgemach stürmen. Da fiel er bewußtlos auf das Antlitz nieder zu Füßen der Jupiterstatue.
«Horch, was war das?» fragte eine Knabenstimme.
«Die Stimme des Präfekten!» rief Teja und riß die Türe auf, die das Schreibgemach von dem Zeussaal trennte.
Mit dem Brande vorleuchtend und hoch die Streitaxt schwingend sprang er in den Saal.
Aber der Saal war leer.
Eine Blutlache lag zu den Füßen des Jupiter, und eine breite Blutspur führte von da an das Fenster, das in den Hofraum blickte.
Auch der Hof war leer.
Nacheilende Goten aber fanden die kleine Hofpforte geschlossen, und zwar von außen. Der Schlüssel steckte auf der Straßenseite im Schloß.
Als man mit Mühe—nach langer Arbeit—auch diese Tür gesprengt—gleichzeitig fast hatten andre Goten, aus dem Hauptausgang auf die Straße und um die Ecke des Hauses eilend, die schmale Seitengasse erreicht—und die Gasse mit deren Gebäuden absuchte, fand man nur an der Ecke das Schwert des Präfekten, das Fidus, der Schreibsklave, erkannte.
Finster blickend nahm es Teja und kehrte in das Schreibgemach zurück. «Lest alles sorgsam auf, was des Präfekten Götzenstatue barg. Hört ihr, alles. Schreibereien zumal, und bringt sie dem König—wo ist der König?»
«Aus dem Kapitol zog er mit Römern und Goten in die Kapelle Sankt Peters, dort mit allem Volk das Dankgebet zu sprechen.»—
«Gut, sucht ihn in der Kirche und bringt ihm alles. Dazu des Entflohenen Schwert. Sagt: Teja schickt ihm das.»
«Soll geschehn. Du aber—gehst du nicht mit zum König und in die Kirche?»
«Nein.»
«Wo verbringst du die Siegesnacht und feierst den Dankgottesdienst?»
«Auf den Trümmern dieses Hauses!» sprach Teja.
Und er stieß den Brand in die Purpurteppiche des Lagers.
Und fortan hielt König Totila Hof zu Rom herrlich und in Freuden. Des Krieges schwerste Aufgabe schien getan. Nach dem Falle von Rom öffneten die meisten kleinen Festungen an der Küste oder im Gebirge des Apennin die Tore, nur wenige mußten belagert und erobert werden. Dazu sandte der König seine Feldherrn aus: Teja, Guntharis, Grippa, Markja, Aligern, während er selbst zu Rom die schwere, die staatsmännische Aufgabe übernahm, das durch langjährigen Krieg und Aufstand zerrüttete Reich zu beruhigen, neu zu ordnen, beinahe neu zu gründen.
In alle Landschaften und Städte schickte er seine Herzoge und Grafen, in allen Gebieten des Staatslebens des Königs Gedanken auszuführen: zumal auch die Italier zu schützen wider die Rachsucht der siegreichen Goten. Denn er hatte eine allumfassende Verzeihung vom Kapitol herab verkündet, mit Ausnahme eines einzigen Hauptes: des Expräfekten Cornelius Cethegus Cäsarius.
Überall ließ er die zerstörten Kirchen, der Katholiken wie der Arianer, wieder herstellen, überall die Grundbesitzverhältnisse prüfen, die Steuern neu verteilen und herabsetzen.
Die segensreichen Früchte dieser Mühen blieben nicht aus. Schon seitdem Totila die Krone aufgesetzt und seinen ersten Aufruf erlassen, hatten die Italier in allen Landschaften die lang versäumte Feldarbeit wieder aufgenommen. Überall waren die gotischen Krieger angewiesen, sich jeder Störung hierin zu enthalten, Störungen durch die Byzantiner nach Kräften abzuwehren. Und eine wundersame Fruchtbarkeit der Gefilde, ein Herbstsegen an Getreide, Wein und Ö1, wie seit Menschenaltern unerhört, schien sichtbarlich die Gnade des Himmels für den jungen König zu bezeugen.
Die Kunde von der Einnahme von Neapolis und Rom durchflog das staunende Abendland, das bereits das Gotenreich in Italien als erloschen betrachtet hatte.
Mit dankbarer Bewunderung erzählten die Kaufleute, die der kräftige Rechtsschutz, die Sicherung der Landstraßen durch umherziehende Sajonen und Reitergeschwader, der See durch die immer wachsame Flotte der Goten wieder in die verödeten Städte und Häfen der Halbinsel zog, von der Gerechtigkeit und Milde des königlichen Jünglings, von dem Flor seines Reiches, von dem Glanz seines Hofes zu Rom, wo er die aus Flucht und Empörung zurückkehrenden Senatoren um sich versammelte und dem Volke reiche Spendungen und schimmervolle Zirkusfeste gab.
Die Könige der Franken erkannten den Umschlag der Dinge, sie schickten Geschenke:—Totila wies sie zurück, sie schickten Gesandte: Totila ließ sie nicht vor. Der König der Westgoten bot ihm offen Waffenbündnis gegen Byzanz und die Hand seiner Tochter; die awarischen und sclavenischen Räuber an der Ostgrenze wurden gezüchtigt: mit Ausnahme der wenigen noch belagerten Plätze, Ravenna, Perusium und einigen kleinen Kastellen, waltete Friede und Ruhe im ganzen Gotenreich, wie nur in den goldensten Tagen von Theoderichs Regiment.
Dabei verlor aber der König die Weisheit der Mäßigung nicht. Er erkannte, trotz seiner Siege, die drohende Überlegenheit des oströmischen Reiches und suchte ernstlich Frieden mit dem Kaiser. Er beschloß, eine Gesandtschaft nach Byzanz zu schicken, die den Frieden auf Grund von Anerkennung des gotischen Besitzstandes in Italien anbieten sollte; auf Sizilien, wo kein Gote mehr weilte,—nie waren die gotischen Siedlungen auf dem Eiland zahlreich gewesen—wollte er verzichten; ebenso auf die von den Byzantinern besetzten Teile von Dalmatien, dagegen sollte der Kaiser vor allem Ravenna räumen, das keine Kunst oder Ausdauer der gotischen Belagerer zu gewinnen vermocht hatte.
Als den geeignetsten Träger dieser Sendung des Friedens und der Versöhnung faßte der König den Mann ins Auge, der durch Ansehen und Würde der Person, durch hohen Ruhm der Weisheit auch im Ostreich getragen, durch Liebe zu Italien und den Goten ausgezeichnet war—den ehrwürdigen Cassiodor.
Obwohl sich der fromme Greis seit Jahren von den Staatsgeschäften zurückgezogen hatte, gelang es der Beredsamkeit des jungen Königs, ihn zu bewegen, für jenen hohen, gottgefälligen Zweck die Einsamkeit seiner Klosterstiftung zu verlassen und die Mühen und Gefahren einer Reise nach Byzanz zu unternehmen. Jedoch unmöglich konnte er dem alten Mann die Last einer solchen Sendung allein aufbürden: er suchte nach einem jugendkräftigen Gefährten von ähnlicher Milde christlicher Gesinnung, nach einem zweiten Apostel des Friedens.—
Wenige Wochen nach der Einnahme von Rom trug ein königlicher Bote folgendes Schreiben über die cottischen Alpen in die Provence: «An Julius Manilius Montanus, Totila, den sie der Goten und Italier König nennen.
Komm, mein geliebter Freund, komm zurück an meine Brust!
Jahre sind verstrichen: viel Blut, viele Tränen sind geflossen: in Schreck und in Freude hat sich mehr als einmal alles um mich her verwandelt, seit ich dir zum letztenmal die Hand gedrückt. Alles hat sich verwandelt um mich her: aber nichts in mir, nichts zwischen dir und mir. Noch verehre ich alle die Götter, an deren Altären wir gemeinsam in den ersten Träumen der Jugend geopfert, sind auch diese Götter mit mir selbst gereift.
Du wichest vom italienischen Boden, als Bosheit, Gewalt, Verrat, als alle dunkeln Mächte darauf wüteten. Siehe: sie sind verschwunden, hinweggefegt, hinweggesonnt: fernab ziehen grollend die besiegten Dämonen, ein Regenbogen wölbt sich schimmernd über diesem Reich.
Mich aber hat, nachdem bessere Kräfte glücklos, sieglos erlegen, mich hat der Himmel begnadigt, das Ende des furchtbaren Gewittersturmes zu schauen und die Saat zu streuen einer neuen Zeit. Komm nun, mein Julius: hilf mir jene Träume erfüllen, die du dereinst als Träume belächelt. Hilf mir, aus Goten und Italiern ein neues Mischvolk schaffen, das beider Vorzüge vereint, das beider Fehler ausschließt. Hilf mir erbauen ein Reich des Rechts und des Friedens, der Freiheit und der Schönheit, geadelt durch italische Anmut, getragen durch germanische Kraft.
Du hast, mein Julius, der Kirche ein Kloster gebaut—hilf mir nun, der Menschheit einen Tempel zu bauen.
Einsam bin ich, Freund, auf der Höhe des Glücks.
Einsam harrt die Braut der vollen Lösung des Gelübdes entgegen. Den treuen Bruder hat mir der Krieg geraubt. Willst du nicht kommen, mein dioskurischer Bruder? In zwei Monaten warte ich dein im Kloster zu Taginä mit Valeria.
Und Julius las, und mit gerührter Seele sprach er vor sich hin: «Mein Freund, ich komme.»
Ehe König Totila von Rom nach Taginä aufbrach, beschloß er, eine Schuld tiefen Dankes abzutragen und ein Verhältnis würdig, das heißt schön, zu gestalten, das bisher seiner nach Harmonie verlangenden Seele nicht entsprach: sein Verhältnis zu dem ersten Helden seines Volkes, zu Teja.
Sie waren seit früher Knabenzeit befreundet. Obwohl Teja um mehrere Jahre älter, hatte er doch die Tiefe des Jüngern unter der glänzenden Hülle des Frohsinns von je erkannt und geehrt. Und ein gemeinsamer Zug zum Schwungvollen und Idealen, ja ein gewisser Stolz und Hochsinn hatte sie früh zueinander gezogen.
Später freilich hatte entgegengesetztes Geschick die von Anfang verschieden angelegten Naturen weit auseinander geführt. Die sonnenhelle Art des einen war wie blendende Verletzung grell in das nächtige Dunkel des andern gefallen.
Und Totila hatte in rascher Jugendlust das Düster des Schweigsamen, das er in seinem Wesen nicht begriff, in seinen Ursachen nicht kannte, nach wiederholten warmen Versuchen der Umstimmung als krankhaft von sich ferngehalten. Des milderen Julius, obzwar auch ernste, aber sanftere Weise, dann die Liebe, hatte den Freund aus der Knabenzeit zurückgedrängt.
Aber die letzten reifenden Jahre seit dem mächtigen Blut- und Bruderbund, die Leiden und Gefahren seit dem Tod des Valerius und Miriams, dem Brand von Neapolis, der Not vor Rom, dem Frevel zu Ravenna und Castra Nova und zuletzt die Pflichten und Sorgen des Königtums hatten den Jüngling, den ungeduldig fröhlichen, so voll gereift, daß er dem dunklen Freunde voll gerecht werden konnte.
Und was hatte dieser Freund geleistet, seit jener Bundesnacht! Wenn die andern alle müde erlahmten: Hildebads Ungestüm, Totilas Schwung, Witichis' ruhige Stete, selbst des alten Hildebrands eisige Ruhe—zu Regeta, vor Rom, nach Ravennas Fall und wieder vor Rom: was hatte er nicht geleistet! Was schuldete ihm das Reich!
Und er nahm keinen Dank. Wie eine Kränkung hatte er es abgewiesen, als ihm schon Witichis die Herzogwürde, Gold und Land bot. Einsam, schweigend schritt er schwermütig durch die Straßen Roms, im Sonnenschein von Totilas Nähe der letzte Schatten. Die schwarzen Augen tief gesenkt, stand er zunächst an des Königs Thron. Wortlos stahl er sich von des Königs Festen.—Nie kamen Rüstung und Waffen von seinem Leibe. Nur im Kampfe lachte er manchmal, wann er mit den Tod verachtender oder den Tod suchender Kühnheit in die Speere der Byzantiner sprang, dann schien ihm wohl zu sein, dann war alles an ihm Leben, Raschheit und Feuer.
Man wußte im Gotenvolk, zumal Totila wußte es noch aus frühester Jünglingszeit, daß die Gabe des Gesanges in Lied und Wort dem trauervollen Helden eigen war. Aber seit er aus seiner Gefangenschaft in Griechenland zurückgekehrt war, hatte man nie ihn bewegen können, eines seiner glühenden, tief verhaltenen Lieder anzustimmen vor andern. Doch wußte man, daß die kleine dreieckige Harfe seine Begleiterin in Krieg und Frieden war, unzertrennlich wie sein Schwert an ihn gebunden. Und in der Schlacht im Ansturm hörte man ihn wohl manchmal wilde abgerissene Zeilen singen zu dem Takt der gotischen Hörner.
Und wer ihn in der Nacht beschlich, die er gern im Freien, zwischen der Wildnis von weißem Marmor und dunklem Gebüsch, in den römischen Ruinen verbrachte, der mochte wohl manchmal eine verlorene Weise seiner Harfe erlauschen, zu der er träumerische Worte sang. Fragte ihn aber einer—was selten gewagt wurde—, was ihm fehle, so wandte er sich schweigend ab. Einmal nach der Einnahme Roms antwortete er Herzog Guntharis auf die gleiche Frage: «Der Kopf des Präfekten.»
Der einzige, mit dem er häufiger verkehrte, war Adalgoth, dessen er sich in jüngerer Zeit angenommen. Der junge Hirt war vom König zu seinem Herold und zum Mundschenk erhöht worden, zum Dank für seine kühnen und rettenden Taten bei der Erstürmung des Tiberufers. Er hatte eine starke Anlage zum Singen und Sagen mitgebracht, obzwar mit geringerer Schulung. Teja hatte Freude an seiner Gabe gefunden: und man sagte, er lehre ihn geheim seine überlegne Kunst, obwohl sie zueinander stimmten wie Nacht und Morgenglanz. «Eben drum», hatte Teja gesagt, als ihm sein tapferer Vetter Aligern dies vorhielt. «Und es muß doch noch was übrigbleiben, wenn die Nacht versank.»—
Der König fühlte: das einzige, was diesem Mann zu bieten war, hatte er zu bieten, aber nicht Gold, Land und Würden.
Eines Abends—schon traten die Sterne aus dem rasch dunkelnden Himmel—machte sich der König auf von dem Abendgelag in seinem Palast (dem Haus der Pincier, in welchem Belisarius gewohnt hatte), ohne Begleitung den scheuen Helden zu suchen in der Wildnis von Gestein und Lorbeer, welche die Gärten des Sallust erfüllten, und wo Teja, wenn er in Rom war, zu hausen pflegte.
Adalgoth, der Mundschenk, hatte sich für den Abend Urlaub von des Königs Tafel erbeten: dieser erriet, daß er die dunkelnden Stunden, wie so oft, bei dem dunklen Harfenmeister verbringen werde. Der König wußte daher, er werde Teja in seiner Gartenwildnis finden.
Wirklich weilten Lehrer und Schüler diese Nacht unter dem Schatten uralter römischer Pinien und Zypressen, gotische Harfenkunst pflegend.
«Nun horch' einmal, Graf Teja», hob der Jüngling an, «was ich da aus deinen neulich angefangenen Zeilen weiter ersonnen habe. Bei dir ist wieder alles so traurig! Das Ende, der hoffnungslose Sprung in den Strom! Ich habe das viel lustiger gewendet.»
«Wenn's nur auch so wahr ist.»
«Ei, wenn's nur schön ist! Und wahr! Ist denn nur das wahr, was traurig ist?»
«Leider: ja.»
«Gibt's keine Freude in der Welt?»
«O ja! Aber sie währt nicht lang. Der Ausgang ist immer—Untergang.»
«Nun, aber doch oft erst recht spät. Und was zwischen Aufgang und Untergang liegt—hat das keinen Wert? Ist's nicht auch ein Gang?»
«Ja, es soll sein: Heldengang.»
«Nun, so höre nur. Ich habe deinen Aufgang beibehalten: in der Mitte Trauergang: dann Siegesgang.—Aber deinen Untergang hab' ich weggelassen. Bei dir springen sie hoffnungslos in den Iserstrom. Ich aber habe unsern alten Waffenmeister Hildebrand...»—
«Wenn er doch endlich Ravenna hätte!»
«Und unseren großen König Dietrich als Kind, als geretteten Erben, habe ich ihn hineingebracht. Und das Ganze will ich nächstens bei einem großen Königsfest dem lieben Herrn vorspielen. Aber wohlverstanden: ich hab' es in der neuen Klingweise gesetzt, die du mich gelehrt hast, und die viel mehr das Ohr gewinnt und die Seele befängt, als der alte Stabreim, nach dem unsere Heldengesänge und die Vorzeitsprüche gesetzt sind. Woher hast du nur die Klingweise am Schluß der Zeilen genommen?»
«Die Mönche singen so die lateinischen Lieder und die Priester in der Kirche: ich hörte es einmal, abends, im Dämmerlicht in der Basilika Sankt Peters. Die Vorhänge der Kirche waren zurückgeschlagen, das Abendlicht flutete träumerisch herein, die Kerzen am Altar gaben ihren roten Schein dazu, Weihrauchwolken zogen duftend dazwischen, und unsichtbare Priesterknaben sangen mit hellen Stimmen aus der Krypta, wo sie einen Toten bargen. Da zuerst hörte ich den Klang, der gleich ist und doch wieder nicht ganz gleich, und zauberhaft umfing der Wohlklang mein Gehör, und ich versuchte in unsrer Sprache das gleiche nachzubilden, und siehe da: wunderbar gelang es.»
«Ja, es passen die Schlußklänge zusammen wie—wie der Helm auf das Haupt—wie das Schwert in die Scheide. Wie Lippe auf Lippe im Kuß.»
«Ei, weißt du auch davon schon? Das ist früh!»
«Ich habe nur meine schöne Schwester Gotho geküßt», sagte der Jüngling errötend.
«Nun, aber der Gleichklang! Für vieles ist er wohl lieblich. Aber du mußt der Väter Weise nicht ganz versäumen: den runenheiligen Stabreim.»
«Ja, für manches ist er wie angeboren und viel kräftiger geeignet als der hinschmelzende Klangreim. Weißt du, wenn die Stäbe, die starken, stolz anstimmen, so mahnt es mich mächtig des wehenden Windes, der im Walde durch die Wipfel dahinwogt, beugend und biegend Baum nach Baum.»
«Dir, lieber Knabe, hat der Gott des Gesangs wirklich die Lippen berührt. Auch wenn du's nicht weißt und willst, überkommt dich der Schrittgang des Wohllauts, wie die Rede ihn heischt und der Sinn ihn ersehnt. Nun sage: wie lautet mein Lied von der Gotentreue in deiner Verjüngung?»
«Ich fange an wie du:
‹Erschlagen war mit dem halben Heer
Der König der Goten, Theodemer.›
Und so fort. Aber wenn sie dann alle verzweifeln und hoffnungslos in den Strom springen wollen, dann kommt bei mir die Hoffnung, die Erlösung, der Blick in die gerettete Zukunft. Nämlich so:
‹Erschlagen war mit dem halben Heer
Der König der Goten, Theodemer.
Die Heunen jauchzten auf blutiger Wal:
Die Geier stießen herab zu Tal.
Der Mond schien hell, der Wind pfiff kalt:—
Die Wölfe heulten im Föhrenwald
Drei Männer ritten durchs Heidegefild
Den Helm zerschroten, zerhackt den Schild.
Der Erste über dem Sattel quer
Trug seines Königs zerbrochnen Speer.
Der Zweite des Königs Kronhelm trug,
Den mitten durch ein Schlachtbeil schlug.
Der Dritte barg mit treuem Arm
Ein verhüllt Geheimnis im Mantel warm.—
So kamen sie an die Donau tief:—
Und der Erste hielt mit dem Roß und rief:
«Ein zerhau'ner Helm, ein zerhackter Speer—
Von dem Reiche der Goten blieb nicht mehr!»
Und der Zweite sprach: «In die Wellen dort
Versenkt den traurigen Gotenhort.
Dann springen wir nach von dem Uferrand:—
Was säumest du—Meister Hildebrand?»
«Und tragt ihr des Königs Helm und Speer,
Ihr treuen Gesellen—ich trage mehr!»
Auf schlug er seinen Mantel weich:
«Ich trage der Goten Hort und Reich!
Und habt Ihr gerettet Speer und Kron:'—
Ich habe gerettet—des Königs Sohn!
Erwache mein Knabe: ich grüße dich:
Du König der Goten—Jung Dietrich!»›
«Ist auch gar nicht übel. Aber wahr ist...»
«Wahr ist wohl nur, was dir in Gesichten der höchsten Trauer naht? Sage, wie geht jenes andre, das Traumgedicht weiter?»
«'s kein Traum ganz. Und kein Gedicht ganz. Ich fürchte, es wird die ganze Wahrheit.
Ich hatte vor dem Einschlafen lang an Gelimer, den letzten König der Vandalen gedacht, den tapfern Mann, dem zuletzt nichts geblieben von seinem schimmervollen Reich als die Harfe, darauf er in den Felsgebirgen Afrikas seine Trauer sang. Allmählich versank ich in leisen Schlummer, oder doch in Traum. Da sah ich vor mir eine Landschaft Campaniens: schön, wie kaum eine andre dieses wundersamen Landes. Die Bucht von Neapolis, die blauen Wogen von Bajä, sonnenbeglänzt im Vordergrund. Im Hintergrund der gewaltige Berg mit dem Feueratem und der Rauchwolke»—
«Wie heißt er doch?» forschte begierig der Hirt.
«Mons Versuvius. Von seinen Schluchten aber herab stieg, traurig, doch todes-trotzig, eine Kriegerschar in unsern, in den gotischen Waffen: blutbedeckt, die Helme verhaun, die Schilde durchstoßen. Und sie trugen auf eichenen Speeren einen toten Mann—ihren König.»
«Totila?» fragte erschrocken der Jüngling.—«Nein, beruhige dich», antwortete Teja, mit einem schwermütigen Lächeln, «schwarz waren die Locken des bleichen Toten. Und quer durch die ehrfurchtsvoll staunenden Feinde zogen sie langsam, in feierlichem Trauerschritt, an die Küste der See. Dort lag eine stolze, gewaltige Flotte: nicht der Goten und nicht der Griechen, mit ragenden Drachenhäuptern am Bug der Schiffe. Auf diesen Schiffen sollte der Tote geborgen werden. Dabei aber vernahm ich die Worte des Trauerliedes, des Totengesangs für den König. Und sie lauteten:
‹Gebt Raum, ihr Völker, unserm Schritt!
Wir sind die letzten Goten:
Wir tragen keine Krone mit:—
Wir tragen einen Toten.
Mit Schild an Schild und Speer an Speer
Wir ziehn nach Nordlands Winden,
Bis wir im fernsten grauen Meer
Die Insel Thule finden.
Das soll der Treue Insel sein—
Dort gilt noch Eid und Ehre!›——
Soviel vernahm ich von dem Totengesang.—Da weckte mich das Heerhorn der gotischen Wache, die der sorgsame König nachts durch die Straßen ziehen läßt. Du aber merke dir diesen Anfang: vielleicht kommt der Tag, da du's zu Ende singst. Du hast ja in kurzer Zeit soviel gelernt, daß du bald harfenkund'ger und liedkund'ger bist denn ich.»
«Wenn du mich nur auch lehren könntest, solche Streiche zu führen wie du.»
«Das wächst mit den Jahren, ja mit den Wochen. Du hast genug getan für deine siebzehn Jahre. Wäre dem wackern Witichis ein Helfer zur Seite gesprungen, ehe der römische Dichter den Stein auf ihn warf im Grab Hadrians, wie du dem Maienkönig Totila den von dem gleichen Mann drohenden Stoß hast abgewehrt, so hätten wir damals schon Rom gewonnen und den Präfekten verjagt, der uns leider entkam.»
«Ja, leider! Weißt du: das Abenteuer, das mir in jener Nacht aufgestoßen, in des Präfekten Hause, das schwebt mir schon lang in Gedanken. Das gäbe ein wunderbares Lied—fehlt leider nur der Schluß.»
«Warte nur. Vielleicht erlebst du ihn. Dann brauchst du ihn nicht zu erdichten. Übrigens zog ich schon am Morgen nach jener Siegesnacht in des Präfekten Haus zur Verfolgung der flüchtigen Legionäre aus. Ich weiß daher gar nicht, wie alles kam. Erzähle mir.»
«Nun, so höre. Nachdem ich den Präfekten nicht am Tiber und nicht am Kapitol gefunden, suchte ich ihn mit dir an seinem Herd. Und fand nur seines Blutes Spur und sein Schwert. Als du aber seinen Götzen zertrümmert und sein Haus verbrannt und alles zusammenbrach, bis in die Kellergewölbe, da fand ich, nachspürend, in dem Gebälk unter dem Sockel der Marmorstatue abermals einen hohlen Raum: mit Gold, Gestein und allerlei Geschreibsel angefüllt.
Ich brachte das Ganze auf einem breiten Schild dem König. Und der ließ seine Buchleser darin forschen und wühlen und las selbst darin. Und rief plötzlich: ‹Also Alarich, der Balte, unschuldig!› Und tags darauf, da ich zu einem Königsherold auserkoren, war mein erst Geschäft, umherzureisen in den Straßen Roms, auf weißem Roß, mit dem goldnen Heroldsstab, und auszurufen unter allen Goten und Römern:
‹Adalgoth, des Königs Herold, ruft! Gefunden ward in des Expräfekten Haus, durch Adalgoths, des Hirtenknaben Hand, Beweis und Schrift, daß Herzog Alarich, der Balte, der vor zwanzig Jahren um Hochverrat zum Tode verurteilt ward, unschuldig war.›»
«Wie ward das entdeckt?»
«Cethegus hatte in Geheimschrift, die König Totila entziffern ließ, selbst in seinem Tagebuch verzeichnet, daß er den Verhaßten durch Briefe, die er in des getäuschten Königs Hand spielte, den Balten des Hochverrats verdächtigt. Der Stolze, Hochgemute reizte dann durch Trotz den Amaler und verschwand zuletzt plötzlich aus dem Kerker, niemand wußte, wie und wohin. Und weiter hatt' ich auszurufen in den Straßen: ‹Unschuldig ist Alarich, der Balte. Sein Eigen, das der Staat eingezogen, wird ihm zurückgestellt. Ihm oder seinem echten Erben. Das Herzogtum, das er geführt, das Herzogtum Apulia, wird ihm zurückgegeben. Ihm oder seinem echten Erben. Es melde sich laut an des Königs Thron Herzog Alarich oder sein echter Erbe. Gold und Gabe, Echt und Eigen, Vieh und Fahrnis, Wagen und Waffen, Geschmuck und Geschmeide, Äcker und Erbe, Rinder und Rosse und das reiche apulische Herzogtum, es werde dem Balten, dem Balten-Erben. Wo ist Alarich? Wo sein Erbe?›
Und wie ich zogen die Königsherolde durch alle Straßen und Städte Italiens, rufend und forschend nach Herzog Alarich, dem Balten, und seinem echten Erben. Und weißt du: es wäre doch wunderschön, wenn sie den verschollnen, landflüchtigen, alten Mann irgendwo fänden und wir ihn wieder mit Glanz und Ehren einführten in sein schönes Herzogtum.»
«Und da er dem Hirtenknaben die Rettung seiner Ehre, seines Rechts verdankt,—dürfte er ihm wohl schenken ein schönes Schloß, etwa am blauen Meer, am Berge Carganus, nicht wahr, unter Lorbeer und Myrten?»
«Nein, daran hab' ich noch nicht gedacht.»
«Aber schwerlich lebt er noch, der alte Herzog.»
«Nun, dann finden wir vielleicht den jungen. Herzog Guntharis sagte mir, er habe den hohen Baltenhelden noch wohl gekannt: der sei mit einem Knäblein in das Elend gegangen. Und obwohl sein Haus, die Wölsungen, mit den Balten erblichen Hader hegte, müsse er doch sagen: er habe nie an die Schuld des stolzen Mannes geglaubt, der ein Hauptfeind der Welschen war und ihnen lang ein Dorn im Auge. Und nie habe er ein schöner Kind gesehen, als jenes vierjährige Knäblein.
Ich muß nun immer nachdenken: wo der wohl hingekommen sein mag? Und wie der staunende Augen machen wird, wenn er, der vielleicht in irgendeiner kleinen Stadt sich verborgen hält, unter falschem Namen,—denn die Verbannung traf bei Todesstrafe das ganze Geschlecht—wenn der den Königsherold durch die Straßen seine Berufung zum goldnen Reif des Herzogs von Apulien künden hört. Das gäbe gar einen schönen Schluß zu einer ‹Baltensage› oder ‹Landflüchterlied›. Was meinst du? ‹Das Lied vom landverbannten Herzogssohn›: es klingt nicht übel!»
«Bei dir klingen alle Lieder glücklich aus!»
«Nun aber sage mir noch den Anfang des andren Gesanges, den du selbst, erwacht von jenem Traumgesicht, gesetzt.»
«Ja, denn das Totenlied, das hab' ich nur im Traum gehört, nicht selbst ersonnen. Aber nach dem Erwachen führte ich mir jene wohlbekannte Landschaft vor Augen am Vesuvius, gerade gegenüber dem Mons Lactarius, dem Milchberg: eine wunderbare Felsenschlucht, gebildet von dem Auswurf des Feuerbergs: kaltgewordnes schwarzes Feuer. Steil ragen die Schroffen: nur ein schmaler Zugang, den ein Mann mit einem Schilde leicht versperren und stundenlang verteidigen könnte wider jede Übermacht...»
«Du denkst bei jedem Berg und Tal gleich, wie man sie stürmen und verteidigen mag.»
«Und da kamen mir von selbst die Worte:
‹Wo die Lavaklippen ragen
An dem Fuße des Vesuvs,
Durch die Nachtluft hört man klagen
Töne tiefen Weherufs.
Schäfer, Räuber nicht noch Bauer
Dringet in die Bergschlucht ein:
Und es schwebt ein banger Schauer
Brütend ob dem dunklen Stein.
Tobte hier in Vorzeit-Tagen
Schon die Schlacht im Völkergroll?
Oder wird sie erst geschlagen,
Die den Ort verewigen soll?›»———
Und er griff auf der Harfe langsam einige Akkorde:—Adalgoth antwortete, leise, wie das Echo.
Diese Töne waren es, die König Totila als unsichtbare Wegführer heranleiteten.
In dicht verwachsenen Pfaden folgte der König nun den Klängen, die aus dem Dunkel einer Zypressengruppe her, leise in unregelmäßigen Zwischenräumen, unterbrochen von halb gesungenen, halb gesprochnen Worten, von zwei deutlich unterscheidbaren Saiteninstrumenten ausklingend, vom Nachtwind ihm zugetragen wurden. Unbemerkt war Totila, auch von dem sanften Mondlicht nicht verraten, durch die zerfallnen Mauern, welche die weitläufigen Anlagen umgeben, in die halb verwilderten Lorbeer- und Zypressengänge gelangt, die in das Innere der Gärten führten.
Teja vernahm die Schritte des Nahenden und legte die Harfe nieder. «Es ist der König», sagte er: «ich kenne seinen Gang. Was suchst du hier, mein König?»
«Ich suche dich, Teja», antwortete dieser.
Teja sprang auf von der gefallnen Säule, darauf er saß. «So geht's zum Kampf?»
«Nein», sagte Totila, «doch verdien' ich diesen Vorwurf.» Er faßte ihn bei der Rechten und zog ihn liebevoll wieder auf den Marmorsitz, sich neben ihn niederlassend. «Ich suche nicht dein Schwert, ich suche dich. Ich brauche dich, aber nicht deinen Arm:—dein Herz. Nein, bleibe nur, Adalgoth: du darfst und sollst es hören, wie man den stolzen Mann, ‹den schwarzen Grafen› lieben muß.»
«Das weiß ich, seit ich ihn gesehen. Er ist wie der Dunkelwald, durch dessen Wipfel geheimnisvolles Rauschen geht: voll Schauer und voll Reiz zugleich.»
Teja heftete einen langen Blick auf den König aus seinen großen, traurigen Augen.
«Sieh, mein Freund, soviel ist mir geworden, so Reiches hat der gnädige Himmelsgott mir zugewendet! Ein halbverlornes Reich hab' ich zurückgewonnen:—soll ich nicht auch zurückgewinnen können des Freundes halbverlornes Herz? Freilich: der Freund hat das Beste getan bei der Wiedergewinnung des Reichs:—er muß auch hier das Beste tun. Was hat mir dein Herz entfremdet? Verzeih mir, wenn ich, wenn mein strahlendes Glück dich gekränkt. Ich weiß, wem ich die Krone danke: und ich kann sie nicht mit Freude tragen, wenn nur dein Schwert, nicht auch dein Herz mein eigen. Wir waren Freunde, Teja, ehedem—o laß uns wieder Freunde sein, denn ich kann dich nicht entbehren.»
Und er wollte den Arm um seinen Nacken schlingen.
Aber Teja faßte seine beiden Hände und drückte sie.
«Dieser nächtige Gang ehrt dich mehr als dein Siegesgang durch Italien. Die Träne, die ich in deinem Auge zittern sah, ist mehr wert als die edelste Perle deiner Krone. Vergib du mir: ich hatte dir Unrecht getan. Das Glück und dein helles fröhliches Blut haben doch deinem Herzen nicht geschadet. Ich habe dir nie gezürnt: ich habe dich stets geliebt, und mit Schmerzen hab' ich's empfunden, wie unsere Wege immer weiter auseinander gingen. Denn im Grunde gehörst du doch zu mir: näher als zu dem wackeren Witichis: näher als zu dem leiblichen Bruder.»
«Ja, ihr gehört zusammen», sprach Adalgoth, «wie Licht und Schatte.»
«Wir empfinden gleich rasch, gleich feurig», sagte der König.
«Wenn Witichis und Hildebad», fuhr Teja fort, «den geraden Heerweg gingen mit stetem Schritt—uns beide will der ungeduldige Schwung stets wie mit Flügeln durch die Lüfte tragen. Und weil wir so zusammengehören, darum schmerzte es mich, daß du in deinem sonnigen Glück zu glauben schienst: jeder, der nicht lachen könne wie du, sei ein kranker Tor. O mein König und mein Freund, es gibt Geschicke, Schmerzen und Gedanken—wer die einmal getragen, empfunden und gedacht, der hat des Lächelns holde Kunst für immerdar verloren.»
Totila sprach voll ernster Achtung: «Wer so heldenstark wie du jeder höchsten Lebenspflicht genügt, den darf man beklagen, aber nicht schelten, wenn er des Lebens Freuden stolz verschmäht.»
«Und du hast geglaubt, ich grolle deinem Glück oder deiner heiteren Art? O Totila, nicht Groll, ach Wehmut ist's, mit der ich dich und deine Art betrachte. Wie uns ein Kind zu Wehmut rühren kann, das da wähnt, Sonne, Lenz und Leben währen ewig, und Winter, Nacht und Tod nicht kennt. Du vertraust dem Sieg und Glück des Freud'gen in der Welt. Ich aber höre stets den Flügelschlag des Schicksals, das, erbarmungslos und taub für Fluch, Gebet und Dank, dahinrauscht über die Scheitel der Menschen und ihre Werke.» Und er blickte vor sich hin in die Nacht, als erspähe er den Schatten der heranschreitenden Zukunft.
«Ja, ja», sagte der junge Mundschenk, «ähnlich lautete ein alter Spruch, den Iffa auf dem Berge sang, er hatte ihn vom Oheim Wargs gelernt:
‹Auf Glück ist und Unglück
Die Welt nicht gerichtet.
Das haben nur törig
Die Menschen erdacht.
Es will sich ein ewiger
Wille vollenden:
Ihm dient der Gehorsam,
Ihm dient auch der Trotz.›
«Aber», fragte der Jüngling nachdenklich, «wenn wir mit bester Kraft das Unvermeidliche nicht wenden mögen, warum regen wir denn überhaupt die Hände? Warum erwarten wir dann nicht in dumpfem Brüten, was da kommt? Worin ist dann der Unterschied gelegen zwischen Held und Feigling?»
«Nicht im Sieg ist er gelegen, mein Adalgoth! In der Art des Ringens und Tragens! Nicht die Gerechtigkeit entscheidet die Geschicke der Männer und Völker, sondern die Notwendigkeit. Oft schon ist der bessere Mann, das edlere Geschlecht dem Gemeineren erlegen. Wohl ist auch Edelsinn und Edelart eine Gewalt. Aber sie sind nicht immer stark genug gegen die Übermacht anderer dumpfer Gewalten. Edelsinn und Edelart und Heldentum kann immer den Untergang weihen, verherrlichen, nicht aber immer ihn wenden. Und nur das ist der letzte Trost: nicht was wir tragen, wie wir's tragen verleiht die höchste Ehre, und oft gebührt der Lorbeer nicht dem Sieger, mehr dem besiegten Helden.»
Der König stützte sich nachdenklich auf sein Schwert und sah zur Erde. «Wieviel mußt du gelitten haben, Freund», sprach er dann innig, «bis du zu solch schwarzem Irrtum gelangt bist! Du hast ja deinen Gott im Himmel verloren! Mir wäre das viel ärger, als hätte ich die Sonne am Himmel eingebüßt,—als wäre ich erblindet. Ich könnte nicht mehr atmen, ich könnte nicht mehr glauben an den gerechten Gott, der vom Himmelstore aus herabschaut auf die Taten der Menschen, und der die reine, gute Sache zum Siege führt.»
«Und König Witichis, was hatte er verbrochen, der Mann sonder Mal und Makel? Und ich selbst und»... er schwieg.
«Dein Leben ist mir verhüllt seit unserer Trennung in frühester Jünglingszeit»—
«Genug davon für heut'», sprach Teja, «Mehr hab' ich diese Nacht von tief Innerem aufgedeckt als sonst in Jahren. Es kommt wohl noch die Stunde, aufzudecken, was ich erlebt und gedacht. Ich möchte», sagte er, über Adalgoths Locken streichend, «dem jüngsten und besten Sänger unseres Volkes nicht zu früh den hellen Ton seiner Saiten verdüstern.»
«Wohl», sprach der König, aufstehend. «Dein Schmerz ist mir heilig. Aber ich bitte, laß uns die erneute Freundschaft pflegen. Ich gehe morgen nach Taginä zu meiner Braut. Begleite mich—: wenn dich's nicht kränkt, mich glücklich zu sehn mit einer Römerin.»
«O nein—es rührt mich—es mahnt mich an...—Ich gehe mit dir.»—
Bald darauf traf der König mit Graf Teja, Adalgoth und zahlreichem Gefolge in dem Städtlein Taginä ein, oberhalb dessen sich auf steiler, dichtbewaldeter Felshöhe das Kloster der Valerier erhob, in welchem Valeria noch immer ihren Aufenthalt fortsetzte.
Der Ort hatte seine Schauer für sie verloren, nicht nur durch äußere, durch innere Gewöhnung: ihre Seele geriet widerstrebend, aber sicher, unter die Einflüsse der ernsten Mächte dieser Stätte. Als sie dem König bei dessen Eintritt in den Klostergarten entgegenkam, schien ihm ihre Farbe viel bleicher, ihr Gang viel langsamer als sonst.
«Was ist mit dir?» schalt er zärtlich. «Als unser Gelübde fast nicht mehr erfüllbar schien, da hieltest du Mut und Hoffnung hoch. Und nun, da der Geliebte die Krone dieses Reiches trägt und fast nur in einer Stadt noch der Feind den Boden Italiens tritt, jetzt willst du sinken und verzagen?»
«Nicht verzagen, Freund», sprach Valeria ernst. «Aber entsagen. Nein, höre mich nur in Geduld. Weshalb verschwiegst du mir, was ganz Italien von seinem König weiß und wünscht? Der König der Westgoten zu Toledum hat dir sein Waffenbündnis gegen Byzanz und seiner Tochter Hand geboten. Das Reich wünscht und erwartet, daß du beides annimmst. Ich will nicht selbstischer sein, denn jene hochgesinnte Tochter eures Volks, Rauthgundis, des Bergbauern Kind, von der schon eure Sänger singen und sagen auf den Straßen. Und ich weiß: auch du kannst Opfer bringen, wie jener schlichte Mann, der euer glückloser König war.»
«Ich hoffe, daß ich's könnte, müßt' es sein. Zum Glück aber muß es nicht sein. Ich brauche fremde Hilfe nicht. Blick' um dich. Oder vielmehr blick' einmal hinaus über diese Klostermauern. Nie hat das Reich geblüht wie jetzt. Noch einmal biete ich dem Kaiser die Hand zum Frieden. Weist er sie abermals zurück, dann entbrennt ein Kampf, wie er ihn noch nicht gesehn. Bald muß Ravenna fallen:—wahrlich, meine Macht und mein Mut sind nicht zum Entsagen angetan. Die Luft in diesen Mauern hat endlich deine feste Kraft erweicht. Du sollst mir fort von hier:—wähle dir die schönste Stadt Italiens zum Aufenthalt:—laß uns dein Vaterhaus in Neapolis erneuern.»
«Nein. Laß mich hier. Ich liebe nun diesen Ort und seine Ruhe.»
«Es ist die Ruhe des Grabes! Und weißt du wohl, daß dir entsagen dem Gedanken meines Lebens entsagen hieße? Du bist mir das lebendige Sinnbild all meiner Pläne, du bist mir Italia selbst. Du sollst des Gotenkönigs eigen werden: völlig, unentreißbar. Und Goten und Italier sollen sich ihren König und ihre Königin zum Vorbild nehmen: sie sollen eins und glücklich werden wie wir. Nein—keinen Einwand—keinen Zweifel mehr! So erstick' ich ihn.» Und er umarmte und küßte sie.
Einige Tage darauf traf Julius Montanus, von Genua und Urbinum her, ein. Der König ging ihm mit seinem Gefolge vor dem Klostergarten entgegen. Lange hielten sich die Freunde sprachlos umfangen.
Teja stand an ihrer Seite und betrachtete sie mit ernstem Blicke.
«Herr», flüsterte Adalgoth, «wer ist der Mann mit den tiefliegenden Augen. Ein Mönch?»
«Innerlich, nicht von außen!»
«Ein so junger Mann mit dem Blick des Alters. Weißt du, wem er gleich sieht? Dem Bilde dort auf Goldgrund in dem Klostergang.»
«Jawohl: dem sanften, traurigen Haupte dort, dem Apostel Johannes.»
«Dein Brief», sprach Julius, «fand mich schon entschlossen, hierher zu kommen.»
«Du wolltest mich—Valeria—suchen?»
«Nein, Totila: ich kam, mich prüfen und weihen zu lassen von Cassiodor. Der fromme und heilige Mann, der unser Jahrhundert mit seinen Wundern erfüllt, Benedikt von Nursia, hat ein Kloster gegründet, das mich mächtig anzieht.»
«Julius, das darfst du nicht! Welch ein Geist der Flucht aus der Welt hat meine Nächsten ergriffen. Valeria:—du: und Teja.»
«Ich fliehe nichts», sagte dieser, «nicht einmal die Welt.»
«Wie kommst du», fuhr der König fort, den Freund am Arme gegen den Eingang des Klosters führend, «In der Blüte der Jahre zu diesem Gedanken des Selbstmords? Siehe, dort naht Valeria. Sie muß mir helfen, dich bekehren. O hättest du je die Liebe gekannt—du würdest nicht der Welt den Rücken wenden.»
Julius lächelte und schwieg. Ruhig faßte er Valerias freudig gebotene Hand und schritt mit ihr in die Klostertür, wo ihnen Cassiodor entgegenkam.—
Nur mit Mühe gewann die Beredsamkeit des Königs dem Freunde das Versprechen ab, nach einigen Tagen den greisen Cassiodor nach Byzanz zu begleiten. Julius scheute den Glanz, den Lärm, die Sünde des Kaiserhofs, bis endlich das Beispiel Cassiodors ihn überwand. «Ich meine», schloß der König, «man kann in der Welt mehr gottgefällige Werke tun als im Kloster. Ein solches frommes Werk ist diese Gesandtschaft, die zwei Reichen neuen Krieg ersparen soll.»
«Gewiß», sagte Julius. «Der König und Held kann Gott dienen wie der Mönch. Ich tadle deine Art des Dienstes nicht:—laß mir die meine. Und mir ist: diese unsre Zeit, da eine alte Welt unter schweren Schauern versinkt und eine neue unter rauhen Stürmen aufsteigt, da alle Laster des verfaulten Heidentums mit aller Wildheit der Barbaren sich vermischen, da Üppigkeit, Fleischeslust und blut'ge Gewalt das Morgen- und das Abendland erfüllen, da ist es wohlgetan, weltferne Stätten zu gründen, wo Armut, Reinheit und Demut wohnen dürfen.»
«Mir aber scheinen Pracht, Liebesglück und freudiger Stolz keine Sünde vor dem Himmelsgott. Was meinst du von unsrem Streit, Freund Teja?»
«Er hat keinen Sinn für mich», sprach dieser ruhig. «Denn euer Gott ist nicht der meine.»
Am Abend vor der Abreise der beiden Gesandten nach Firmum, wo sie sich nach Byzanz einschiffen sollten, führte Cassiodor die Freunde noch nach einer Kapelle, die er, dicht bei dem Kloster, auf der gerade gegenüber ragenden hohen Felskuppe des nämlichen Berges erbaut hatte. «Es wird dir dort gefallen, mein Totila», hatte Valeria gesagt.
Vor Sonnenuntergang gerade erreichten die Freunde den Gipfel des einsam ragenden, runden Felskopfes. Dieser, mitten in dem Hügelgrund zu steiler Höhe aufsteigend, gewährte den freiesten Anblick über das blühende picentinische Land. Im Norden und Osten begrenzten den Blick die prachtvollen Terrassen des Apennins mit jenen klassischen, stilvollen, großartig ruhigen Formen, wie sie nur der italischen Landschaft eigen. Im Westen schimmerte im Glanz der sinkenden Sonne, wie ein kostbarer goldner Gürtel, durch das Grün der Gefilde der Fluß Clasius, in welchen hier die beiden kleineren, Sibola und Rasina, münden. Im Süden glänzte aus den Bergen von Nuceria her der Tiniafluß durch üppiges Gelände.
Denn unter diesem lachenden Himmel hatte eine reiche Ernte—das Wunderjahr Totilas—die Spuren der früheren Verwüstung und Verödung rasch und völlig verwischt: viele Hunderte von weißen Marmorvillen, von Schlössern, von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden lauschten aus dem Dunkelgrün des Lorbeers, aus dem Silbergrau der Oliven, aus dem endlosen Gerank der Reben. Ein uralter Wartturm, vielleicht aus römischer Zeit, ragte an dem Südabfall des Hangs: dessen Gemäuer sowie der ganze Hügelrücken war von Efeu, Feigen, Wein, Kastanien in reizender Verwilderung überzogen.
Die Sonne aber, die nun rasch versank, warf ein glühendes, dunkelrotes Licht, warf einen Purpurmantel über die weite Ebene, indes auf den fernen Höhenzügen, den plastisch klaren, dem Terrassenbau der italischen Natur, eine violette Duftschicht lag. Überrascht, geblendet standen alle. Niemand fand Worte für so viel Schönheit.
«So was dergleichen ahnte ich in Italia», flüsterte Adalgoth zu Graf Teja, «wann ich vom Iffinger oder gar von der Mentula gen Südwesten sah. Aber es ist doch viel schöner, als ich geträumt.»
Der König aber rief: «Und hab' ich nun nicht recht, Teja, daß ich dies Land liebe wie eine Braut? Daß ich es unserm Volk erhalten will um jeden Preis? Wahrlich, dieser Ort ist die beste Rechtfertigung meines Trachtens! Himmlische Lüfte! Goldenes Licht umschweben die Stätte!——»
Und mit lebhaftem, gerührtem Blick fuhr er fort: «Ja hier, ihr Freunde, hier Cassiodor, will ich dereinst begraben sein!» Und er legte die Rechte auf einen uralten mächtigen Sarkophag von verwittertem, dunklem Marmor, der Deckel desselben lag zerbrochen daneben auf der Erde: wild wuchernder Efeu hatte das Innere des Sarges ganz erfüllt.
«Welch schönes Zusammentreffen», sprach Cassiodorus ernsthaft. «Weißt du, wie dieser Ort seit alters heißt? Spes bonorum, ‹der Guten Hoffnung›. Und weißt du, wer, der Sage nach, in diesem Sarge geruht? Ein anderer weiser, mildseliger Friedensfürst: ursprünglich wohl ein uralter tuskischer König, später hat die Sage des Landvolks Numa Pompilius, den Gütigen, daraus gemacht. Ein uraltes Heiligtum des Friedens, eine Stätte des Segens und der Zuflucht haben schon die Heiden hier verehrt: Meine neugebaute Kapelle habe ich bei dem Ausbruch des Krieges Emanuel dem Friedensgott geweiht. Höchste Ehre würde es meiner kleinen Kapelle, wolltest du, Friedenskönig, sie zu deiner Ruhestätte wählen.»
«Nein», rief Totila, «vergib mir, ehrwürdiger Vater! Nicht in der dumpfen Krypta deines Baues,—hier, unter dem blauen Dach des ausonischen Himmels, hier will ich ruhn»,—und er schlug auf den Sarkophag. «Auf dieser lichten Höhe, umspült vom goldnen Licht, überragt von nickendem Lorbeer, unter der Vögel süßem Gesang. Ich werde mich wohl vertragen mit den Mannen des Friedenskönigs. Hört, ihr meine Freunde, das ist mein Wille. Höre du zumal: dessen Jugend uns alle überleben muß, Adalgoth, mein Liebling!»
«Wer denkt an die Nacht bei heller Mittagssonne!» rief Adalgoth.
«Die Ahnungsvollen», sagte Teja. «Seht, wie rasch die Sonne verschwand und ihr warmes, freudiges Goldlicht. Eine Purpurdecke, wie ein rotes, blutiges Leichentuch, deckt schon das Tal von Taginä. Und die veilchenblauen Schatten sind schon kaltes Schwarz geworden und fallen plötzlich herein! So rasch! Und rascher noch, als in diesem Land die Nacht, bricht ein, in allen Ländern, das Schicksal und der Tod.»
An dem gleichen Abend, da Adalgoth im Gefolge des Königs die Sonne sinken sah über das mittelitalische Land auf der Spes bonorum, stand auch in schimmervollem Sonnenuntergang auf dem Südabhang des Iffingerberges auf ihren Stab gelehnt Gotho, die Hirtin.—
Um sie her hüpften und weideten die Schafe und drängten sich allmählich müde zusammen um die Hüterin, der Heimkehr nach dem Sennhaus gewärtig und begierig.
Aber sie harrten und blökten umsonst.
Denn das schöne Kind beugte sich von moosigem Stein an dem Rand des silberklaren Gebirgsquells emsig vor: in ihrer Lederschürze lagen gehäuft die schönen, würzig duftenden Blumen der Berghalde: der Thymian, die Wegrose, die Minze, die am feuchten Saume des Rinnsals sprießt, und der tiefblaue Enzian. Und sie sann und sprach mit sich selbst und mit ihren Blumen und den hurtig enteilenden Wellen. Und sie warf die Blumen in den rinnenden Quell: bald einzeln, bald kleine Sträuße und halbfertige Kränze.——
«Wie viele», sagte das Kind vor sich hin in die Wellen und warf die langen, gelben Zöpfe über die Schultern, «wie viele von euch hab' ich schon ausgesendet, ihn zu grüßen! Denn nach Süden ist er gezogen, und nach Süden hinab rinnen diese schnellen Wasser. Aber ich weiß nicht, ob ihr's bestellt:—denn er ist immer noch nicht heimgekommen. Ihr aber, wie ihr euch hebt und senkt im Tanz der Wellen, ihr winket mir, euch zu folgen. Ja, wer euch folgen könnte! Oder den Fischlein, die da hinabschießen wie dunkle Pfeile! Oder den flinken Bergschwalben, die durch die Luft schwirren, frei wie die Gedanken! Oder den rotbeschwingten Abendwolken, wenn sie der Bergwind rasch gen Süden trägt!
Aber am sichersten fände ihn freilich das Herz der Sucherin selber, dürft' ich, die Halde verlassend, ihm folgen ins ferne, ins sonnige Land.——
Jedoch was sollte ich da unten? Die Hirtin unter den Männern des Krieges, unter den klugen Frauen des Hofs! Und ich seh' ihn ja doch wieder! So sicher ich die Sonne doch wiedersehe, ob sie verschwand hinter jenen Bergen. Man weiß, man sieht sie wieder. Und dennoch:—Sehnsucht füllt die Zeit von ihrem Scheidestrahl bis zu ihrem Wiedergruß.»
Da tönte vom Sennhaus her ein weit vernehmlicher, rauher Schall: ein Stoß in das gewundne Widderhorn.
Gotho sah auf: es war dunkler geworden, sie sah schon durch die offne Tür das rote Herdfeuer glühn. Die Schafe erwiderten das wohlbekannte Zeichen mit lauterem Blöken, die Köpfe gegen das Sennhaus und die Ställe reckend. Der braune, zottige Hund sprang bellend, mahnend an ihr hinauf.
«Ich gehe schon», lächelte sie, die Mahner beschwichtigend. «Ach, eher werden die Schafe der Weide satt, als die Schäferin ihrer Gedanken. Nun vorwärts, Weiß-Elbchen! Jetzt bist du schon stattlich!»
Und sie schritt den Hang hinab, der Talmulde zwischen den beiden Berghäuptern zu, in der das Haus und die Ställe Schutz fanden vor Wind und Lawinen. Hier blendete nicht mehr der Glanz der Sonne. Schon wurden die Sterne sichtbar. Sie sah innig zu ihnen hinauf. «Sie sind so schön, weil er so oft sie anblickt.»
Da schoß ein Stern und fiel rasch gegen Süden.
«Er ruft mich! Dorthin», sprach Gotho zusammenbebend. «Wie gern würd' ich ihm folgen!»
Und rascher trieb sie die Schafe an, versorgte sie in dem Stalle und schritt in das große, einzige Gemach des Erdgeschosses im Wohnhaus.
Da fand sie den Großvater Iffa ausgestreckt auf dem Steinsims nahe an dem Herdfeuer, die Füße zugedeckt mit zwei großen Bärenfellen. Er sah bleicher und älter als sonst aus.
«Setze dich hier neben mich, Gotho», sagte er, «und trink, hier ist Milch mit Honig gemischt, und höre mir zu. Die Zeit ist nun gekommen, von der ich dir lange gesagt. Wir müssen scheiden. Ich fahre heim. Vor meinen müden, alten Augen flimmert kaum noch trüb dein liebes Angesicht. Und als ich gestern noch selbst zum Quell hinuntersteigen wollte, Wasser zu schöpfen, brachen mir die Knie.—Da spürte ich: es ist nahe.
Und ich schickte den Gaisbuben hinüber nach Teriolis mit Botschaft. Du aber sollst nicht zugegen sein, wann die Seele aus des alten Iffa Munde fährt. Es ist nicht schön, das Menschensterben—ich meine den Strohtod. Und du hast noch nichts Trauriges gesehn. Der Schatten soll nicht fallen auf dein junges Leben.
Morgen vor Hahnenkraht kommt der tapfre Hunibad herüber von Teriolis, dich abzuholen er hat mir's zugesagt. Zwar noch nicht sind seine Wunden ausgeheilt:—er ist noch schwach—aber er sagt, es läßt ihn nicht mehr in Muße liegen, da, wie es heißt, der Kampf bald wieder losgeht mit den Feinden.
Er will zu König Totila nach Rom. Und dahin mußt auch du mit wichtiger Botschaft. Und er soll dein Wegschirmer und Wegführer sein.
Binde feste Sohlen aus Buchenrinde unter deine Füße: denn weit ist dein Weg. Und Brun, der Hund, mag euch beide begleiten. Und nimm die Tasche dort aus starkem Ziegenleder, darin sind sechs Goldstücke noch von Adalgoths—von eurem Vater. Sie sind Adalgoths,—aber du darfst schon davon gebrauchen—sie werden reichen bis Rom.
Und nimm dir ein Bündel duftigen Bergheus vom Iffinger-Hang mit und lege nachts den Kopf darauf, so wirst du besser schlafen.
Und hast du nun Rom gefunden und das goldene Haus des Königs darin, und trittst du ein in seinen Saal, so siehe, welcher der Männer einen goldnen Reif um die Stirne trägt und von wessen Brauen es milde niederglänzt wie Morgenlicht von den Berghöhen:—der ist dann König Totila.
Und dann beuge das Haupt vor ihm,—aber nur ein wenig, und nicht die Knie: denn du bist eines freien Goten freies Kind. Und dann übergibst du dem König diese Rolle, die ich hier seit vielen Sommern getreulich verwahrt:—sie ist von Oheim Wargs, den der Berg begraben hat.»
Und der Alte hob einen Ziegel aus dem steinernen Unterbau, der den Herdsockel mit dem hart gestampften Erdboden verband, und holte aus dem dunkeln Raum eine Papyrusrolle hervor, die, sorgfältig verschnürt und versiegelt, in ein gleichfalls beschriebenes und mit seltsamen Siegeln darüber gefestigtes Pergament geschlagen war.
«Hier», sagte er, «dies Geschreibsel wahre gut. Dies Äußere, was da auf der Eselhaut steht, das hab' ich dem langen Hermegisel drüben in Majä, der schreiben kann, vorgesprochen, zu schreiben. Er hat mir geschworen, davon zu schweigen, und er hat's gehalten. Nun kann er gar nicht mehr reden unter dem Kirchengang hervor, wo sie ihn begraben.
Du aber und Hunibad—ihr könnt nicht lesen. Und das ist gut. Denn gefährlich könnt' es werden für dich und—einen andern, wenn früher, bevor der milde und gerechte König Totila davon erfährt, die Leute erführen, was die Rolle da weiß. Zumal vor den Welschen birg die Rolle. Und frage in jeder Stadt, wo du einziehst, ob sie berge Cornelius Cethegus Cäsarius, den Präfekten von Rom.
Und sagen die Torwächter ja,—dann wende dich auf dem Absatz und, wie müde du bist und so spät schon die Nachtstunde oder so glühheiß der Mittag,—wandre davon, bis du drei Wasser zwischen dir hast und dem Mann Cethegus.
Und nicht minder als dies Geschreibsel—du siehst, ich drückte statt des Siegels Baumharz darauf, wie es aus den Tannen träuft, und unsre Hausmarke ritzt' ich drein, wie sie unser Vieh und unsre Fahrnis trägt—nicht minder wahre dies alte, teure Gold.»
Und er langte aus dem Hohlraum die Hälfte eines breiten Goldreifs, wie sie die Gotenhelden um die nackten Arme trugen. Ehrfurchtsvoll küßte er das Gold und die unvollständige Runenschrift darauf. «Das stammt noch von Theoderich, dem großen König, und von ihm—meinem teuren—Sohne Wargs. Merke:—das gehört Adalgoth. Und ist sein allerbestes Erbe. Die andre Hälfte des Ringes—und des Spruches darauf—hab' ich dem Knaben mitgegeben, da ich ihn fortgesandt. Und hat der König das Geschreibsel gelesen, und ist Adalgoth in der Nähe,—wie er sein muß, wenn er meine Gebote befolgt—dann rufe, Adalgoth herbei, und füget Halbring an Halbring und heischet des Königs Spruch.
Er soll klug und klar und mild und alldurchschauend sein, wie der Sonnenschein. Er wird den rechten Spruch finden. Findet er ihn nicht, dann findet ihn keiner. Nun lege mir noch einen Kuß auf jedes meiner sehemüden Augen. Und nun gehe bald zum Frühschlaf. Und der Himmelsfürst und alle seine lichten Augen, Sonne, Mond und Sterne, mögen schauen auf deinen Weg.
Und hast du Adalgoth gefunden, und lebst du mit ihm in den kleinen Gemächern der dumpfen Häuser, in den engen Städtestraßen, und wird es euch dort unten zu klein und zu dumpf und zu eng,—dann denkt an eure Kindertage hier auf dem hohen Iffing. Und es wird euch anwehn wie frische Bergluft.»
Schweigend, ohne Widerrede, ohne Furcht, ohne Frage hörte und gehorchte das Hirtenkind. «Fahr wohl, Großvater!» sagte sie, ihn auf die Augen küssend. «Dank für viel Lieb' und Treue.»
Aber sie weinte nicht. Sie wußte nicht, was Sterben ist.
Und sie trat von ihm weg auf die Schwelle des Sennhauses: und sie blickte hinaus in die nun tiefernst gewordne Berglandschaft. Klar war der Himmel, die Gipfel der Berge ringsum glänzten im Mondlicht. «Lebt wohl», sprach sie, «du Iffinger und du, Wolfshaupt! Und du, alter Riesenkopf! Und du da drunten, hell aufschimmernde Passara! Wißt ihr's schon? Morgen gehe ich von euch allen. Aber ich gehe gern. Denn ich gehe zu ihm!»
Und nach vielen Wochen kamen Cassiodor und Julius zurück von Byzanz und brachten—keinen Frieden.
Cassiodor ging sogleich nach der Landung zu Brundisium, welt- und wegemüde, in sein apulisch Kloster, Julius allein die Berichterstattung an den König in Rom überlassend. Totila empfing ihn auf dem Kapitol, im Beisein der ersten Heerführer.
«Anfangs», erzählte dieser, «waren die Aussichten günstig genug. Der Kaiser, der früher gotische Gesandte von Witichis gar nicht vor sein Angesicht gelassen, konnte dem größten Gelehrten des Abendlandes, konnte Cassiodors Weisheit, Frömmigkeit und Milde seinen Palast nicht verschließen. Wir wurden ehrenvoll und freundlich empfangen. Gewichtige Stimmen, so Tribonianus und Prokopius, sprachen für den Frieden im Rate des Imperators, der selbst dazu geneigt schien.
Seine beiden großen Feldherrn, Narses und Belisar, beschäftigten zugleich an verschiedenen Punkten der stets bedrohten Ostgrenze des Reichs die Kämpfe mit Persern und mit Sarazenen. Die Unternehmungen in Italien und Dalmatien aber hatten so große Opfer gekostet, und so lange Zeit gewährt, daß dem Kaiser der Gotenkrieg verleidet war.
Zwar gab er den Gedanken der Wiedergewinnung Italiens wohl schwerlich ganz auf. Aber er erkannte die Unmöglichkeit der Durchführung für die nächste Zukunft. Er ging daher gern auf die Friedensverhandlungen ein und nahm unsere Vorschläge zur Erwägung entgegen: ihm schwebte zunächst freilich noch, wie er uns sagte, eine vorläufige Teilung der Halbinsel bis an den Padus vor: das weitaus größte Stück des Landes im Süden dieses Flusses sollte dem Kaiser, das Gebiet im Norden den Goten zufallen.
Mit guten Aussichten hatten wir eines Mittags den Kaiser und den Palast verlassen. Die Audienz war günstiger ausgefallen als alle früheren. Aber am Abend des gleichen Tages wurden wir überrascht durch den Curopalata Marcellus, der uns von den Palastsklaven die üblichen Abschiedsgeschenke überreichen ließ:—das unverkennbare Zeichen des Abbruchs der Verhandlungen.
Bestürzt über diese plötzliche Wendung», fuhr Julius in seinem Bericht fort, «beschloß Cassiodor gleichwohl, um des Friedenswerkes willen, das Äußerste zu wagen: nämlich, nach Überreichung der Abschiedsgeschenke, nochmal Gehör bei dem Kaiser zu suchen. Der hochangesehene Tribonianus, von jeher ein Gegner dieses Kriegs und Cassiodors verehrungsvoller Freund, ließ sich bewegen, für uns um diese unerhörte Gnade nachzusuchen.
Die Antwort war die höchst ungnädige Drohung der Verbannung, wenn er noch einmal gegen den klar angedeuteten kaiserlichen Willen etwas erbitten werde. Nie, niemals werde der Kaiser mit den Barbaren Frieden schließen, bis sie nicht jede Scholle des Reiches verlassen. Nie werde er die Goten in Italien anders denn als Feinde betrachten.
Vergebens bemühten wir uns», schloß Julius seine Erzählung, «eine Ursache des plötzlichen Umschwungs zu entdecken. Nur das erfuhren wir, daß nach unserer Mittags-Audienz die Kaiserin, die jetzt vielfach leidend sein soll, ihren Gemahl zur Tafel in ihre Gemächer geladen. Aber es steht fest, daß die Kaiserin, früher bekanntlich die eifrigste Schürerin des Krieges, seit geraumer Zeit nicht mehr für den Kampf, sondern für den Frieden sprach.»
«Und was», fragte der König, der ernst, aber eher drohend als besorgt, der Erzählung zugehört hatte—«was verschafft mir die Ehre einer solchen Umstimmung der Zirkusdirne?»
«Man flüstert, für ihr Seelenheil immer mehr besorgt, will sie alle Geldmittel nicht mehr auf den Krieg verwendet wissen, dessen Ausgang sie kaum noch zu erleben hofft, sondern auf Kirchenbauten, zumal auf Vollendung der Sophienkirche—mit deren Grundriß auf der Brust will sie begraben sein.»
«Wohl als mit ihrem Schild gegen den Zorn des Herrn bei der Auferstehung der Toten! Die Dirne will den lieben Gott mit den hundert Kirchen entwaffnen und mit den bezahlten Kostenrechnungen bestechen. Welchen Wahnsinn brütet dieser Glaube aus», sprach finster für sich Teja.
«Und so fanden wir keinerlei Spur. Denn keine Spur darf ich es nennen, was nur wie ein Schatten, obendrein vielleicht eines Irrtums Schatten, an mir vorüberhuschte.»
«Was war das?» forschte Teja aufmerksam.
«Als ich spät abends den Palast verließ, Tribonians ungünstigen Bescheid bei mir erwägend, ward eine vergoldete Sänfte der Kaiserin von deren kappadokischen Sklaven rasch von dem Viereck der Gärten her—das ist Theodoras Palast—an mir vorübergetragen. Der vergitterte Laden ward etwas in die Höhe geschoben von dem Getragenen—ich sah hin, und es war mir, als erkenne ich...—»
«Nun?» fragte Teja.
«Meinen unsel'gen väterlichen Freund, den verschollnen Cethegus», schloß Julius traurig.
«Schwerlich», meinte der König. «Er ist gefallen. Es war wohl Täuschung, daß Teja in seinem Hause noch seine Stimme zu vernehmen glaubte.»
«Ich diese Stimme mißkennen! Und sein Schwert, das Adalgoth an der Straßenecke fand?»
«Kann früher, kann bei dem Forteilen des Mannes nach dem Tiber aus seinem Hause verloren sein. Deutlich sah ich ihn dort auf seinem Schiff die Verteidigung leiten. Der Speerwurf gegen meinen Hals war mit des Hasses bester Kunst und Kraft geführt. Ich traf ihn, ich sah's, mit dem zurückgeschleuderten Speer. Auch sagte mir Gundhamund, der treffliche Schütz, er sei gewiß, ihn getroffen zu haben am Halse. Man fand am Fluß seinen purpurgesäumten Mantel, von vielen Pfeilen durchlöchert und von Blut ganz überströmt.»
«Er ist wohl dort gestorben», sprach Julius tiefernst.
«Seid ihr so gute Christen», fragte Teja, «und wißt nicht, daß der Teufel unsterblich ist?»
«Mag sein», sprach der König, «aber auch das Licht!» Und mit drohenden Brauen fuhr er fort: «Auf, mein tapfrer Teja, jetzt gibt es neue Arbeit für dein Schwert. Hört, Herzog Guntharis, Wisand, Grippa, Markja, Aligern, Thorismut, Adalgoth: bald hab' ich vollauf zu schaffen für euch alle. Ihr habt's vernommen: Kaiser Justinian verweigert uns den Frieden und Italiens ruhigen Besitz. Offenbar darum, weil er uns für zu friedlich hält. Er meint, es könne ihm nie schaden, uns zu Feinden zu haben. Schlimmstenfalls säßen wir ruhig, seine Angriffe abwartend, in Italien. Und Byzanz könne jederzeit den Augenblick wählen, uns anzugreifen, sooft den Versuch wiederholend, bis er gelingt. Wohlan: zeigen wir ihm, daß wir als unversöhnliche Feinde gefährlich werden können, daß es wohl geraten sein mag, uns Italien friedlich zu belassen, um uns nicht zum Angriff zu reizen.
Er will uns nicht in Italien leben lassen? Wohlan, er soll die Goten wieder, wie unter Alarich und Theoderich, im eignen Lande sehen. Einstweilen nur dies: denn das Geheimnis ist der Mutterschoß des Siegs: auf linnenen Flügeln, auf hölzernen Brücken dringen wir, wie in Rom, in das Herz des Ostreichs ein. Jetzt, Justinianus, schirm' den eignen Herd!»
Geraume Zeit, nachdem die Abweisung der Friedensvorschläge nach Rom gelangt war, finden wir in dem Speisegemach eines einfach, aber geschmackvoll gebauten und eingerichteten Hauses auf dem Forum Strategii zu Byzanz, das, nahe gelegen dem unvergleichlichen Küstensaum des «goldnen Horns», den Blick über die Meerenge hin und auf die jenseitige, prachtvoll angelegte Neustadt «Justiniana» gewährte, zwei Männer in vertrautem Gespräch.
Der Herr des Hauses war unser alter—und hoffentlich nicht unlieber—Bekannter Prokopius, der nunmehr in hohem Ansehen als Senator zu Byzanz lebte.
Er schenkte seinem Gast eifrig ein, aber er bediente sich dabei der linken Hand. Der rechte Arm verlief in einen verhüllten Stumpf.
«Ja», sagte er, «bei jeder Bewegung mahnt mich der fehlende rechte Vorderarm an eine Torheit. Zwar bereue ich die Torheit nicht: ich folgte ihr abermals, und kostete es die Augen aus dem Kopf. Sie war eine Torheit des Herzens. Und eine solche zu haben ist des Menschen größtes Glück. Zu Frauenliebe hab' ich's nie recht gebracht. Meine Liebe heißt und hieß: Belisarius! Ich erkenne recht gut—du brauchst nicht so höhnisch den Mund zu verziehn, Freund—ich durchschaue recht gut die Schwächen und Unvollkommenheiten meines Helden. Aber das ist gerade das Süße an der Herzenstorheit: sie liebt die Fehler des Geliebten mit, ja mehr als andrer Leute Vorzüge.
Und so denn—um's kurz zu machen—warnte ich bei dem letzten Perserkrieg den Mann mit dem Löwenmut und mit dem Kindesherzen wieder einmal, mit geringer Bedeckung durch einen unsichren Wald zu reiten. Bei Dara war's. Natürlich tat er's nun erst recht, der dumme, liebe Tor. Und natürlich ritt Prokopius, der kluge Tor, nun auch mit. Und es kam alles, wie ich vorausgesehen und gesagt. Der ganze Wald ward auf einmal lebendig von lauter Persern. Es war, als schüttelte der Wind sein dürres Laub von den Wipfeln. Aber alle Blätter waren Pfeile und Speere.
Es ging wieder ganz wie vor dem tiburtinischen Tor. Balan, der treue Scheck, tat dort seinen letzten Sprung. Gespickt von Speeren brach er tot zusammen. Ich hob den Helden auf mein eigen Roß. Dabei hieb aber ein Perserfürst, der fast so lang war wie sein Name—Adrastaransalanes hieß der liebe Mann—auf den Magister Militum einen Hieb, den ich in der Eile nur mit dem rechten Arm auffangen konnte—: denn mein Schild deckte den Feldherrn gegen einen Sarazenen. Der Hieb war gut: traf er Belisars helmloses Haupt—es wäre gespalten gewesen wie eine Klaffmuschel. So schnitt er mir nur den Vorderarm so haarscharf ab, als wär' er nie angewachsen gewesen.»
«Belisarius natürlich entkam, und Prokopius natürlich ward gefangen», sagte der Gast kopfschüttelnd.
«Beides richtig, o du Gebietiger des Scharfsinns, wie dich mein Freund Adrastaransalanes nennen würde. Aber derselbe Mann mit dem langen Leibe, Säbel und Namen—auf dessen Wiederholung du nicht bestehen wirst—war so gerührt von meiner ‹elefantenhaften Großherzigkeit›, wie er sich ausdrückte, daß er mich alsbald ohne Lösegeld freiließ: nur einen Ring, der an einem Finger meiner ehemaligen rechten Hand steckte, erbat er sich: zum Andenken, wie er sagte.
Seitdem ist es mit meinen Kriegsfahrten vorbei», fuhr Prokop ernster fort. «Ich erblicke aber in dem Verlust der Schreibhand auch eine Strafe. Ich habe manches unnütze oder nicht ganz aufrichtige Wort damit geschrieben. Freilich: träfe gleiche Strafe alle Schriftsteller von Byzanz, es gäbe keinen zweiarmigen Menschen mehr, der schreiben kann. Es geht nun etwas langsamer mit dem Schreiben und müheschwerer. Und das ist gut. Man überlegt dann länger bei jedem Wort, ob es der Mühe lohnt, und ob es zu rechtfertigen ist, es niederzuschreiben.»
«Ich habe mit wahrem Genuß», sagte der Gast, «deinen Vandalenkrieg, Perserkrieg und, soweit er vollendet ist, den Gotenkrieg gelesen. Es war bei meiner langwierigen Heilung mein Lieblingsbuch. Aber mich wundert, daß du nicht zu unsrem Freunde Petros, zu den ultziagirischen Hunnen und den Bergwerken von Cherson, geschickt wurdest. Wenn Justinian die Urkundenfälschung so schwer bestraft,—wie schwer muß er erst die Wahrhaftigkeit in Geschichtsurkunden strafen! Und du hast seinen Wankelmut, seinen Geiz, seine Fehlgriffe in Wahl der Feldherrn und Beamten so schonungslos gegeißelt:—mich wundert, daß du noch ungestraft bist.»
«Oh, ich bin nicht ungestraft», sprach grimmig der Historiker. «Er ließ mir den Kopf, aber er wollte mir die Ehre nehmen. Und noch mehr sie, diese schöne Teufelin. Denn ich hatte angedeutet, daß Justinian ganz in ihrem Gängelbande geht. Und gleich leidenschaftlich will sie diese Herrschaft fortsetzen und—verbergen. So ließ sie mich kommen, als meine Bücher erschienen waren.
Als ich eintrat und diese Blätter auf ihrem Schoße liegen sah, dachte ich: Adrastaransalanes nahm die Hand, die es geschrieben, dies Weib nimmt den Kopf, der es gedacht. Aber sie begnügte sich, mir von der Kline her den kleinen goldnen Schuh zum Kusse darzureichen, lächelte sehr schön und sprach: ‹Du schreibst griechisch wie kein andrer, Prokopius, in unsrer Zeit. So schön und so wahr! Man hat mir geraten, dich zu den stummen Fischen im Bosporus zu versenken. Aber der Mann, der am besten die Wahrheit sagte, wo sie uns bitter klang, wird auch die Wahrheit sagen, wo sie uns lieblich klingt.
Der beste Tadler Justinians wird sein bester Lobredner werden. Deine Strafe für dein Buch über Justinians Kriegswerke sei—ein Buch über Justinians Friedenswerke.
Du schreibst im kaiserlichen Auftrag ein Buch über des Kaisers Bauwerke. Du kannst nicht leugnen, daß er darin Großartiges geleistet hat. Wärest du ein besserer Jurist, als dich dein Lagerleben bei dem großen Belisar hat leider werden lassen,—du müßtest sein großartigstes Mosaikbauwerk, seine Pandekten, schildern. Aber dazu reicht deine Rechtsausbildung nicht aus, tapfrer Schildknappe Belisars. (Und sie hatte recht, der schöne Dämon!) Du wirst also die Bauwerke Justinians schreiben, du selbst ein lebend Denkmal seiner Großmut. Denn du wirst gestehn, für viel gelindre Dinge hat unter früheren Kaisern mancher Schriftsteller Augen, Nase und anderes verloren, was nicht angenehm zu entbehren ist. Solche Dinge hat sich noch kein Imperator sagen lassen und den Freimut obenein durch neue Aufträge belohnt. Sollten dir aber freilich die ‹Bauwerke Justinians› nicht gefallen, so würdest du diese Geschmacklosigkeit nicht lange überleben, besorge ich—die Heiligen würden solchen Undank durch raschen Tod bestrafen. Sieh, diese Belohnung habe ich dir ausgewirkt, Justinian wollte dich nur zum Senator ernennen—damit du doch recht behältst mit deiner Behauptung von Theodoras verderblichem und allbeherrschendem Einfluß.›
Und nochmals ein Kuß ihres Fußes, wobei sie mir, mutwillig schäkernd, den kleinen, goldnen Schuh auf den Mund schlug.—Ich hatte vor der Audienz mein Testament gemacht. Nun siehst du also, wie dieser Dämon in Weibergestalt sich an mir rächt! Man kann ja wirklich die Bauten Justinians nicht schelten: man kann sie nur verschweigen oder—loben.
Schweige ich, kostet's mein Leben. Rede ich und lobe ich nicht, kostet's mein Leben und meine Wahrhaftigkeit. Ich muß also loben oder sterben. Und so schwach bin ich», seufzte der Hausherr, «daß ich lieber lobe und lebe.»
«Soviel Thukydides und Tacitus genossen—trocken und flüssig» sprach der Gast und schenkte beide Becher voll—«und doch kein Thukydides oder Tacitus geworden.»
«Ich ließe mir lieber die linke Hand auch noch abhauen von meinem langnamigen Freund, als diese Bauwerke damit zu schreiben!»
«Behalte die Hand! Und schreibe mit derselben, nach der offnen Lobschrift der Bauwerke:—eine Geheimschrift der Schandwerke Justinians und Theodoras.»
Prokopius sprang auf. «Das ist teuflisch! Aber groß! Der Rat ist deiner würdig, Freund. Dafür schenke ich dir eine der neun Musen des Herodot in meinem Keller—mein ältester, lauterster, edelster Trank.—Oh, man soll staunen über diese Geheimschrift. Das Unglück ist nur: ich kann das Äußerste von Mord und Schmutz gar nicht erzählen. Der Ekel brächte mich um. Und man wird schon das, was ich erzählen kann, für maßlos übertrieben halten. Und was wird die Nachwelt sagen von Prokopius, der ihr einen Panegyrikus, eine Kritik, und eine Klagschrift über Justinian überliefert?»
«Sie wird sagen: er war der größte Geschichtsschreiber, aber auch der Sohn und das Opfer des Kaiserreichs Byzanz. Räche dich, sie ließ dir deinen gescheiten Kopf und deine linke Hand: wohlan, deine Linke soll ja nicht wissen, was vordem deine Rechte schrieb. Zeichne das Bild dieser Kaiserin und ihres Gatten für alle kommenden Geschlechter auf! Dann haben nicht sie gesiegt mit ihren Bauwerken, sondern du mit deiner Geheimgeschichte. Den maßvollen Freimut wollte sie strafen: nun strafe du sie durch maßlose Enthüllung der Wahrheit. Jeder rächt sich durch seine Waffe: der Stier durch das Horn, der Krieger durch das Schwert, der Schriftsteller durch die Feder.»
«Zumal», sprach Prokop, «wenn ihm nur die Linke blieb. Ich danke und folge deinem Rat. Cethegus: ich werde als Rache für die Bauwerke die ‹Geheimgeschichte› schreiben. Aber nun ist das Erzählen an dir. Ich weiß den Gang der Dinge durch Briefe und mündlichen Bericht der aus Rom Entflohenen oder von Totila freigegebenen Legionäre bis zu der Stunde, da du zuletzt in deinem Hause gesehen, ja, wie man sagt, in deinem Hause gehört wardst. Erzähle nun, du Stadtpräfekt ohne Stadt.»
«Sogleich», sprach Cethegus. «Sage mir nur noch: wie ging es mit Belisarius weiter in dem letzten Perserfeldzug?»
«Nun, wie gewöhnlich. Das solltest du gar nicht mehr fragen müssen! Belisar hatte die Feinde wirklich geschlagen und war eben daran, den Perserkönig Chosroës, des Kabades Sohn, zu dauerndem Frieden zu nötigen. Da erschien in seinem Lager Areobindos, der Schneckenprinz, mit einem hinter Belisars Rücken zu Byzanz bewilligten Waffenstillstand auf ein halbes Jahr. Justinian hatte längst Verhandlungen mit Chosroës angeknüpft. Er brauchte gerade Geld; er stellte sich wieder, als ob er Belisarius nicht traue, und ließ für fünfhundert Zentner Gold den Perserkönig entschlüpfen, als wir eben das Netz über ihn zusammenschlagen wollten.
Narses war klüger. Als der Schneckenprinz zu ihm kam, auf den sarazenischen Teil des Kriegsschauplatzes, erklärte er: der Bote müsse ein Fälscher oder verrückt sein, nahm ihn gefangen und führte den Krieg fort, bis er die Sarazenen völlig geschlagen hatte. Dann schickte er den kaiserlichen Boten mit einer Entschuldigung nach Byzanz. Die beste Entschuldigung aber waren die Schlüssel und Schätze von siebzig Burgen und Städten, die er dem Feind während des von Belisar befolgten Waffenstillstands entrissen hatte.»
«Dieser Narses ist...—»
«Der größte Mensch der Zeit», sagte Prokop. «Auch den Präfekten von Rom nicht ausgenommen. Denn er will nicht, wie dieser, das Unmögliche.—Wir aber, das heißt Belisar und der Krüppel Prokop, wir kehrten, immer grollend und scheltend und immer pudeltreu und nie gewitzigt, den Waffenstillstand mit Zähneknirschen einhaltend, nach Byzanz zurück. Und harren nun hier neuer Aufträge, Lorbeern und Fußtritte. Glücklicherweise hat Antonina ihre Neigungen für Blumen und Verse anderer Männer aufgegeben, und so lebt denn das Ehepaar, der Löwe und die Taube, ganz glücklich hier in Byzanz. Belisar natürlich Tag und Nacht nur sinnend, wann er wieder seinem Kaiserlichen Herrn seine Treue und Heldenschaft bewähren darf—Justinian ist seine Torheit wie die meine Belisar. Nun aber endlich erzähle du.»
Cethegus tat einen tiefen Zug aus dem vor ihm stehenden Becher, der in getriebenem Golde einen Turm darstellte.
Er war wesentlich verändert seit jener Nacht zu Rom.
Schärfer waren die Furchen an den Schläfen, noch fester geschlossen der Mund, die Unterlippe herb emporgehoben, seltener spielte jenes ironische Lächeln um die Mundwinkel, das ihn verjüngte und verschönte. Die Augen waren nun gewöhnlich halb geschlossen.
Nur manchmal öffneten sie sich voll, den gefürchteten Blick zu sprühen, der noch grimmiger durchbohrend traf.
Nicht älter, aber eiserner, schärfer, schonungsloser noch schien er geworden.
«Du kennst», hob er an, «den Lauf der Dinge bis zum Fall von Rom. Ich sah in jener Nacht fallen die Stadt, das Kapitol, mein Haus, meinen Cäsar. Der krachende Sturz dieses Bildes schmerzte brennender als die Pfeile der Goten und selbst der Römer.
Die Sinne schwanden mir vor Schmerz und Zorn, als ich den Mörder meines Cäsar strafen wollte. Ich brach in der Bibliothek an der Statue des Zeus zusammen.
Ich erwachte wieder durch den kühlen Hauch der Nachtluft und des Tiberstromes, der schon einmal,—vor zwanzig Jahren!—den Todwunden neu belebt.»
Eine finstre Wolke zog über die mächtige Stirn.
«Davon ein andermal vielleicht—vielleicht auch nie», sprach er, eine Frage seines Wirtes abschneidend.
«Diesmal hatten mich gerettet Lucius Licinius—sein Bruder ist für Rom und mich gefallen—und der treue Maure, der wie durch ein Wunder dem schwarzen Wüterich Teja entgangen war. Zur Vordertüre von diesem hinausgeschleudert—in seiner Gier, den Herrn zu erreichen, nahm sich der Barbar nicht die Zeit, den Diener zu morden—eilte er an die Hintertüre. Dort traf er auf Lucius Licinius, der, von mir getrennt durch die Volkshaufen, erst jetzt mein Haus von der Seitengasse her erreichte.
Beide eilten nun durch die geöffneten Türen auf der Spur meines Blutes bis in den Zeussaal mir nach.
Dort fanden sie mich bewußtlos: und hatten gerade noch Zeit, mich in meinem Mantel wie eine leblose Ware zum Fenster hinaus in den Hof hinabzulassen. Syphax war zuerst hinabgesprungen und fing mich im Herabgeiten auf aus den Händen des Tribuns. Dieser sprang nach, und rasch trugen sie mich in meinem Mantel aus der Hintertür des brennenden Hauses hinab an den Fluß.
Dort war es nun ziemlich leer. Denn alle Goten und die gotenfreundlichen Römer waren dem König auf das Kapitol gefolgt, dort den Brand zu löschen. Er hatte ausdrücklich befohlen—ich hoffe zu seinem blutigen Verderben!—alle Nichtkämpfenden zu verschonen und nicht zu behelligen. So ließ man denn auch meine beiden Träger überall durch mit ihrer Last. Man glaubte, sie trügen einen Toten.
Und sie glaubten es selbst eine Zeitlang.
Im Fluß fanden sie einen leeren Fischerkahn voller Netze. Sie legten mich hinein, Syphax warf meinen blutigen Mantel mit dem purpurnen Abzeichen des ‹princeps Senatus› auf das Ufer, die Feinde zu täuschen, bedeckten mich mit Segeltüchern und Netzen und ruderten den Fluß hinab, durch die noch immer brennenden Nachen hindurch. Hinter diesen erwachte ich: Syphax wusch mir die Stirn mit Tiberwasser.
Mein erster Blick fiel auf das brennende Kapitol.
Sie sagen, mein erster Ruf war: ‹Umkehren! Das Kapitol!› Und mit Gewalt mußten sie den Fieberwirren halten. Mein erster klarer Gedanke natürlich war: ‹Wiederkehr! Wiedervergelten! Wiedergewinnung Roms!›
Im Hafen Portus trafen wir ein italisches Getreideschiff. Darauf waren sieben Ruderer. Meine Retter hielten an dem Schiff, sich Brot und Wein zu erbitten. Denn beide waren auch verwundet. Da erkannten mich die Ruderer.
Einer wollte mich gefangen den Goten ausliefern, hoher Belohnung gewiß.—Aber die andern sechs waren alte Schanzarbeiter von mir an dem Grabmal Hadrians, ich hatte sie jahrelang genährt. Sie erschlugen den siebenten, der laut die Goten heranrief, und sie versprachen Lucius, mich zu retten, wenn sie irgend vermochten.
In hohen Getreidehaufen bargen sie mich vor den gotischen Wachtschiffen, welche die Ausfahrt des Hafens hüteten. Lucius und Syphax ruderten mit in Schiffertracht. So entkamen wir. Aber an Bord dieses Schiffes war ich dem Tode nahe durch meine Wunden. Nur des Mauren Pflege und die Seeluft haben mich gerettet. Tagelang, sagen sie, sprach ich nur die Worte: ‹Rom, Kapitol, Cäsar.›
Gelandet auf Sizilien bei Panormos im Schutz der Byzantiner, genas ich rasch. Mein alter Freund Cyprianus, der mich einst zu Ravenna in den Palast Theoderichs eingelassen, da ich Präfekt von Rom werden sollte, empfing mich dort als Hafenarchon. Kaum genesen, ging ich von Sizilien nach Kleinasien oder, wie ihr sagt, Asiana, auf meine Güter—du weißt, ich hatte herrliche Latifundien bei Sardes, Philadelphia und Tralles...»—
«Du hast sie nicht mehr,—die säulenreichen Villen?»
«Ich verkaufte sie alle. Denn ich mußte doch sofort aufs neue Söldner werben, Rom und Italien zu befreien.»
«Tenax propositi!» rief staunend Prokopius. «Du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben?»
«Kann ich mich selbst aufgeben? Mit dem Erlös—er war nicht klein: die Villen an der Küste bei Ephesos und Jassos ließ Furius Ahalla kaufen—ging ich zu meinen alten Gastfreunden im Lande der Isaurier, Armenier und Abasgen. Einen Isaurerfürsten mußte ich totschlagen, weil er nachts mein Zelt überfiel und mein Gold ohne andere Gegenleistung als einen Dolchstoß gewinnen wollte. Darauf warb ich der Söldner eine gute Zahl.
Aber freilich: Narses hat sie teuer gemacht, er verwöhnt sie und verdirbt das Geschäft. Sie sterben nicht mehr so billig wie früher. Er hat viele tapfre Häuptlinge für sich gewonnen.
Ich mußte mich noch nach andern Völkern umtun.
Nun sitzt da unten in Pannonien ein nicht gar volkreicher, aber sehr wilder und tapfrer Germanenstamm, den ich durch deine Schilderungen, o Vortrefflicher, erst recht entdeckt—durch seine blutigen Kriege mit den Gepiden bekannt.»
«Ah», rief Prokop, «die wilden Langobarden! Gott gnade deinem Italien, wenn die je einen Fuß hineinsetzen. Der Langobarde ist wie der Wolf im Vergleich mit dem Schäferhund, dem Goten, gegen das goldvließige Schaf Italien.»
«Rom soll aber selber wieder die alte Wölfin werden.
Ich würde sie schon wieder hinausschaffen aus meinem Vaterland, die Barbaren des Alboin! Zu diesen Langbärten—denn das soll des Namens Sinn sein—hab' ich Licinius auf Werbung geschickt. Mich freut es ganz besonders», schloß er grimmig, «Germanen durch Germanen zu verderben. Rom gewinnt bei jeder Wunde, die sich Langobarde und Gote hauen.»
«Du hast die Weisheit des Tiberius aus deinem Tacitus gelernt. Aber laß den Tacitus stehn—er ist zu herbe. Hier ist ein ausgezeichnetes Getränk: Ammianus Marcellinus! Wirklich ein geistreicher Gesell!»
«Wie wird man dereinst ‹Prokopius› beim Trinken beurteilen?»
«Bauwerke», sagte dieser «‹muffig›.»
«Perser- und Vandalenkrieg: ‹goldklar›», sprach Cethegus.
«Gotenkrieg—‹zu sauer›», meinte dessen Verfasser, den Mund verziehend.
«Aber Geheimgeschichte», lächelte Cethegus «‹prickelnd—am Schluß der Mahlzeit nur tropfenweise zu schlürfen›.»
«Bah, ein Brechmittel», sagte Prokop, sich schüttelnd.
«Ich selbst aber», fuhr Cethegus fort, «eilte hierher in die Höhle eures—soll ich sagen: Löwen?»
«Das wäre zuviel gesagt», meinte Prokop: «selbst in den Bauwerken soll keine solche Lüge stehn.»
«Nun also: eures Fuchses oder Hamsters. Denn ich bin nicht so kühn wie der große Belisarius, mir einzubilden, mit Söldnerhaufen allein die Goten zu besiegen. Diese Barbaren haben das unverschämte Glück, ein Volk zu sein. Ihr König ist ihres Volkstums lebendiges Symbol. Es ist aber sehr schwer, ein Volk zu besiegen. Auch ein so plumpes, törichtes, dumpfes Volk wie diese Barbaren.»—«Namentlich», sprach Prokop beipflichtend, «ein Volk zu besiegen—ohne ein Volk.»
«Aber Byzanz ist, wenn kein Volk, ein Staat. Dieser Staat ohne Volk kann das Volk ohne Staat vernichten. Denn das ist ja kein Staat, was diese Goten ihr ‹Reich› nennen. Es ist nur die seßhaft gewordene Horde. Haben sie nicht unter jenem Witichis drei Heere in Waffen gegeneinander gehabt! Solcher Torheit, Unreife, Barbarei ist auch das Byzanz deiner Geheimgeschichte noch überlegen. Kaiser Justinian hat ja sein Wort verpfändet, Italien zu befreien. Wohlan, er soll gemahnt werden, es zu lösen. Ich will ihn mahnen, so lange, bis er's tut.»
«Da wirst du lang noch mahnen müssen.»
«So scheint's. Religion, Ruhm, Gold—nichts scheint ihn mehr zu rühren.
Laß sehn, ob nicht die Furcht ihn rührt.»
«Die Furcht? Vor wem?»
«Vor Cethegus—und vor dem Unbekannten. Ungenanntes Grauen ist stets das stärkste.—Natürlich hoffte ich lebhaft auf die Kaiserin. Wir kannten uns in der Jugendzeit.—Und wir wußten unsre Vorzüge zu schätzen schon damals.—Sie war das schönste Weib, das ich—bis damals—gesehn. Und ich—nun: ich...—»
«War Cethegus», sagte Prokop.
«Aber bei aller alten Neigung, die sie nicht verleugnete, als ich nun wieder vor sie trat: die Kaiserin war nicht für meinen Krieg. Ich verstehe sie darin nicht recht. Sie hält es plötzlich für christlicher, Kirchen zu bauen als Städte zu verbrennen.—Woher diese Wandlung? Sie ist doch noch zu jung für die allgemeine Wanderung ihresgleichen von—nun, sagen wir, von Kypros nach Golgatha.»
«So weißt du nicht», fiel Prokop ein, «was außer Justinian und dir—verzeih: Rom geht vor Byzanz: was außer dir und Justinian—das ganze Ostreich weiß?»
Die schöne Kaiserin ist krank, ist innerlich verzehrt von einem furchtbaren Leiden. Du staunst?—Ja, sie erträgt nicht nur, sie verbirgt es auch mit unerreichter Willenskraft vor Justinian. Denn dieser größte und kleinste aller Selbstlinge haßt die Kranken: er kann nichts in seiner Nähe haben, was an Leiden und Sterben mahnt.
So gewaltig ihn die Kaiserin beherrscht,—ich bin gewiß, entdeckte er ihr Leiden, er schickte sie, zärtlich besorgt, zur Heilung in die fernste Stadt der Reiches. Hat er es doch mit Germanus ähnlich gemacht, den er aufrichtig geliebt.
Darum trägt die Kaiserin Höllenqualen mit lächelndem Munde. Furchtbar sollen ihre Nächte sein. Aber bei Tage, in der Nähe des Kaisers, an der Tafel, in der Kirche, bei den Zirkusfesten birgt sie ihre Schmerzen mit übermenschlicher Kraft. Auch ihre Schönheit hat kaum merklich gelitten. Denn unerschöpflich ist das Arsenal ihrer Schönheitskünste. Nur noch zarter ist sie geworden. Aber fast noch gewaltiger an beherrschendem Geist.»
«Ein wunderbares Weib.»
«Ja, und so sehr sie im kleinen ihre Listen und Ränke pflegt: in großen Dingen, in Fragen des Staats läßt sie nie von ihrer Überzeugung.»
«Nie. Oder doch nur schwer. Schon wollte der Kaiser die Friedensvorschläge der Goten annehmen: Cassiodor und—ein andrer sollten siegen über mich.—Theodora sprach nicht für den Krieg—und alles schien für mich verloren.
Da fiel mir noch im letzten Augenblick ein, auf ihre Frömmigkeit zu wirken.
Ich erfuhr durch sie selbst, daß Justinian die beiden Gesandten zu günstigem Bescheid in den Palast berufen.
Am gleichen Mittag eilte ich zu ihr und sprach: ‹Du bauest den Heiligen neue Kirchen mit allem deinem Golde. Du kannst doch höchstens noch hundert bauen. Und trittst du Italien den Goten ab, so entreißest du für immer mehr als tausend Kirchen Christus, dem Gottessohn, und überweisest sie seinen verhaßten Feinden, den arianischen Ketzern. Glaubst du das wiegen deine hundert Bauten auf?› Das wirkte. Erschrocken sprang sie von dem Lager auf und rief:
‹Nein, das ist eine Sünde, die ich nicht begehen will!
Sind wir zu schwach, jene Kirchen den Ketzern zu entreißen, wollen wir doch nimmermehr sie ihnen ausdrücklich zuerkennen. Niemals darf der Kaiser ihnen Italien friedlich überlassen! Danke dir, Cethegus: manche gemeinsame Sünde unsrer Jugend werden uns die Heiligen vergeben, weil du mich abgehalten von dieser schwersten Sünde.›
Und sie lud ihren Gemahl zu sich zur Tafel: und unter ihren Blumen, Gebeten und Küssen entbrannte Justinianus aufs neue für die Sache Christi, verwarf die Friedensvorschläge, und der weise Cassiodor zog unverrichteter Dinge ab.
Der Friede ist verhütet. Den Krieg sofort zu erzwingen hab' ich noch kein Mittel. Aber ich werde es finden. Denn Rom muß frei werden von den Barbaren.»
Und ruhig hielt Cethegus inne, ergriff den Becher und trank: aber in ihm loderte tief verhaltne Leidenschaft.
Prokopius legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach: «Höre, Cethegus, ich staune. Ich staune, daß in unsrer Zeit des Niedergangs in einer Männerbrust noch solche Kraft wohnt.
Und solches Feuer glüht für ein hohes, uneigennütziges Ziel, wie die Freiheit Roms. Sei dieses Ziel immerhin, wie ich glaube, ein glänzendes Traumbild. Und weil dies Ziel nicht ein selbstisches:—darum verzeihe ich dir die mancherlei krummen, dunkeln Pfade, auf denen du gewandelt bist. Und andre Leute, wie zum Beispiel Belisar und mich, hast wandeln lassen, durch Arglist und Frevel hindurch. Von dem Tage an, da ich dein Ziel als ein selbstisches erkennen müßte—bei aller Bewunderung deines Geistes, deiner Kraft—ich müßte dir die alte Freundschaft kündigen.»
Cethegus aber lachte. «Hör' ich noch immer aus deinem Mund die halb platonische, halb christliche Ethik, wie in der Schule zu Athen! Alter Zögling du des Kaiserhofes und des Feldlagers?—Hast du noch immer diese Mädchen-Moral?
Selbstisch—Unselbstisch?—Was, wer ist denn unselbstisch? Wer kann es sein? Jeder will in jedem Augenblick, was er wollen muß.
Ob ich der Befreier Roms werden will oder etwa sein Tyrann—: beides ist gleich selbstisch. Denn die Liebe ist die größte, weil die süßeste Selbstsucht.»
«Und Christus? Starb er vielleicht auch aus Selbstsucht?»
«Gewiß: aus einer edeln Schwärmerei! Sein Egoismus galt der Menschheit! Sie hat ihm danach vergolten: gekreuzigt haben sie ihn für seine Liebe. Wie Justinian Belisar, wie Rom Cethegus vergilt. Die Selbstsucht der Schwächlinge ist erbärmlich: die der Starken großartig. Das ist der einzige Unterschied der Menschen.»
«Nein, Freund! Das ist die Sophistik einer starken Leidenschaft. Das Höchste ist: das Gute nur durch gute Mittel anstreben. Zu diesem Höchsten ist Prokop zu klein, die Zeit zu schwach.
Aber laß uns wenigstens durch böse Mittel nur dem Guten dienen: nicht dem Bösen, nicht der Selbstsucht. Wehe mir, wenn ich einst an dir irre werden müßte. Ich glaube an den Schwerthelden Belisar, an den Geisteshelden Cethegus. Wehe, wenn mir aus meinem Heros Cethegus einst ein Dämon würde. Ich begreife, daß die Menschen dich scheuen, dich fürchten wie Luzifer, den gefallnen Engel des Morgensterns. ‹Alle seine Feinde erliegen vor ihm›, sagte mir einst Antonina, die dich abergläubisch fürchtet. Und sie hat recht. Gothelindis, Petros, unser pfiffiger Schulkamerad, der jetzt Marmor sägt und Steine klopft bei den Hunnen, Papst Silverius, den der Kaiser immer noch auf Sizilien gefangen hält, wie Scävola und Albinus:—dem hat er seine Seele, d. h. sein Geld genommen.»
«Ich könnte die Beispiele noch mehren», sagte Cethegus, die Brauen zusammenziehend. «Aber ich will die zürnenden Schatten nicht heraufbeschwören aus ihrer Grabesruhe. Nur den dicken Balbus», lachte er, «will ich erwähnen. Ich hatte ihm die Ehre zugedacht, wie Gottes Sohn zu sterben.
Aber er hat sich seinem Gott, d. h. seinem Bauch freiwillig geopfert. Von Quintus Piso, den der Barbarenkönig aus der Gefangenschaft ohne Lösegeld entließ, wie Marcus Massurius und Salvius Julianus, erfuhr ich sein Ende.
Er bestach die gotischen Wachen, die das Unmaß des Fressens der Heißhungrigen verhüten sollten, mit seinen letzten Goldstücken, ihn essen zu lassen, solang er wollte. Er aß drei Stunden. In der vierten war er tot. Er starb im Dienst! Aber was hilft all das Verderben meiner kleinen Feinde? Solang in Rom ein Feind triumphierend thront, der wahrlich groß ist»—und er hielt inne, dann fuhr er grimmig fort—«aber nur an sinnlosem, maßlosem Glück.»
«Bist du nicht ungerecht gegen diesen König Totila? Wird nicht dereinst sein Geschichtsschreiber anders...—»
«Ich aber bin nicht dereinst sein Geschichtsschreiber. Ich bin jetzt sein Feind bis zum Tode. Ha, der Tag, da dieses Knaben Herzblut mir von des Speeres Spitze träuft—ich muß ihn noch erleben.
Begreifen kann ich Achilleus, der die Leiche des erschlagnen Hektor dreimal um die Wälle schleift. Seit ich kämpfe um mein Rom, steht immer und immer wieder, und meistens sieghaft, dieser Blondkopf mit dem Mädchenantlitz mir entgegen.
Er hat mir meinen Liebling und mein Rom und zuletzt noch meinen edeln Pluto genommen. Wie Piso erzählt, fanden sie, den Reiter verfolgend, das Roß, wo es Syphax geborgen am Tiber: und der Barbar hat von aller römischen Beute nur das Roß des Präfekten für sich genommen. Schleudre ihn doch, mein Pluto, kopfüber und zerstampfe ihm mit den Hufen das Hirn.»
«Du hassest heiß!»
«Ja, diesen hass' ich nicht nur aus Vernunft: aus angebornen Feindschaft der Natur. Als ich ihm das Forum romanum räumen mußte, habe ich's ihm gelobt: er stirbt von meiner Hand.
Aber», schloß er, sich beruhigend, «wann? wann?
Wann find' ich das Mittel, diesen trägen Koloß, den man Justinianus, den Kaiser der Romäer nennt, auf das Gotenreich zu stürzen? Wann ruft das Schicksal wieder mit ehernem Tubaton mich auf mein großes Schlachtfeld Italien?»
Da drängte sich eilfertig Syphax durch die Vorhänge des Gemachs. «Herr», sprach er, sich neigend, «ich heische Botenlohn. Es hat irgendwo gewittert:—es zieht wohl rasch gegen diese Stadt. Es braut und spinnt was in der Luft. Im goldnen Palast ist geschäftige, unheimliche Bewegung. Wachen sind an alle Tore geschickt, eintreffende Boten sogleich in geschlossenen Sänften zum Kaiser zu führen. Die Boten sollen mit niemand sprechen. Und soeben gab in deinem Hause ein goldgleißender Sklave diesen Brief ab—von der Kaiserin.»
Hastig riß Cethegus die Purpurschnüre hinweg von dem Siegel, der Taube—war es die von Kypros oder die vom Pfingstfest?—und las: «An den Jupiter des Kapitols. Verlasse morgen dein Haus nicht, bis ich dich entbiete. Morgen rufen dich dein Schicksal und—Kypris.»
Am andern Morgen stand Kaiser Justinian in tiefem Nachdenken vor dem hohen, heiligen Goldkreuz in seinem Gemach.
Sein Ausdruck war sehr ernst, aber nicht bestürzt und nicht zweifelig. Entschlossene Ruhe lag heute auf seinen Zügen, die, sonst nicht schön oder edel, in diesem Augenblick Geistesschärfe und Überlegenheit verrieten. Er erhob Stirn und Augen fast drohend gegen das Goldkreuz und sprach: «Auf harte Proben, Gott des Kreuzes, stellst du deinen treuen Knecht! Mir ist, Herr Christus, ich hätte Besseres um dich, von dir verdient! Du weißt ja doch, was alles ich getan, zu deines Namens Ehre! Warum triffst du mit deinen Schlägen nicht deine Feinde, die Heiden, die Ketzer? Warum mich? Aber da du's nun einmal so gewollt, sollst du erfahren: Justinianus kann noch mehr als Kirchen baun und Bilder weihn.»
Und er schritt durch das Gemach: sein Blick fiel auf die Büsten der Kaiser, welche hier an den Wänden auf kleinen Sockeln prangten.
«Großer Constantinus, Gründer dieses Ostreichs, Schirmherr des rechten Glaubens! Bangst du für dein Werk? Bange nicht: getrost! du hast's gebaut, und Justinianus wird's erhalten. Ihr andern alle hattet's leicht, groß sein, Großes schaffen:—Augustus—die Antonine—Trajanus—Hadrianus:—ihr alle wart noch im Anfang oder auf den Höhen. Ich aber soll das Rad aufhalten, das von dem Gipfel niederrollt. Und ich will's aufhalten. Und ich hab' es schon aufgehalten. Und hab' es mühevoll auch wieder ein gut Stück emporgehoben. Ich sehe euch getrost ins Antlitz: ich schäme mich nicht vor euch. Wo ist der wilden, ketzerischen Vandalen Reich? Der Enkel Geiserichs, des gefürchteten Seekönigs, kniete vor mir im Hippodrom. Laß sehen, ob Justinian nicht wie Karthago auch Rom zurückgewinnt. Sie wollen den Frieden ertrotzen, die Barbaren, in Italien: sie sollen ihn finden, den Frieden des Grabes!»
Da meldete der Velarius: «Herr, der Senat ist versammelt im Saale von Jerusalem. Die Kaiserin betritt soeben die Löwentreppe.»
«Gut», sagte Justinian, «geh. Die Stunde der Prüfung ist gekommen für Theodora. Und für sie alle, die sich meine Räte nennen. Sie sind nie verlegen, wenn es kleine Mittel gilt für kleine Ziele. Wenn sie, behaglich auf den Seidenpolstern sitzend, Verbannung und Konfiskation über ihre Amtsgenossen rechtfertigen sollen, wie scharfsinnig, wie erfinderisch sind sie! Des Reiches und des Kaisers Majestät ist das Alpha und Omega dieser Sklavenlippen. Laß sehen, ob sie auch heute dran gedenken. Nur heute versage mir nicht, du höchste Kunst des Herrschers: undurchschaubare, tief ausholende Verstellung. Heute gilt es, eure Kraft erproben, ihr Staatsmänner von Byzanz. Ich ahne, wie ihr bestehn werdet. Und mich freut's. Eure Erbärmlichkeit ist die beste Stütze meines Throns. Und die beste Rechtfertigung meines Regiments. Klar soll euch werden in eure erschrockenen Herzen hinein, daß ihr einen Zwingherrn braucht, ihr feigen, ehrlosen, ratlosen Sklaven!»—
Da erschienen die Kämmerer, das Ankleidepersonal.
Justinian vertauschte nun das Morgengewand mit der kaiserlichen Staatstracht. Kniend halfen ihm dabei die Vestiarii.
Er legte die weiße, bis an die Knie reichende Tunika an von weißer Seide, an beiden Seiten mit Gold besetzt und durch einen purpurfarbenen Gürtel gehalten: auch die ganz eng anschließenden Beinkleider waren von Seidenstoff und Purpurfarbe. Über die Schulter warf ihm der Mantelsklave den prachtvollen Kaisermantel von hellerer Purpurfarbe mit breitem Clavus (Saum) von Gold, in welchem rote Kreise und in grüner Seide gestickte symbolische Tiergestalten, zumal Vögel, wechselten; aber die verschwenderisch darübergestreuten Perlen und Edelsteine machten die Zeichnung kaum erkennbar und den ganzen Mantel so schwer, daß die Hilfe der Schleppträger nicht unerwünscht sein mußte.
Jeden Unterarm bedeckten drei breite goldne Armringe. Das Diadem, links und rechts breit vom Kopf abstehend, von massivem schwerem Golde, war von zwei Perlenbogen überwölkt. Den Mantel hielt auf der rechten Schulter eine kostbare Spange mit großen Edelsteinen. In die Hand gab ihm der Zepterverwahrer den über mannslangen goldnen Herrscherstab, der oben die Weltkugel aus einem einzigen Smaragd und darauf das Goldkreuz trug.
Fest ergriff ihn der Kaiser und sprang von der Kline auf.
«Noch die Sandalen, Herr, die Kothurn-Sandalen», mahnte ein kniender Kämmerer.
«Nein, heute brauch' ich keine Kothurn», sprach Justinian und schritt aus dem Gemach.
Über die Löwentreppe, benannt von vierundzwanzig aus Karthago von Belisar eingebrachten hohen Marmorlöwen, welche die zwölf Stufen von beiden Seiten bewachten, stieg der Kaiser in ein tieferes Geschoß und in den großen Beratungssaal des Palastes, den «Saal von Jerusalem».
Dieser trug seinen Namen von den Porphyrsäulen, Onyxschalen, Goldtischen und zahllosen Goldgeräten, die an den Wänden und auf Halbsäulen angebracht, der Überlieferung nach dereinst den Tempel von Jerusalem geschmückt. Von dort hatte Titus nach der Eroberung der Stadt diese Schätze nach Rom entführt. Aus Rom hatte sie der Meerkönig Geiserich auf seinen vandalischen Drachenschiffen, gleichzeitig mit der Kaiserin Eudoxia, nach seiner Hauptstadt Karthago getragen. Und nun hatte sie Belisar aus Afrika dem Kaiser des Ostreichs zugeführt.
Die Kuppel des Saales war dem Himmelsgewölbe nachgebildet, aus kostbaren blauen Halbedelsteinen zusammengefügt: und außer der Sonne, dem Mond, dem Auge Gottes, dem Lamm, dem Fisch, den Vögeln, der Palme, der Rebe, dem Einhorn und andern christlichen Sinnbildern war der ganze Zodiakus, und waren zahllose Sterne aus massivem Golde in die Mosaikarbeit eingelassen. Die Kosten dieser Kuppel allein schlug man in Byzanz so hoch an als das Gesamterträgnis der Grundsteuer des ganzen Reiches für fünfundvierzig Jahre.
Gegenüber den drei hohen Eingangsbogen, die von Vorhängen geschlossen und außerhalb des Saales—er war der einzige Eingang—von der kaiserlichen Leibwache der «Goldschildner» in dreifacher Kette gehütet waren, erhoben sich in der Tiefe des halbrunden Saales der Thron des Kaisers und, links von diesem, etwas niedrer, der der Kaiserin.
Als Justinian den Saal betrat mit großem Gefolge der Palastdiener, warfen sich alle Versammelten, die höchsten Würdenträger des Reiches, auf das Antlitz zu demütiger Proskynese.
Auch die Kaiserin erhob sich, beugte tief das Haupt und kreuzte die Arme auf der Brust. Ihre Kleidung war der des Gemahls ganz ähnlich: auch ihre weiße Stola überwallte der Purpurmantel, dem jedoch der kaiserliche Clavus fehlte. Auch sie trug ein Zepter, aber nur ein ganz kurzes, aus Elfenbein.
Einen matten, aber verachtungsvollen Blick warf die Herrscherin über die Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Patrizier und Senatoren, welche, über dreißig an der Zahl, die im Halbkreis ausgestellten goldnen Stühle mit den Seidenpolstern füllten.
Durch den in der Mitte den Saal teilenden Gang schritt nun Justinianus und bestieg mit raschem, sicherem Schritt seinen Thron, das Zepter schwingend.
Zwölf der ersten Palastbeamten standen auf den Stufen der beiden Throne, weiße Stäbe in den Händen. Trompetenschall gab nun den auf das Antlitz Gesunkenen das Zeichen, sich zu erheben.
«Wir haben auch berufen», hob der Kaiser an, «heilige Bischöfe und erlauchte Senatoren, in schwerer Sache euren Rat zu hören. Aber warum fehlt unser Magister Militum per Orientem, Narses?»
«Er ist gestern erst aus Persien eingetroffen—er liegt schwer krank zu Bett», meldete der Proto-Keryx.
«Unser Quästor sacri palatii Tribonianus?»
«Ist noch nicht zurück von deiner Sendung nach Berytus um die Codices.»
«Warum fehlt Belisarius, unser Magister Militum per Orientem extra Ordinem?»
«Er wohnt nicht in Byzanz, sondern drüben in Asien, in Sycae, im roten Hause.»
«Er hält sich sehr abseits im roten Hause. Das mißfällt uns. Was entzieht er sich unserem Blick?»
«Er war dort nicht zu finden.»
«Auch nicht im Hause seines Freigelassenen Photius, im Muschelhaus?»
«Er war auf die Jagd geritten, die persischen Jagd-Leoparden zu erproben», sagte Leo, der comes spathariorum.
«Er ist nie da, wenn man ihn braucht. Und immer, wenn man ihn nicht braucht. Ich bin nicht zufrieden mit Belisarius.——Vernehmt nun, was geschehen, was uns in den letzten Tagen durch viele Briefe zuging: zuletzt sollt ihr auch mündlichen Bericht der Boten hören.—
Ihr wißt: wir haben den Krieg in Italien einschlafen lassen, weil wir andre Aufgaben hatten für unsre Feldherrn. Ihr wißt: der Barbarenkönig bat um Frieden, um Überlassung Italiens. Wir wiesen das damals ab, gelegene Zeit erwartend.
Antwort hat der Gote nicht in Worten, in sehr verwegnen Taten gegeben. Ihr wißt noch nicht davon:—niemand in Byzanz—wir behielten die Nachricht für uns, sie unmöglich, oder doch übertrieben erachtend. Aber wahr ist alles, was gemeldet ward: vernehmt, und dann erteilet Rat.
Eine Flotte und ein Heer hatte der Barbarenkönig nach Dalmatien geschickt in aller Heimlichkeit und Eile. Die Flotte lief in den Hafen von Muicurum bei Salona, und das gelandete Heer nahm die feste Stadt mit Sturm. Ebenso überraschte die Flotte die Seestadt Laureata.
Claudianus, unser Befehlshaber zu Salona, schickte zahlreiche und stark bemannte Dromonen, den Goten die Stadt wieder zu entreißen. Aber in einer großen Seeschlacht schlug ein Gotenherzog—Guntharis—diese unsere Flotte dermaßen, daß er alle Dromonen ohne Ausnahme eroberte und siegreich in den Hafen von Laureata einführte.
Eine zweite Flotte von vierhundert großen Schiffen rüstete der König bei Centumcellä aus. Sie war meistenteils gebildet aus unsern Dromonen, die, vom Orient aus nach Sizilien für Belisar gesendet, in Unkenntnis, daß die italischen Häfen wieder in der Hand der Goten, mit aller Bemannung und Ladung waren weggenommen worden von einem Gotengrafen—Grippa. Das Ziel auch dieser neu geschaffenen Flotte war unbekannt.
Plötzlich erschien der Barbarenkönig selbst mit dieser Flotte vor Regium, der festen Hafenstadt an der äußersten Südspitze Bruttiens, die wir gleich bei der ersten Landung gewonnen und seither nicht wieder verloren hatten. Nach tapferm Widerstand ergaben sich die Heruler und Massageten unserer Besatzung.
Der Tyrann Totila aber wandte sich nun rasch nach Sizilien, diese früheste Eroberung Belisars uns wieder zu entreißen. Er schlug den Römer Comes Dommentiolus, der ihm ins offene Feld entgegentrat, und gewann rasch das ganze Eiland. Nur Messana, Panormos und Syracusä schützten noch ihre festen Mauern. Eine Flotte, die wir zum Schutze, zur Wiedergewinnung von Sizilien aussandten, zerstreute der Sturm. Eine zweite blies der Nordwest in den Peloponnes zurück.
Gleichzeitig segelte eine dritte Trierenflotte dieses unerschöpflichen Königs unter einem Grafen Haduswinth gegen Corsica und Sardinia. Die erstere Insel fiel alsbald den Goten zu, nachdem die kaiserliche Besatzung ihrer Hauptstadt Aleria in offener Schlacht geschlagen war. Der reiche Corse Furius Ahalla, dem der größte Teil des Eilands gehörte, war zwar fern in Indien. Aber seine Institoren und Colonen waren angewiesen, im Fall einer Landung der Goten diesen keinen Widerstand, sondern beste Förderung zu leisten.
Von Corsica wandten sich die Barbaren nach der Insel Sardinia. Hier schlugen sie bei Karalis die Truppen, die unser Magister Militum von Afrika zur Beschützung der Insel herübergeschickt. Und sie nahmen diese Stadt, wie Sulci, Castra Trajani und Turres in Besitz.
Auf beiden Eilanden aber, auf Corsica und auf Sardinia, richten sich die Goten häuslich ein. Sie behandeln dieselben als dauernd erworbene Zubehörden ihres Reiches in Italien. Sie setzen Gotengrafen in allen Städten ein. Und sie erheben nach gotischem Verfassungsrecht die Steuern.—Diese sind—unbegreiflich—!—viel geringer als die unseren. Und die Untertanen dort erklären schamlos: sie zahlen lieber den Barbaren fünfzig als uns neunzig.
Aber nicht genug.
Nordöstlich heraufsegelnd von Sizilien vereinte der Tyrann Totila sein Geschwader mit einer vierten Flotte unter Graf Teja auf der Höhe von Hydrus. Eine dieser vereinten Flotten, unter Graf Thorismut, landete auf Corcyra, nahm die Insel in Besitz und gewann von dort aus alle umliegenden Eilande, zumal die Sybotischen Inseln.
Aber noch nicht genug.
Der Tyrann Totila und sein Graf Teja griffen bereits das Festland unseres Reiches an.»
Ein Murmeln des Schreckens unterbrach hier den kaiserlichen Redner.
Finster und grimmig fuhr dieser fort: «Sie landeten in dem Hafen von Epirus vetus, eroberten die Städte Nikopolis und Anchisus, südwestlich von dem alten Dodona, und nahmen eine Menge unserer Schiffe in jenen Küstengewässern weg. Das bisher Mitgeteilte mochte nur euren Unwillen erregen über die Verwegenheit der Barbaren. Aber nun vernehmt, was euch anders ergreifen mag. Kurz gesagt und klar,—nach den gestern hier eingetroffenen Boten ist es gewiß: Die Goten sind in vollem Anzug auf Byzanz.»
Da sprangen einzelne der Senatoren von ihren Stühlen.
«In doppeltem Angriff. Ihre versammelten Geschwader, von Herzog Guntharis, den Grafen Markja, Grippa und Thorismut geführt, haben in zweitägiger Seeschlacht unsre Flotte der Inselprovinz geschlagen und in die Meerenge von Sestos und Abydos getrieben.
Ihr Landheer aber, unter Totila und Teja, zieht quer durch Thessalien über Dodona gegen Makedonien: schon ist Thessalonike bedroht. Die ‹neuen Mauern›, die wir dort gebaut, hat dieser Graf Teja gestürmt und geschleift.
Die Straße nach Byzanz liegt ihnen offen. Und kein Heer steht mehr zwischen uns und den Barbaren. All unsere Truppen liegen an der Persergrenze.
Und nun vernehmt, was uns der Barbarenkönig bietet. Glücklicherweise hat ihn ein Gott betört und unsre Schwäche ihm verhüllt.
Hört es: er bietet uns abermals den Frieden unter den gleichen Bedingungen wie vor Monaten.
Nur Sizilien verlangt er jetzt dazu. Aber alle andern Eroberungen will er ohne Schwertstreich räumen, wenn wir ihn nur in Italien anerkennen.
Da ich gar kein Mittel, weder Segel noch Kohorte, hatte, ihn aufzuhalten, rückte er vor, so habe ich einstweilen Waffenstillstand gefordert. Diesen nahm er an, unter der Voraussetzung, daß der Friede unter jenen Bedingungen geschlossen werde.
Das sagte ich zu.»———
Hier warf er einen prüfenden Blick auf die Versammlung, auch einen Seitenblick auf seine Kaiserin.
Die Versammelten atmeten sichtlich auf.
Die Kaiserin schloß die Augen, deren Ausdruck zu verbergen. Sie drückte die kleine Hand krampfhaft auf die goldne Lehne ihres Throns.
«Nur unter dem Vorbehalt, noch meiner Gemahlin, die zuletzt nur noch für den Frieden sprach, und meines weisen Senates Meinung zu vernehmen. Ich fügte bei, ich sei dem Frieden geneigt.»
Da glätteten sich die Gesichter bedeutend.
«Und ich glaubte, das Urteil meiner Räte voraussagen zu können. Daraufhin machten die vordringenden Reiter Graf Tejas auf Befehl des Königs widerwillig halt vor Thessalonike: leider nahmen sie noch vorher den Bischof der Stadt gefangen. Aber sie sandten ihn mit andern Gefangnen, mit Boten und Briefen hierher, vernehmt sie selbst. Dann fasset euren Entschluß. Bedenkt aber dabei, daß die Barbaren in wenigen Tagen vor unsern Toren stehen, verwerfen wir den Frieden.
Und daß wir nur abtreten sollen, was das Reich seit vielen Jahrzehnten aufgegeben hatte, und was zwei Feldzüge Belisars nicht wiedergewinnen konnten: Italien. Führt nun die Boten ein.»
Durch die Eingangsbogen wurden nun von den Leibwachen hereingeleitet Männer in geistlicher, in Amts- und Kriegertracht.
Sie warfen sich vor Justinians Thron nieder unter Zittern und Seufzen, auch Tränen fehlten nicht. Auf einen Wink erhoben sie sich wieder und stellten sich vor den Stufen des Thrones auf.
«Eure Bittbriefe und Klageberichte», sprach der Kaiser, «hab' ich gestern schon durchlesen. Protonotarius, verlies nur den einen, den gemeinsamen des gefangenen Bischofs von Nikopolis und des verwundeten Comes von Illyricum,—der ist seither seinen Wunden erlegen.—»
«An Justinianus, den unbesiegbaren Kaiser der Romäer. Dorotheos, Bischof von Nikopolis, und Nazares, comes per Illyricum.
Der Ort, wo wir dies schreiben, ist der beste Beweis für den Ernst unsrer Worte. Wir schreiben dies an Bord des Königsschiffs des Gotenfürsten, ‹Italia› mit Namen. Bekannt ist dir wohl, wann du diese Worte liesest, der Flotten Niederlage, der Inseln Verlust, der ‹neuen Mauern› Erstürmung, des Landheeres von Illyricum Zerstreuung.
Rascher als die Boten, rascher als die Flüchtlinge von diesen großen Schlachten haben uns die gotischen Verfolger erreicht. Nikopolis hat der Gotenkönig erobert und verschont. Anchius hat Graf Teja erobert und verbrannt.
Ich, Nazares, diene dreißig Jahre in Waffen: nie hab' ich solchen Angriff gesehen, wie den, bei welchem Graf Teja mich im Tore von Anchisus niederschlug.—Er ist unbezwingbar! Seine Reiter fegen durch alles Land von Thessalonike bis Philippi.
Die Goten im Herzen von Illyricum! Seit sechzig Jahren ist es unerhört! Und der König hat geschworen, alle Jahre wiederzukehren, bis er den Frieden hat oder—Byzanz. Seit er Corcyra hat und die Syboten, steht er auf der Brücke in dein Reich. Und da Gott das Herz dieses Königs gerührt hat, daß er dir Frieden bietet um billigen Preis—ja nur um den Preis, den er schon hat—flehen wir dich an, im Namen deiner zitternden Untertanen, deiner rauchenden Städte: schließe Frieden. Rette uns und rette Byzanz!
Denn eher werden deine Feldherrn Belisar und Narses die Morgensonne und den Nordsturm aufhalten auf ihren Bahnen als den König Totila und diesen fürchterlichen Teja.»
«Beide Briefschreiber waren gefangen», unterbrach der Kaiser. «Sie reden vielleicht aus Furcht vor der Barbaren Todesbedrohung. Sprecht nun ihr: du, ehrwürdiger Bischof Theophilos von Thessalonike, du, Logothetes von Dodona, Anatolius, du, Parmenio, tapfrer Führer der makedonischen Lanzen, ihr seid hier sicher in unsrem kaiserlichen Palast, aber ihr habt die Barbarenführer gesehn:—was ratet ihr?»
Da warf sich der greise Bischof von Thessalonike abermals auf die Knie und sprach:«O Kaiser der Romäer: der Barbarenkönig Totila ist ein Ketzer. Und ewig verdammt. Das könnte mich irre machen an den Grundlehren der Kirche. Denn nie sah ich einen Mann so reich geschmückt mit allen christlichen Tugenden. Ringe nicht mit ihm! Im Jenseits ist er verworfen auf ewig. Aber—ich kann es nicht fassen—auf Erden segnet die Gnade Gottes alle seine Schritte: er ist unwiderstehlich.»
«Ich fass' es wohl», fiel Anatolius, der Logothetes, ein, «Schlauheit gewinnt ihm die Herzen: tiefste Heuchelei, Verstellung, die all unsre viel gerühmte und gescholtene Griechenklugheit übertrifft. Der Barbar spielt die Rolle des erbarmenden Menschenfreundes so unübertrefflich täuschend, daß er beinahe auch mich getäuscht hätte, bis ich mir sagte, daß es dergleichen in der Welt nicht geben könne, was dieser Gote spielt wie ein Mime. Er tut, als ob er wirklich Erbarmen habe mit besiegten Feinden! Er speist die Hungernden, er läßt das erbeutete Geld deiner Steuerkassen, o Kaiser, unter die Landleute verteilen, deren Felder durch den Krieg gelitten. Er gibt den Männern die Weiber unversehrt zurück, die diese in die Wälder geflüchtet und seine Reiter, die allgegenwärtigen, gefunden haben. Er reitet unter Harfenspiel eines schönen Knaben, der ihm des Rosses Zügel führt, in die Dörfer ein. Weißt du, was die Folge ist? Deine eignen Untertanen, o Kaiser der Romäer, fallen ihm zu, tragen ihm Kundschaft, liefern ihm deine Beamten, die deinen strengen Steuergeboten gehorchten, in Ketten aus. So mich selber die Bauern und Colonen von Dodona.
Dieser Barbar ist der größte Schauspieler des Jahrhunderts. Denn Wahrheit kann's nicht sein.
Dieser kluge Heuchler hat aber zu noch viel mehr Dingen Verstand als zum Zuschlagen. Er hat mit den fernen Persern, mit deinem Erzfeind Choroës, Verbindungen angeknüpft zu gegenseitiger Waffenhilfe wider dich. Wir haben selbst die persischen Gesandten gesehen, die aus seinem Lager wieder ostwärts ritten.»
Der Makedonen-Hauptmann aber sprach: «Beherrscher der Romäer: seit Graf Teja die Heerstraße von Thessalonike gewonnen hat, steht nichts mehr zwischen deinem Thron und seiner schrecklichen Streitaxt als die Mauer dieser Stadt. Wer die ‹neuen Mauern› dort achtmal nacheinander bestürmt und aufs neuntemal erstiegen hat, der ersteigt aufs zehntemal die Wälle von Byzanz. Nur mit siebenfacher Übermacht hältst du die Goten auf. Hast du die nicht, dann schließe Friede.»
«Friede! Friede! Wir flehen dich an im Namen deiner zitternden Provinzen Epirus, Thessalien, Makedonien.»
«Schaff' uns die Goten aus dem Lande!»
«Laß nicht Alarichs, Theoderichs Tage sich schrecklicher erneuern.»
«Friede mit den Goten! Friede! Friede!»
Und alle die Gesandten, Bischöfe, Beamten, Krieger sanken auf die Knie mit dem flehenden Rufe: «Friede!»
Denn furchtbar war der Eindruck dieser Nachrichten auf die Versammlung.
Wohl kam es oft vor, daß an den äußersten Marken des Reiches Perser und Sarazenen im Osten, Mauern im Süden, Bulgaren und Slawen im Nordwesten plündernd über die Grenze brachen, auch wohl die nächsten Truppen schlugen und mit ihrem Raub ungestraft wieder entkamen.
Aber, daß auf die Dauer griechische Inseln von den Feinden besetzt, daß griechische Küstenstädte von Barbaren gewonnen und verwaltet, daß die Straßen von Byzanz von Germanen beherrscht wurden,—das war seit acht Jahrzehnten unerhört.
Mit Entsetzen gedachten die Senatoren der Tage, da gotische Schiffe und gotische Heere alle griechischen Inseln überzogen und wiederholt die Wälle von Byzanz bestürmten, nur durch Erfüllung aller ihrer Forderungen von der Erstürmung abzubringen: schon hörten sie die Beilschläge des schwarzen Teja an die Tore pochen. So lag der Ausdruck hilfloser Furcht auf allen Gesichtern.
Ruhig prüfend blickte Justinian zur Rechten und zur Linken auf die Reihen.
«Ihr habt gehört», begann er dann, «was Kirche, Staat und Heer verlangen. Ich fordre nun euren Rat. Waffenstillstand haben wir schon erreicht. Soll neuer Krieg, soll Friede daraus werden? Ein Wort erkauft den Frieden: Abtretung des doch verlornen Italiens. Wer von euch für den Krieg, erhebe seinen Arm.»
Kein Arm erhob sich.
Denn die Senatoren bangten für Byzanz; und sie hatten an der Friedensneigung des Kaisers keinen Zweifel.
«Einstimmig wählt mein Senat den Frieden. Ich sah's voraus», sagte Justinian mit einem seltsamen Lächeln. «Ich bin gewohnt, stets meinen weisen Räten zu folgen. Und meine Kaiserin?»
Da sprang Theodora wie eine bäumende Schlange von ihrem Sitz und schleuderte ihr elfenbeinernes kurzes Zepter so heftig von sich, daß es weit in den Saal hinabflog.
Schreck malte sich in den Zügen der Senatoren.
«So fahre hin», rief sie mit aller Anstrengung, «was mein Stolz gewesen, jahrelang: mein Glaube an Justinian und seine Kaiserhoheit! So fahre hin jeder Anteil an der Sorge für das Reich und seine Ehre. Wehe, Justinianus, wehe mir und dir, daß ich solche Worte hören mußte aus deinem Mund!»
Und sie verhüllte das Haupt in ihren Purpurmantel, die Schmerzen bergend, welche die Erregung ihr verursacht.
Der Kaiser wandte sich zu ihr: «Wie, die Augusta, unsre Gemahlin, die seit Belisars zweiter Heimkehr immer zum Frieden riet—mit kurzer Ausnahme—, sie rät, jetzt, in solchen Gefahren...?»
«Krieg!» rief Theodora, den Purpur fallenlassend.
Und ihr Angesicht wurde schön in hohem Ernst, wie es nie war in spielendem Scherz.
«Muß ich, dein Weib, dich mahnen an deine Ehre?
Du willst es dulden, daß Barbaren in deinem Reiche sich festsetzen, dich durch Bedrohung zu ihrem Willen zwingen? Du, der geträumt von Wiederherstellung des Reiches Constantins? Du, Justinianus, der du die Namen Persicus, Vandalicus, Alanicus und Goticus dir zugelegt, willst dulden, daß dieser gotische Jüngling dich am Barte dahin zerrt, wohin er will? Dann bist du nicht der Justinianus, den seit Jahren die Welt, Byzanz, Theodora bewundert. Ein Irrtum war unsere Verehrung.»
Da ermannte sich der Patriarch von Byzanz—er glaubte immer noch, der Kaiser habe den Frieden bereits unwiderruflich beschlossen—zum Widerstand gegen die Kaiserin, die leider nicht immer haarscharf die von ihm gerade vertretene, feine Schattierung der Rechtgläubigkeit traf.
«Wie», sprach er, «die erhabne Frau rät zum blutigen Krieg? Wahrlich, die heil'ge Kirche hat nicht Ursache, für die Ketzer zu sprechen. Indessen: der neue König ist wunderbar mild gegen die Katholiken in Italien, und man kann ja gelegnere Zeit abwarten, bis...»
«Nein, Priester», unterbrach Theodora, «die beschimpfte Ehre dieses Reiches kann nicht warten. O Justinianus» dieser schwieg immer noch beharrlich und schloß die Augen, auf daß deren Ausdruck nicht seine Stimmung verrate. «O Justinianus, laß mich, laß die Welt nicht irre an dir werden. Du darfst dir nicht schimpflich abtrotzen lassen, was du der Bitte verweigert! Muß ich dich mahnen, wie schon einmal deines Weibes Rat und Kraft und Mut dich, deine Ehre, deinen Thron gerettet hat?
Hast du vergessen den furchtbaren Aufstand der Nika?
Vergessen, wie die vereinten Parteien des Zirkus, die Grünen und die Blauen, der rasende Pöbel von Byzanz heranwogte gegen dieses Haus?
Die Flammen und die Rufe: ‹Nieder die Tyrannen!› schlugen zusammen über diesem Dach. Flucht oder Nachgeben rieten dir alle deine Räte, alle diese heiligen Bischöfe und weisen Senatoren, auch deine Heerführer. Denn Narses war fern in Asien. Und Belisar war schon eingeschlossen von den Rebellen im Meerpalast.
Alle verzagten sie, die Männer.
Da war dein Weib, Theodora, der einzige Held an deiner Seite. Gabst du nach oder flohest du, so war dein Thron, dein Leben, ganz gewiß aber deine Ehre verloren. Du schwanktest, du neigtest zur Flucht.
‹Bleib und, wenn es sein muß, stirb›, sagte ich damals, Justinian, ‹aber stirb im Purpur.›
Und du bliebest, und dein Mut hat dich gerettet. Du harrtest aus, den Tod auf dem Thron erwartend mit mir—aber—Gott sandte Belisar zum Entsatz und Sieg.
So spreche ich auch jetzt. Weiche nicht, Kaiser der Romäer, gib nicht nach den Barbaren. Bleibe fest: laß dich von den Trümmern des goldnen Tors begraben, sprengt es jenes wütigen Goten Beil.
Aber stirb als Kaiser!
Befleckt ist dieser Purpur von maßloser Frechheit der Germanen. Hier werf' ich ihn von mir, und ich schwör's, bei der heiligen Weisheit Gottes: nicht eher wieder leg' ich ihn an, bis kein Gote mehr auf dieses Reiches Boden steht.»
Und sie riß den Purpurmantel ab und schleuderte ihn auf die Stufen des Thrones: dann aber, tief erschöpft, war sie im Begriff, auf den Sitz zurückzusinken.
Allein Justinianus fing sie auf in seinen Armen und drückte sie an seine Brust. «Theodora», rief er mit leuchtenden Augen, «mein herrlich Weib!
Du brauchst keinen Purpur um die Schultern: dein Geist ist in Purpur gekleidet. Du allein verstehst Justinianus. Krieg und Verderben den Barbaren!»
Schrecken und Staunen befiel die bebenden Senatoren bei diesem Schauspiel.
«Ja», sprach der Kaiser, zu diesen gewendet, «weise Väter, diesmal waret ihr allzuklug, um weise, um Männer zu sein. Wohl ist es eine Ehre, der Nachfolger Constantins zu heißen. Aber keine Ehre ist es, euer Herr zu sein. Recht haben, fürcht' ich, unsre Feinde: nur den Namen, die tote Mumie Romas hat Constantin hierher verpflanzt, die Seele Romas war bereits entflohn.
Weh um dies Reich! Wär' es frei, wär' es Republik:—es wäre heute versunken in Schande. Einen Herrn muß es haben, der es, wie ein faules Roß, aus dem Sumpf, darin es zu versinken droht, emporreißt, ein scharfer Reiter mit Peitsche, Zügel und Sporn.»
Da drängte sich durch die Eingangstüren ein kleiner, gebückter Mann, auf eine Krücke gestützt, und hinkte durch den Saal bis vor den Thron.
«Kaiser der Romäer», hob er an, von seiner Proskynese sich erhebend, «auf meinem Schmerzenslager erreichte mich dunkle Kunde, von dem, was die Barbaren gewagt, von dem, was hier entschieden werden soll in dieser Stunde. Da rafft' ich mich empor und schleppte mich mühsam hierher: denn ich muß es erfahren, durch ein Wort deines Mundes, ob ich von jeher ein Narr gewesen, daß ich dich, trotz vieler Kleinheiten, für einen großen Herrscher hielt, ob ich deinen Feldherrnstab in den tiefsten Brunnen werfen muß, oder ob ich ihn noch tragen kann mit Ehren? Sprich nur ein Wort. Krieg oder Friede?»
«Krieg, Magister Militum!» sagte Justinian, und sein hehres Antlitz strahlte.
«Sieg, Justinianus», rief der Feldherr und warf die Krücke weg. «Oh, laß mich deine Hand küssen, Imperator.» Und er hinkte die Stufen des Thrones hinauf.
«Aber Patricius», höhnte Theodora, «du bist ja auf einmal ein Mann? Du warst doch immer gegen den Gotenkrieg! Hast du plötzlich Sinn für Ehre?»
«Was Ehre!» rief Narses. «Dieser bunten Seifenblase mag Belisarius, das große Kind, nachlaufen. Nicht die Ehre: das Reich steht auf dem Spiel.
Solang ernste Gefahr vom Osten drohte, riet ich zum Perserkrieg. Von den Goten drohte nichts. Nun aber haben deine Frömmigkeit, o Kaiserin, und des Belisarius Heldenschwert so lang in dies Hornissennest gestochen, bis uns der Schwarm gefährlich um das Antlitz fliegt. Jetzt droht die Gefahr dringend, brennend von dort: und Narses rät zum Gotenkrieg. Die Goten stehen näher bei Byzanz, als Chosroë unsrer Ostgrenze steht. Wer, wie dieser Totila, ein Reich aus dem Abgrund zieht, kann viel leichter ein andres in den Abgrund stürzen. Dieser junge König ist ein Wundertäter, dem man beizeiten die Mirakel legen muß.»
«Diesmal erlebe ich», sprach Justinian, «die seltene Freude, daß meine Kaiserin und Narses eines Sinnes sind.» Und er war im Begriff, die Versammlung zu entlassen.
Da ergriff die Kaiserin seinen Arm: «Halt», sprach sie, «mein Gemahl, ich habe mir heute zum zweitenmal die Ehre erworben, dein bester Berater zu sein. Nicht wahr? Wohlan, so höre mich weiter und folge auch meinem weitern Rat.
Halte diese ganze weise Versammlung außer Narses bis morgen im Palast gefangen. Zittert nicht, ihr Illustrissimi: es gilt diesmal nicht das Leben. Aber ihr könnt nicht schweigen, ausgenommen mit abgeschnittenen Zungen. Dieses Mittel mag für diesmal durch Einsperrung ersetzt werden. Höre, Justinianus: es besteht eine Verschwörung wider dein Leben oder doch wider deine freien Entschlüsse.
Man wollte dich zum Kriege mit den Goten zwingen. Dieser ist nun zwar beschlossen. Aber heute in der Nacht oder morgen früh schon bricht die Verschwörung los: es gilt, die Verschwornen gewähren zu lassen.
Man darf sie nicht durch die Mitteilung, daß ihr Zweck ohnehin erreicht sei, abhalten von ihrem Tun.
Gefährliche, längst verdächtige und—o Justinianus—sehr, sehr reiche Leute sind darunter. Es wäre schade, wenn sie meinem aufgestellten Netz entgingen.»
Justinianus war nicht erschrocken bei dem Wort Verschwörung.
«Auch ich wußte davon», sagte er. «Aber schon so weit gediehn? Morgen früh schon? Theodora», rief er, «du bist mehr für das Reich als Belisar und Narses. Auf, Archon der Goldschildner, du hältst alle hier Versammelten gefangen, bis Narses kommt, sie abzuholen. Denkt nach indessen über diese Stunde, fromme und weise Väter, und ihre Lehren. Narses, folge uns und der Kaiserin.»
Und er schritt die Stufen des Thrones hinab.
Die Eingangsbogen wurden von starrenden Speeren erfüllt.
Der Kaiser beschied seine Kaiserin und Narses mit sich in sein Gemach.
Dort angelangt, umarmte er abermals, ohne des Zeugen Gegenwart zu scheuen, innig und herzlich seine Gemahlin. «Wie freut, wie erhebt mich die Begeisterung! Ich bin stolz auf ein solches Weib! Wie schön stand dir, o Theodora, der edle Zorn. Wie kann ich dir lohnen! Wähle dir jede Gunst, jedes Zeichen meines Dankes, du meine beste Beraterin, ja meine Mitregentin!»
«Soll ich, das schwache Weib, wirklich glauben dürfen, daß ich Anteil nehmen darf an deinen Plänen und Gedanken, an diesem Kriege, so vertraue mir, wie du ihn zu leiten gedenkst.»
«Jedenfalls sende ich zwei Feldherren nach Italien, nie mehr einen, seit Belisarius in jenem Land mit einer Krone gespielt. Aber ihn sende ich wieder, das steht mir fest.»
«So erbitte ich mir die Gnade», sprach Theodora, «den andere Feldherrn vorschlagen zu dürfen.—Narses», fuhr sie fort, ehe Justinian antworten konnte, «willst du der andere sein?» Sie wollte ihn rasch unmöglich machen.—
«Ich danke», sagte dieser bitter.—«Du weißt: ich bin ein störrig unverträglich Roß, ich tauge nicht, mit einem andern zusammen zu ziehn. Den Feldherrnstab und ein Weib, Justinianus, muß man in gleicher Weise haben.»
«Nämlich wie?»
«Allein oder gar nicht.»
«Dann du gar nicht», sagte Justinianus herb. «Du mußt nicht wähnen, unentbehrlich zu sein, Magister Militum.»
«Das ist niemand auf Erden, Justinianus. Sende nur wieder den großen Belisar! Er mag sein Glück zum drittenmal versuchen in jenem Lande, wo die Lorbeern so dicht wachsen. Meine Stunde kommt schon noch.
Als Zeuge eures Eheglückes bin ich wohl überflüssig hier. Und zu Hause, meinem Krankenbett gegenüber, ist die Straßenkarte von Italien angeheftet: vergönne, daß ich in meinem Studium derselben fortfahre: sie ist jetzt interessanter als die Karte unsrer Persergrenze.
Nur noch einen Rat. Zuletzt mußt du doch Narses nach Italien senden.
Je früher du ihn sendest, desto mehr ersparst du an Niederlagen, Verdruß und—Geld. Und wenn nun die Gicht oder jene niederträchtige Epilepsis Narses hinraffen sollte, ehe dieser König Totila auf seinem Schilde liegt, wer wird dir dann den König Totila besiegen? Du glaubst ja an Prophezeiungen. Wohlan, in Italien geht schon lange der Spruch: ‹T. schlägt B., N. schlägt T.›»
«Soll das vielleicht heißen: Theodora schlug Belisar, Narses schlägt Theodora?» höhnte die Kaiserin.
«Das war nicht meine Lösung des Rätselspruchs.
Es war die deine. Aber wohlan, auch diese Lösung nehm' ich an. Weißt du, welches das weiseste deiner vielen Gesetze war, o Justinianus?»
«Nun?»
«Jenes, das den Tod auf jede Anklage gegen deine Kaiserin setzte: denn er war das einzige Mittel, sie dir zu erhalten.» Und er ging.
«Der Unverschämte», sprach Theodora, ihm einen giftigen Blick nachsendend. «Er wagt zu drohn! Wenn erst einmal Belisar unschädlich ist, dann muß rasch Narses folgen.»
«Einstweilen aber brauchen wir noch beide», meinte Justinian. «Und du schlägst—in Wahrheit!—vermutlich zum andern Feldherrn für Italien wieder denselben Namen vor wie bei Cassiodors Abweisung?»
«Denselben.»
«Aber die Gründe meines Mißtrauens gegen jenen Ehrgeizigen sind seither noch verstärkt.»
«Hast du vergessen, wer dir Silverius entlarvt und entwaffnet, wer vor Belisars gefährlichem Kronenspiel geheim und zuerst gewarnt hat?»
«Aber er verkehrt hier mit denselben Männern, welche die Verschwörung gegen mich betreiben.»
«Ja: aber, o Justinianus, auf mein Geheiß, als ihr Verderber.»
«Das wäre! Wenn er aber auch dich täuscht?»
«Wirst du ihm glauben und mir und ihn nach Italien senden, wenn er dir morgen die Verschwörer in Ketten zuführt und darunter ihr geheimes, auch dir noch unbekanntes Haupt?»
«Ich weiß: es ist Photius, Belisars Freigelassener.»
«Nein, o Justinianus:—Er ist es, den du wieder nach Italien senden wolltest, wenn ich nicht warnte, Belisarius selbst.»
Da erbleichte der Kaiser, wankte und griff nach der Armlehne des Thrones.
«Wirst du dann an des wunderbaren Römers Ergebenheit glauben und, statt des Verräters Belisar, ihn nach Italien senden mit deinem Heer?»
«Alles, alles», sprach Justinianus, «gewiß! Belisarius also doch ein Verräter? Dann tut Eile not. Handeln wir.»
«Ich habe schon gehandelt, Justinian. Mein Netz ist unentrinnbar schon gestellt. Gib mir die Vollmacht, es zusammenzuziehn.»
Der Kaiser winkte Gewährung.
Und Theodora befahl, indem sie aus den Vorhängen schritt, dem Velarius: «Hole sogleich aus seinem Hause in mein Gemach Cethegus, den Präfekten von Rom.»
Und alsbald stand Cethegus vor seiner noch immer verführerisch schönen Jugendfreundin, die in dem uns wohlbekannten Gemach auf ihrem Pfühl ausgestreckt lag.
Galatea reichte ihr manchmal in kleiner Onyxschale die Tropfen, die ihr der persische Arzt—griechische reichten nicht mehr aus—verordnet hatte.
«Ich danke, dir, Theodora», sagte Cethegus. «Und muß ich's doch einem andern—nicht mir selber—danken—einem Weibe!—dank' ich's am liebsten doch der Jugendgenossin.»
«Höre, Präfekt», sprach Theodora, ihn ernsthaft betrachtend, «du wärest ganz der Mann—soll ich sagen der Barbar oder der Römer?—eine Kleopatra, der Cäsar und Antonius gehuldigt, erst zu küssen und dann doch im Triumph nach dem Kapitol zu führen zur Erdrosselung, wie Octavian vielleicht geplant. Wenn ihm nicht jene Schlangenkönigin zuvorkam. Kleopatra war immer mein Vorbild. Einen Cäsar hab' ich nicht gefunden. Aber die Schlange—bleibt vielleicht nicht aus.—
Du hast mir nicht zu danken. Ich habe aus voller Überzeugung gesprochen und gehandelt. Diese gotische Gefahr und Beschimpfung muß in Blut erstickt werden.
Ich war vielleicht nicht immer so treu als Gattin, wie Justinian geglaubt.
Aber ich war sein bester, treuster Senator von jeher.
Belisar und Narses sind nicht wohl zusammen und noch weniger jeder allein nach Italien zu senden. Du sollst gehen: du bist ein Held, ein Feldherr, ein Staatsmann, und du bist doch zu ohnmächtig, Justinian zu schaden.»
«Ich danke für die gute Meinung», sagte Cethegus.
«Freund, du bist ein Feldherr ohne Heer, ein Kaiser ohne Reich, ein Steuermann ohne Schiff.
Doch lassen wir's—: du willst mir nicht glauben.
Ich sende dich nach Italien aus tiefster Überzeugung:—du hassest grimmig die Barbaren. Der zweite Feldherr, den unvermeidlich dir kaiserliches Mißtrauen nachsendet, soll Areobindos sein, der Schneckenprinz: er wird dich nicht viel stören. Aber Freude macht mir's, daß ich zugleich den Jugendgenossen dabei fördern kann wie das Reich.
Ach Cethegus, die Jugend! Euch Männern ist sie goldne Hoffnung oder goldne Erinnerung:—dem Weib ist sie—: das Leben. Ah, nur noch einen Tag aus jener Zeit, da ich dir Rosen schenkte und du mir Verse.»
«Deine Rosen waren schön, Theodora, aber meine Verse waren nicht schön.»
«Mir schienen sie schön:—sie waren an mich! Aber wie alte Liebe versüßt auch alter und neuer Haß mir die Wahl, die ohnehin des Reiches Wohl erheischt. Belisar soll nicht mehr zu neuen Ehren steigen. Nein, fallen soll er, diesmal tief und für immerdar. So wahr ich herrsche in Byzanz.»
«Und Narses? Mir wäre lieber und begreiflicher, du stürztest diesen Kopf ohne Arm als jenen Arm ohne Kopf.»
«Geduld—einer nach dem andern.»
«Was hat dir der gutherzige Held getan?»
«Er? Nichts, aber sein Weib! Diese plumpe Antonina, deren ganzer Triumph in ihrem gesunden Blute liegt.» Und grimmig ballte die zierliche Kaiserin die kleine, weiße Hand, die noch durchsichtiger geworden. «Ha, wie ich sie hasse! Ja, beneide! Dumme Leute bleiben immer gesund. Aber sie soll nicht frohlocken, während ich leide.»
«Und an solchem Weiberhaß hängt das Schicksal des Kapitols», sagte Cethegus zu sich selbst. «Nieder mit Kleopatra!
Die Närrin ist vernarrt in Ruhm und Größe ihres Mannes:—hier kann ich sie am tödlichsten treffen! Warte!»
Ein Zucken durch ihr feines Gesicht verriet einen Anfall heftiger Schmerzen: sie warf sich in die Kissen zurück.
«Aber Täubchen», mahnte Galatea, «laß doch den Ärger! Du weißt, was der Perser sagt. Jede Erregung von Liebe, von Haß»——«Ha, Hassen und Lieben ist Leben. Und der Haß wird im Alter fast noch süßer denn die Liebe. Liebe ist treulos, Haß ist treu.»
«Ich bin in beiden», sprach Cethegus, «ein Stümper gegen dich. ‹Die Sirene von Kypros› hab' ich dich stets genannt. Man ist nie sicher, ob du nicht unter dem Kuß plötzlich dein Opfer zerreißest—aus Liebe oder Haß. Und was hat deine Liebe zu Antoninen plötzlich in Haß verkehrt?»
«Tugendhaft ist sie geworden, die Heuchlerin! Oder ist sie wirklich so schwachköpfig? Auch möglich! Ihr Fischblut hat sich nie in Wallung bringen lassen: für eine starke Leidenschaft und für ein starkmütiges Verbrechen war sie stets zu feig. Sie ist zu eitel, die Huldigung der Liebe entbehren, zu armselig, sie erwidern zu können. Seit sie ihren Gatten in seine Kriege begleitet, ist sie wieder ganz tugendsam geworden. Ha, ha, ha, aus Not: wie der Teufel fastet, wenn er nichts zu essen hat. Weil ich ihren Verehrer hier eingesperrt behalten!»
«Anicius, den Sohn des Boëthius? Ich hörte davon.»
«Ja, in Italien hat sie sich wieder ganz ihrem Mann angeschlossen, seinen Ruhm und sein Unglück geteilt. Und sie ist seitdem ganz Penelope, ganz die gute Ehefrau. Und hierher zurückgekehrt, was tut sie, die Gans? Macht mir Vorwürfe, daß ich sie vom Pfad der Tugend abgelockt! Und schwört, sie werde Anicius aus meinen Banden lösen. Und es gelingt ihr, der Schlange. Sie weckt dem Toren das Gewissen, reißt ihn täglich mehr von mir los, meinen ungetreuen Kämmerer natürlich, um ihn für sich zu behalten!»
«Du kannst dir also nicht vorstellen», fragte Cethegus, «daß ein Weib eine Seele für den Himmel wirbt ohne:—?»
«Ohne Prozente Bergelohn zu erheben? Nein!—Dabei täuscht sie aber sich und ihn mit frommen Reden. Und o wie gern läßt sich der Jüngling retten von der jugendlich blühenden Erretterin aus meinen Armen, der Verwelkenden, der Krankenden—der vor der Zeit Verzehrten. Ah», rief sie leidenschaftlich und sprang von dem Pfühl, «daß der Leib ermüdet erliegen muß, ehe noch die Seele sich zum tausendsten Teil ihres Dursts nach Leben ersättigt hat. Leben aber ist Herrschen, Hassen, Lieben.»
«Du scheinst unersättlich in diesen Künsten und Genüssen.»
«Ja, und ich rühme mich dessen. Und ich soll fort von des Daseins reichbesetzter Tafel, herab von diesem Kaiserthron, mit dem brennenden Heißhunger nach Freude und Macht! Und nur wenige Tropfen noch soll ich schlürfen! Oh, die Natur ist eine elende, schmähliche Pfuscherin!
Alle Äonen einmal zeugt sie, neben Myriaden von Krüppeln, häßlich an Leib und ohnmächtig an Geist, einmal zeugt sie einen Leib, eine Seele wie Theodoras, schön und stark und verlangend, die Ewigkeit hindurch zu leben und zu genießen. Und nach drei Jahrzehnten, nachdem ich kaum genippt am vollen Becher, versagt die Natur dem lechzenden Lebensdrang! Fluch über den Neid der Götter! Aber auch Menschen können beneiden: und der Neid macht sie zu Dämonen. Nicht sollen andre genießen, wo ich nicht mehr genießen kann. Nicht sollen andre lachen, wenn ich mich in Schmerzen winde Nächte durch! Nicht frohlocken soll die strotzend Gesunde mit dem Treulosen, der Theodoras war und dabei noch einer andern denken konnte, oder der Tugend, oder des Himmels.
Erst heute hat er mir gesagt, er trage nicht länger dies ruhm- und ehrlose Leben in meinen Frauengemächern:—Himmel und Erde riefen ihn hinweg. Er soll es büßen—mit ihr—! Komm, Cethegus», sprach sie grimmig, seinen Arm ergreifend, «wir wollen sie beide verderben.»
«Du vergißt», sagte Cethegus kalt, «ich habe keinen Grund, sie oder ihn zu hassen. Was ich also hierin tue, tue ich um deinetwillen.»
«Doch nicht, du kluger, eisiger Römer. Glaubst du, ich durchschaue dich nicht?»
«Hoffentlich nicht», dachte Cethegus.
«Du willst Belisar fernhalten von Italien. Allein willst du dort kriegen und siegen. Höchstens einen Schatten neben dir haben, wie Bessas war und Areobindos sein wird. Meinst du, ich habe das nicht durchschaut, als du damals vor Ravenna die Abberufung Belisars so meisterhaft eingefädelt hast? Sorge um Justinian! Was liegt dir an Justinian!»
Cethegus pochte das Herz.
«Freiheit Roms! Zum Lachen! Du weißt, daß nur starke, einfache Männer die Freiheit ertragen. Du kennst deine Quiriten. Nein, dein Ziel liegt höher.»
«Sollte dies Weib durchschauen, was alle meine Feinde und Freunde nicht geahnt?» bangte Cethegus.
«Du willst Italien allein befreit haben und allein als Justinians Statthalter Italien regieren, der nächste an seinem Thron, hoch über Belisar und Narses, der nächste nach Theodora: und, gäb es Höheres, du wärst der Geist, danach zu fliegen.»
Cethegus atmete auf. «Das wäre doch nicht all der Mühe wert», dachte er.
«Oh, es ist ein stolzes Gefühl, der erste Diener Justinians zu sein.»
«Natürlich, über ihren Mann hinaus, ob sie ihn täglich verrät, vermag sie nicht zu denken.»
«Und, als der Gehilfe Theodoras, ihn, den Kaiser,—zu regieren.»
«Die Schmeichelluft dieses Hofes betäubt zuletzt auch den hellsten Verstand», dachte Cethegus. «Das ist der Wahnsinn des Purpurs. Sie kann sich selber nur als Allbeherrscherin denken.»
«Ja, Cethegus, keinem andern gönnt' ich es, solches nur zu denken. Dir will ich's erringen helfen:—mit dir will ich die Herrschaft der Welt teilen:—Vielleicht nur um törichter Jugenderinnerungen willen: weißt du noch, wie wir vor Jahren zwei Kissen verteilten in meiner kleinen Villa? Wir nannten sie Orient und Okzident. Das war ein Omen. So laß uns jetzt Orient und Okzident verteilen. Durch meinen Justinian beherrsch' ich den Orient. Durch meinen Cethegus will ich den Okzident beherrschen.»
«Hochmütig, unersättlich Weib!» dachte Cethegus. «Wäre mir nur Mataswintha nicht gestorben, die jungfräuliche. Sie an diesem Hof—und du versankst.»
«Aber dazu», fuhr Theodora fort, «muß erst Belisar für immer aus dem Wege. Justinian war entschlossen, ihn abermals, und zwar als deinen Oberfeldherrn, zu senden.»
Cethegus furchte die Brauen.—
«Er vertraut immer wieder seiner hündischen Treue. Er muß von seiner Untreue greifbar überzeugt werden.»
«Das wird schwerhalten», meinte Cethegus. «Eher lernt Theodora die Treue, als Belisar die Untreue.» Ein Schlag der kleinen Hand auf den Mund war seine Strafe.
«Dir bin ich, törichterweise, treu geblieben,—d. h. im Wohlwollen. Willst du Belisar wieder in Italien haben?»
«Um keinen Preis.»
«Dann hilf, ihn verderben samt dem Sohn des Boëthius.»—«Sei's», sagte der Präfekt. «Ich habe keinen Grund, den Bruder des Severinus zu schonen. Aber wie? Wie willst du den Beweis von Belisars Untreue führen? Darauf bin ich gespannt. Wenn du das vermagst, erkläre ich mich, wie im Lieben und Hassen, so im Planen einen Stümper gegen Theodora.»
«Das bist du auch, schwerfälliger Sohn von Latium.
Nun höre: aber das ist so gefährlich, daß ich selbst dich, Galatea, bitten muß, Wache zu stehen, daß niemand kommt und lauscht. Nein, Goldmütterchen, nicht innerhalb,—ich bitte recht schön:—außerhalb der Türe.—Laß mich nur allein mit dem Präfekten—es gilt—leider!—nur ein Geheimnis des Hasses.»
Als nach geraumer Zeit der Präfekt das Gemach verließ, sagte er zu sich selber: «Wenn dieses Weib ein Mann wäre,—der müßte mir sterben.—Er wäre gefährlicher als die Barbaren, samt Byzanz. Aber dann freilich, dann wäre die Bosheit nicht so unergründlich teuflisch.»
Bald nachdem der Präfekt nach Haus gekommen, meldete Syphax den Sohn des Boëthius: die Kaiserin sende ihn.
«Laß ihn ein und niemand sonst, bis er fort ist. Einstweilen aber schicke schleunigst nach Piso, dem Tribun.»
Der junge Anicius, einstweilen zum Mann herangereift, trat ein. Er trug einfache Kleidung, und sein Haar, sonst künstlich gelockt und gesalbt, hing heute schlicht herab. Seine weichen Züge—sie erinnerten den Präfekten lebhaft an Kamilla—gewannen sehr durch den Ausdruck von Entschlossenheit, der heute darauf ruhte.
«Du mahnst mich an deine schöne Schwester, Anicius», mit diesen Worten empfing ihn der Präfekt.
«Ihretwegen, Cethegus, bin ich gekommen», sprach der Jüngling ernst. «Du bist der älteste Freund meines Vaters, meines Hauses. Du hast mich und Severinus in deinem eignen Hause geborgen gehalten und, mit Gefahr für dich selbst, geflüchtet, als man nach uns forschte. Du bist der einzige in Byzanz, von dem ich väterlichen Rat in einer dunkeln Pflicht erbitten kann. Erst vor wenigen Tagen erhielt ich diesen rätselhaften Brief.»
«Anicius, dem Sohne meines Patronus, Corbulo, der Freigelassene...—»
«Corbulo? Ich kenne den Namen.»
«Der Freigelassene meines Vaters, bei welchem meine Mutter und Schwester Zuflucht gefunden, und der...—»
«Mit deinem Bruder vor Rom gefallen ist.»
«Ja, aber er starb erst im gotischen Lager, wohin er, selbst schwerverwundet, mit meinem sterbenden Bruder aus dem Dorf ad aras Bacchi, gefangen gebracht wurde. So erzählt mir ein mitgefangener armenischer Söldner Belisars, Sutas, der mir den Brief überbrachte, den Corbulo nicht mehr vollenden konnte.
Lies selbst.»
Und Cethegus nahm das kleine Wachstäfelchen mit den kaum leserlichen Zügen und las: «Das letzte Wort, das Vermächtnis deines sterbenden Bruders war: Anicius soll nun rächen die Mutter, die Schwester, mich: uns alle hat derselbe Dämon unseres Hauses...——»
«Hier endet leider der Brief», sagte Cethegus, Anicius die Tafel zurückgebend.
«Ja, dem treuen Corbulo vergingen die Sinne, und er erwachte nicht mehr aus seiner Ohnmacht, sagt der Söldner.»
«Damit ist nicht viel zu machen», meinte achselzuckend Cethegus.
«Gewiß, aber der Söldner Sutas hörte noch ein Wort meines sterbenden Bruders zu Corbulo—sie lagen in einem Zelte—: das kann ein Schlüssel werden.»
«Nun?» fragte Cethegus, teilnehmend gespannt.
«Severinus sagte: Ich ahn' es. Er wußte von diesem Hinterhalt.—Er hat uns in den Tod geschickt.'»—«Wer?» fragte Cethegus ruhig. «Ja, das eben fragt sich.»—«Du hast keine Ahnung?»—«Nein, aber es kann nicht unmöglich sein, den Gemeinten zu entdecken.»—«Wie willst du das anfangen?»
«In den Tod geschickt?:—das kann nur einen Anführer, einen Feldherrn meinen, der meinen Bruder veranlaßte, an jenem Morgenritt Belisars aus dem tiburtinischen Tor sich zu beteiligen. Denn Severinus gehörte damals nicht zu dem Gefolge Belisars. Er war Tribun deiner Legionäre. Es muß gelingen, wenn du, Belisar, Prokop ernstlich nachspüren, den zu ermitteln, der ihn veranlaßte. Denn er ging nicht etwa auf deinen Befehl mit andern Legionären: keiner deiner Legionäre und Reiter war sonst dabei.»
«Das ist richtig», sagte Cethegus, «soviel ich mich entsinne.»
«Nein, nicht einer. Prokop—leider ist er nun verreist, Bauwerke Justinians in Asien kennenzulernen—war ja selbst dabei: oft zählte er mir die Namen aller auf. Wenn er wiederkehrt, werde ich sorgfältig forschen, mit wem etwa mein Bruder vor dem Ausfall zuletzt verkehrt, in wessen Haus oder Zelt er war:—ich werde nicht ruhen und rasten—, ich werde Severins noch lebende Kameraden befragen, wo sie ihn zuletzt, vor dem Ausritt, gesehn.»
«Du bist scharfsinnig für deine Jahre», sagte der Präfekt mit seltsamem Lächeln. «Wenn solche Klugheit erst zu Reife kommt! Aber freilich: du lebst in guter Schule für die Schlauheit. Weiß die Kaiserin von deinem Rätselbrief?»
«Nein, und sie soll nie davon erfahren. Nenne mir ihren Namen nicht! Diese Rachepflicht sendet mir Gott als letzten Mahnruf, mich von ihr zu reißen.»
«Aber sie sendet dich zu mir?»
«In einer andern Sache—die aber sehr gegen ihre Meinung enden soll. Vor kurzem ließ sie mich heute rufen: noch einmal fragte sie mich lächelnd, ob es denn gar so schwer im goldigsten Käfig auszuhalten sei? Mich aber ekelt des Weibes. Und mich reut schmerzlich der Monate, die ich bei ihr verloren, indes mein Bruder für das Vaterland gefochten und gefallen. Ich gab ihr so herbe Antwort, daß ich einen Sturm des Zorns erwartete. Aber zu meinem Staunen blieb sie ganz ruhig und sprach lächelnd: ‹Nun es sei: keine Treue dauert. Gehe hin zu Antonina oder zur Tugend oder zu beiden Göttinnen. Aber zum letzten Zeichen meiner Gunst will ich dich retten vor sicherem Verderben.
Es besteht in Byzanz eine Verschwörung römischer und griechischer Jünglinge gegen Justinians Leben oder Freiheit. Sie wollen ihn zwingen zum Gotenkrieg und zu Belisars Ernennung zum Feldherrn. Still, ich weiß es. Ich weiß auch, daß man dich schon halb gewonnen, daß du zwar noch keine der Versammlungen besucht hast, aber die Dokumente der Verschwörung verwahrst. Ich habe sie gewähren lassen, weil einige alte Übelgönner von mir darunter sind, die ich sicher diesmal zu verderben hoffe. In einigen Tagen ziehe ich das Netz zusammen. Du aber sollst gewarnt und gerettet sein. Geh zum Präfekten: er soll dich unter der Schar seiner Söldner aus Byzanz führen. Sage ihm nur: dir drohe Gefahr, und dich sende Theodora. Aber von der Verschwörung verrate ihm nichts: auch seiner Kriegstribunen sind etliche dabei, die er gern retten würde, ich aber verderben will.›
Und ich kam zu dir: aber nicht, um zu fliehen: um dich und meine römischen Waffenbrüder zu warnen. Ich werde auch die Versammlung besuchen—heute droht noch keine Gefahr, versicherte die Kaiserin—, sie alle zu warnen, ihnen zu sagen, daß die Verschwörung entdeckt ist. Du darfst nicht hin, Präfekt, du darfst dich nicht weiter bloßstellen: Justinian mißtraut dir bereits. Die Unsinnigen wollen warten, bis sie Belisar gewonnen haben! Und vielleicht morgen schon sind sie alle gefangen, wenn man sie nicht warnt. Ich eile heute, die Freunde zu warnen. Dann aber ruhe und raste ich nicht, bis ich den Mörder meines Bruders herausgefunden.»
«Beides sehr löblich», sprach Cethegus.—«Nebenbei gesagt, wo birgst du die Briefe der Verschworenen?»
«Wo ich», sprach der Jüngling errötend, «alle Geheimnisse, andre, heiligere barg—mir unendlich teure Briefe und auch diese Tafel bergen will—, du sollst darum wissen: denn du, der älteste Freund unsres Hauses, du sollst mein Rachewerk mit vollenden helfen. Auch die Aussagen des Söldners Sutas über kaum verständliche Reden der beiden Sterbenden habe ich am gleichen Ort geborgen. Sie lauteten von ‹Giftmord›, von dem ‹mörderischen Befehl›, von einer ‹Anklage vor dem Senat›—also muß der Feind römischer Senator gewesen sein,—vom ‹purpurroten Helmbusch›, vom ‹schwarzen Höllenroß›.»
«Und so weiter», unterbrach Cethegus. «Wo ist der Versteck? Du kannst einmal wirklich rasch entfliehen müssen, denn ich rate dir doch sehr, der Kaiserin nicht zu traun, du erreichst vielleicht einmal dein Haus nicht mehr.»
«Und dann ist es notwendig, daß du mein Werk aufnehmest. Ich wollte dir schon selbst sagen: in der Zisterne im Hof meines Wohnhauses—der dritte Ziegel links vom Schöpfrad ist hohl.
Auch schon deshalb», fuhr er finsterer fort, «sollst du davon wissen... Wenn die Freunde, die Verschwornen nicht zu retten sein sollten—wenn meine eigne Freiheit bedroht wird—denn du hast recht mit deiner Warnung: ich bemerke schon lange, daß mir Späher nachschleichen—des Kaisers oder der Kaiserin?—dann mach' ich rasch ein blutig Ende—: Was liegt dann an meinem Leben?—Wenn ich den Auftrag Severins doch nicht mehr erfüllen kann—dann—ich habe dem Kaiser jeden Morgen zu melden, wie die Kaiserin geruht—stoß' ich den Tyrannen nieder in Mitten seiner Sklaven.»
«Wahnsinniger!» rief Cethegus in aufrichtigem Schreck—denn nun wollte er Justinian am Leben und in Herrschaft erhalten—«wohin reißt dich die Reue und ein planlos zerfahrenes Leben? Nein, der Sohn des Boëthius darf nicht als Mörder enden. Willst du in Blut deine ruhmlose Vergangenheit sühnen,—wohlan, so kämpfe unter meinen Legionären: im Blut der Barbaren reinige dich, mit dem Schwerte des Helden, nicht mit dem Dolch des Meuchlers.»
«Du sprichst groß und wahr. Und du willst mich, den Unerprobten, deinen Rittern beigesellen! Wie kann ich dir danken?»
«Spare den Dank, bis alles vollendet—: bis wir uns wiedergesehn. Einstweilen warne heute abend die Verschwornen. Das ist schon eine Probe des Mutes. Denn ich halte es nicht für ungefährlich, da man dir nachschleicht. Wenn du die Gefahr scheust—sag' es offen.»
«Ich soll die erste Probe des Mutes scheuen? Ich komme, zu warnen: und ob mich drum der sichre Tod erwarte.» Und er drückte des Präfekten Hand und eilte hinweg.
Sowie er entfernt war,—nur einen Blick warf ihm der Präfekt nach—führte Syphax den Tribun Piso aus einem andern Eingang in das Gemach.
«Tribun der Jamben», rief ihm Cethegus zu, «jetzt heißt es raschfüßig sein, wie deine Verse. Genug der Verschwörungen und der Katzentritte hier in Byzanz! Augenblicklich suchst du alle jungen Römer auf, die im Hause des Photius verkehrten. Keinen von euch darf die Abendsonne mehr in diesen Mauern finden. Es gilt das Leben. Keiner darf zu dem ‹Abendschmause› des Photius kommen. Einzeln, in Gruppen, geht auf die Jagd: fahrt Segel um die Wette, auf dem Bosporus: aber eilt hinweg.
Die Verschwörung ist überflüssig.
Bald ruft wieder schmetternd die Tuba zum Kampf gegen die Barbaren in Latium. Fort mit euch allen! Harret meiner zu Epidamnus. Von da hol ich euch mit meinen Isauriern ab: zum dritten Kampf um Rom.
Fort mit dir!
Syphax», forschte er, mit diesem jetzt im Gemach allein, «hast du nachgefragt in des großen Feldherrn Hause? Bis wann wird er zurückerwartet?»
«Bis Sonnenuntergang.»
«Die treue Gattin harret in seinem Hause? Gut. Eine Sänfte,—nicht die meine—: miete die nächste vor dem Hippodrom, deren Läden ganz verschließbar sind. Führe sie in die Hafenstadt, in die Hinterstraße der Trödler.»
«Herr, dort wohnt das ärgste Gesindel dieser gesindelreichen Bettlerstadt. Was willst du dort?»
«Einsteigen in die Sänfte. Dann nach dem roten Hause.»
In dem roten Hause, dem Palaste Belisars, in der Neustadt «Justinina» (Sycä) saß Antonina in dem Frauengemach, emsig in Arbeit vertieft. Sie stickte an einem mit goldnen Lorbeeren verbrämten Mantel für den Helden Belisarius.
Auf dem Citrustischlein neben ihr lag, in kostbarem Umschlag, mit Edelsteinen besetzt, ein mit Purpurtinte geschriebenes Prachtexemplar von Prokops «Vandalenkrieg», dem kürzlich erschienenen Werke, das den glänzendsten Feldzug ihres Gemahls beschrieb.
Zu ihren Füßen lag ein herrlich Tier, einer aus dem Doppelpaar der zahmen Jagdleoparden, die der Perserkönig nach dem letzten Frieden dem Sieger Belisar geschenkt—: eine höchst kostbare Gabe, da nur selten die Zähmung völlig sicher gelang und viele hundert der jung eingefangenen oder auch in der Gefangenschaft geworfenen Jungen nach jahrelanger Abrichtung als unzähmbar getötet werden mußten.
Das wunderschöne, große und starke Tier—es verwilderte zu leicht auf der Jagd durch Genuß warmen Blutes und war deshalb zu Hause gelassen worden—streckte sich behaglich, wie eine Hauskatze, auf Antoninens Gewand, spielte mit dem Knäuel von Goldfaden, ringelte den Schweif und rieb den runden, klugen Kopf und den Bug an der Gebieterin Füßen.
Da meldete die Sklavin einen fremden Mann,—in unscheinbarer Mietsänfte sei er angekommen und in schlechtem Mantel—: man habe ihn abweisen wollen, da der Hausherr fern und Antonina in seiner Abwesenheit keinen Besuch mehr empfange. «Aber man kann ihm nicht widerstehn! Er befahl: ‹Meldet Antoninen den Überwinder des Papstes Silverius.›»
«Cethegus!» rief Antonina: sie erbleichte und zitterte.
«Laßt ihn schleunigst ein.»
Die Überlegenheit, die der gewaltige Geist in jener ersten Stunde ihrer Begegnung über sie gewonnen und nie wieder verloren hatte, die Erinnerung, wie dieser Mann, als ihr Gatte und der kluge Prokop und all die Heerführer vor dem Priester widerstandslos erlegen waren, den Überwinder überwunden und gedemütigt hatte, wie er dann, bei dem Einzug in Rom, in der Schlacht an der Aniobrücke, in Roms Verteidigung gegen Witichis, in dem Lager vor Ravenna, bei der Gewinnung dieser Stadt, immer und überall seine Obmacht bewährt und sie doch nie feindlich gegen Belisar gebraucht hatte—wie Unheil nur aus dem Widerstreben gegen seine Warnungen gefolgt—wie jeder seiner Ratschläge an sich siegreich gewesen war—all diese Erinnerungen schossen nun verwirrend und betäubend in ihrem Haupte zusammen.
Die Schritte des Präfekten nahten. Sie stand hastig auf.
Der Leopard, unsanft weggeschoben und um des Eindringlings willen aus seinem behaglichen Spiel aufgestört, richtete sich leise knurrend auf, drohend gegen den Eingang blickend, und die gelben Zähne fletschend.
Ungestüm schlug der Eintretende die Vorhänge zurück und steckte das halb von der Kapuze bedeckte Haupt herein.
Das erschreckte oder reizte den Leopard:—bei der ersten Bändigung bedienten sich die persischen Löwen- und Tigerzüchter langer Wollteppiche und Gesicht und Hals schirmender Vermummungen:—Erinnerung an einen alten Feind mochte in dem grimmen, nie ganz gebändigten Tier erwacht sein: mit furchtbarem Wutgeschrei duckte es sich zum tödlichen Ansprung, den Boden mit der langen Rute peitschend und Geifer spuckend—: das sichere Anzeichen grimmigster Wut.
Entsetzt erkannte das Antonina. «Flieh, flieh, o Cethegus», schrie sie.
Tat er das, wandte er den Rücken, so war er verloren—, so saß ihm das Untier festgebissen auf dem Nacken.
Denn keine verschließbare Tür, nur Vorhänge sperrten den Rückweg.
Er trat rasch vor, warf die Kapuze zurück, blickte scharf in des Leoparden Augen, den Zeigefinger der Linken gebietend erhoben und ein breites, blitzendes Dolchmesser gerade vor sich hin streckend.
«Nieder! Nieder! Heiß Eisen sonst droht!» So rief er in persischer Sprache dem knurrenden Untier entgegen, noch einen Schritt vortretend.
Da brach der Leopard in ein winselndes Heulen der Furcht aus: die zum Sprung gekrümmten Muskeln erschlafften: winselnd kroch er, auf allen vieren sich vorschiebend, heran und leckte, zitternd vor Furcht, dem Manne die Sandale des linken Fußes, indes ihm dieser den rechten Fuß fest auf den Nacken setzte.
Antonina war vor Entsetzen auf die Knie gesunken: starr blickte sie jetzt auf das furchtbar schöne Bild.
«Das Tier—die Proskynese!» stammelte sie. «Dareios hatte sie immer verweigert:—er wurde wütend, wann Belisar sie erzwingen wollte:—Wo hast du, Cethegus, das gelernt?»
«In Persien natürlich», sagte dieser. Und er stieß dem ganz gebrochenen Tier so heftig den Fuß in die Rippen, daß dieses, laut aufschreiend vor Schmerz, hinwegfuhr und in der fernsten Ecke des Zimmers Schutz suchte, wo es zitternd, die Augen ängstlich auf den Mann gerichtet, liegen blieb.
«Belisarius hat nur die Burgen, nie die Sprache der Perser bemeistert», sagte Cethegus: «diese Bestien aber verstehen nicht griechisch. Du bist ja grimm gehütet, wenn Belisar fern ist», fuhr er fort, den Dolch wieder in den Brustfalten bergend.
«Was führt dich in sein Haus?» fragte, noch bebend, Antonina.
«Die oft verkannte Freundschaft. Es gilt, deinen Gatten zu retten, der den Mut des Löwen, aber nicht die Geschicklichkeit der Maus besitzt! Prokop ist leider fern. Sonst hätt' ich diesen ihm vertrauteren Berater gesendet. Ich weiß, daß Belisar von dem Kaiser ein schwerer Schlag droht. Es gilt ihn abzuwenden. Des Kaisers Gunst...—»
«Ist wankelhaft, ich weiß es. Aber die Verdienste Belisars—»
«Gerade diese sind sein Verderben. Einen Unbedeutenden würde Justinian nicht fürchten. Aber er fürchtet Belisarius.»
«Das haben wir oft erfahren», seufzte Antonina.
«Wisse denn—du zuerst von allen, was niemand außerhalb des Palastes ahnt—: des Kaisers Schwanken ist seit heut' entschieden—: für den Gotenkrieg.»
«Endlich!» rief Antonina, und ihr Antlitz hellte sich auf.—«Ja, aber—bedenke die Schmach!—: nicht Belisar ist zum Feldherrn bestimmt.»—«Wer sonst?» fragte Antonina zornig. «Ich bin der eine Feldherr...—» Mißtrauisch blickte sie auf ihn.
«Ja, das war mein Streben schon lang: ich gestehe es.
Aber der zweite soll Areobindos sein. Ich kann mit diesem Schattenmann nichts anfangen. Ich kann nicht neben ihm, mit ihm, gehemmt durch seinen Unverstand, die Goten besiegen. Die Goten besiegt niemand als Belisarius. Deshalb muß ich ihn wieder neben mir, meinetwegen über mir, als Oberfeldherrn, mit mir haben. Sieh, Antonina, ich halte mich für den größeren Staatsmann—»
«Mein Belisar ist ein Held, kein Staatsmann», sagte die stolze Gattin.
«Aber lächerlich wäre es, mich als Feldherrn mit dem Vandalen-, Perser- und Goten-Besieger zu vergleichen. Sieh, ich gestehe dir ja ganz offen: nicht bloß Wohlwollen für Belisarius, auch Selbstsucht leitet mich dabei.
Ich muß Belisar zum Waffengenossen haben.»—«Das leuchtet mir ein», sagte sie wohlgefällig.
«Justinian ist aber nicht zu bewegen, Belisarius zu ernennen. Noch mehr: er mißtraut ihm aufs neue: und zwar mehr denn je.»
«Weshalb aber, bei allen Heiligen?»
«Belisarius ist zwar unschuldig, aber sehr unvorsichtig. Seit Monden erhält er heimlich Briefe, Zettel, Mahnungen zugesendet, in den Mantel im Bade gesteckt, in den Garten geworfen,—die ihn zur Teilnahme an einer Verschwörung auffordern.»
«Himmel, du weißt davon?» stammelte Antonina.
«Leider nicht nur ich, auch andre Leute—: der Kaiser selbst!»—«Es gilt aber nicht des Kaisers Leben oder Thron», beschwichtigte Antonina. «Nein, nur seiner Freiheit, seiner Selbstbestimmung: ‹Krieg gegen die Goten›—‹Belisar Feldherr›—‹schmählich ist's, den Undankbaren dienen›—‹zwing den Herrn zum eignen Vorteil›—So und ähnlich lauteten die Zettelchen, nicht wahr? Nun, Belisar hat zwar nicht Folge geleistet. Aber er hat auch, der Unkluge, nicht gleich den ersten Wink von diesen Aufforderungen dem Kaiser angezeigt! Das kann Belisars Kopf kosten!»
«O alle Heiligen!» rief Antonina händeringend, «er unterließ es auf meinen Rat, auf mein Bitten. Prokop riet ihm—wie du jetzt—gleich alles dem Kaiser zu melden. Aber ich zitterte vor des Kaisers Mißtrauen, das schon in der Aufforderung an Belisar einen Schein der Schuld erblicken konnte.»
«Das war es wohl nicht allein», sprach Cethegus vorsichtig, erst nach Lauschern sich umblickend, «was deinen Rat bestimmte, dem Belisar, wie immer, folgte.»
«Was sonst? Was kannst du meinen?» forschte Antonina leise. Sie errötete über und über.
«Du wußtest, daß gute Freunde eures Hauses beteiligt waren:—diese wolltest du erst warnen, erst lösen von den Schuldigen, ehe sie angezeigt würden.»—
«Ja», stammelte sie, «Photius, sein Freigelassener—»
«Und noch ein andrer», flüsterte Cethegus, «der doch nicht, aus Theodoras goldnem Kerker kaum befreit, gleich in die Gewölbe des Bosporus wandern sollte.»
Antonina schlug beide Hände vor das Antlitz.
«Ich weiß alles, Antonina:—die geringe Schuld von früher—die starken guten Vorsätze späterer Zeit.
Aber hier hat dich die alte Neigung bestrickt. Statt nur an Belisar zu denken, hast du auch an sein Wohl gedacht. Und wenn nun darüber Belisar untergeht—wes ist die Schuld?»
«O halt ein, erbarme dich», flehte Antonina.
«Verzage nicht», fuhr Cethegus fort. «Dir bleibt ja eine starke Stütze—eine Fürsprecherin bei Justinian. Wenn auch vielleicht Verbannung droht—das Äußerste wird doch die Fürbitte deiner Freundin abwenden, der Allmächtigen.»
«Die Kaiserin! Weh uns!» rief Antonina entsetzt. «Wie wird sie alles darstellen! Ach, sie hat uns den Untergang geschworen.»
«Dann ist's schlimm», sprach Cethegus, «sehr schlimm. Denn auch die Kaiserin weiß von der Verschwörung und von den Ladungen an Belisar. Und du weißt: viel geringere Schuld als die, zu einer Verschwörung aufgefordert zu sein, genügt...»
«Die Kaiserin weiß es? Dann sind wir verloren! O du, der du Auswege zu finden weißt, wo kein Auge sonst sie sieht:—hilf, rette.»
Und die stolze Gestalt sank flehend vor dem Präfekten nieder.
Aus der Zimmerecke erscholl ein klägliches Geheul, bei diesem Anblick schüttelte den Leoparden aufs neue die Furcht.
Einen raschen Blick warf der Präfekt auf den heulenden Gegner—dann erhob er sanft die Kniende.
«Auf, Gattin Belisars, verzage nicht. Ja, es gibt ein Mittel, Belisar zu retten. Aber nur eines.»
«Soll er jetzt die Anzeige machen, sobald er heimkehrt?»
«Das ist zu spät. Und zu wenig. Man würde ihm nicht glauben, daß es ihm Ernst mit bloßen Worten. Nein, er muß in Taten seine Treue beweisen. Er muß die Verschworenen alle zusammen fassen und alle zusammen dem Kaiser ausliefern.»
«Wie kann er sie zusammen fassen?»
«Sie laden ihn ja selbst. Heute nacht, in des Photius, seines Freigelassenen, Hause versammeln sie sich. Wohlan: er sage zu, ihr Haupt zu werden. Er erscheine und nehme sie dort alle gefangen.—
Anicius», fügte er rasch bei, «ist von der Kaiserin selbst gewarnt für heute nacht—er war bei mir.»
«Oh, und müßt' er sterben:—es gilt ja, Belisar zu retten. Er muß es tun! Ich seh' es ein. Und es ist kühn, gefährlich—es wird ihn reizen.»
«Wird er seinen Freigelassenen opfern?»—
«Siebenmal haben wir den Toren vergebens gewarnt. Was liegt an Photius, wenn es Belisar gilt. Wenn ich je Gewalt über ihn gehabt:—heute werd' ich ihn überzeugen. Schon früher riet ihm Prokop, einmal einen solchen, wie er sagte, brutalen Beweis seiner Treue zu führen, nachdem er nicht gleich die erste Aufforderung dem Kaiser mitgeteilt. Ich werde ihn dieses Rats Prokops erinnern. Sei gewiß: er folgt meinem, unsrem übereinstimmenden Rat.»
«Gut, er soll vor Mitternacht dort sein. Wann der Wächter auf den Mauern die zwölfte Stunde ausruft, breche ich in den Saal: und, auf daß er ganz sicher geht, soll er nur eintreten, wenn er meinen Mauren Syphax in der Nische des Hauses hinter der Petrus-Statue sieht. Auch kann er einige seiner Leibwächter vor das Haus stellen: sie sollen ihn decken für den Notfall und Zeugnis ablegen für ihn. Große Verstellungskunst wird ihm nicht zugemutet. Er soll erst kurz vor Mitternacht eintreten: er braucht dann nur zu hören, nicht zu reden. Unsere Wachen harren im Hain des Constantinus vor der Hintertür des Muschelhauses des Photius: mit dem Ausruf der Mitternacht—die Tuba bläst die Ablösung der Wachen, du weißt, man hört es deutlich—brechen wir ein. Er braucht also gar nicht das Wagnis zu übernehmen, ein Zeichen zu geben.»
«Und du,—du kommst gewiß?»
«Ich werde nicht fehlen. Leb' wohl, Antonina.»
Und rasch war er, rückwärts schreitend, das Antlitz dem gebändigten Tiere zugekehrt, das Messer zückend, an dem Ausgang. Der Leopard hatte auf den Moment gewartet: er regte sich leise in der Ecke, sich aufrichtend.
Da aber, zwischen den Vorhängen, erhob Cethegus nochmal den Stahl und drohte. «Nieder, Dareios! Heiß Eisen sonst droht.»
Und er war hinaus.
Der Leopard duckte den Kopf auf den Mosaikestrich und stieß ein kläglich Geheul ohnmächtiger Wut aus.
König Totila war mit Flotte und Heer nach Rom zurückgekehrt, in den eroberten Städten nur kleine Besatzungen lassend, nachdem der Kaiser auf Grund seiner Forderungen Friedensverhandlungen eröffnet und einen Waffenstillstand von sechs Monaten erbeten hatte, vor dessen Ablauf der Friede durch byzantinische Gesandte geschlossen werden sollte, die er in Bälde nach Rom zu schicken versprach.
Das Glück Totilas und der Glanz seiner Herrschaft standen nun auf der Höhe des Ruhmes.
Der siegreiche Angriff auf das byzantinische Reich hatte seinem Namen weithin leuchtenden Schimmer verliehen. Auch auf Italien warf er wirkungsvolle Strahlen.
Die beiden letzten, von den Byzantinern behaupteten Städte waren Perusia in Tuscien und Ravenna, das unbezwingbare. Perusia ergab sich nun nach langer, zäher Verteidigung dem Grafen Grippa: und selbst von Ravenna fiel der wichtigste Teil, die Hafenstadt Classis, endlich in die Hand des alten Hildebrand, der nun seit mehr als achtzehn Monden die Feste umschlossen hielt.
Da jetzt die Verpflegung der Stadt von der See her abgeschnitten werden konnte,—der König hatte den Auftrag gegeben, alle bisher vereinzelten Geschwader zu einer starken Flotte bei Ancona zu sammeln und den Hafen Classis zu sperren—war ihr baldiger Fall durch Aushungerung zu erwarten.
So war denn nur noch ein einziger Schritt zu tun zur vollen Lösung des Gelübdes, das Totila dereinst dem sterbenden Vater Valerias geleistet. Nur in der Landseite von Ravenna noch standen Byzantiner auf italischem Boden: in wenigen Wochen mußte die Stadt die Tore öffnen, und nichts stand mehr der Vermählung des Gotenkönigs mit der schönsten Tochter Italiens im Wege.
Totila beschloß, diesen Schritt vorzubereiten durch eine öffentliche, feierliche Verlobung mit seiner Braut, durch ein glanzvolles Siegesfest, das die errungenen Erfolge verherrlichen, die Geliebte dem ihm nicht wohlgefälligen Einfluß des Klosters entziehen und sie, die künftige Königin, dem Hofe, dem Reiche zeigen sollte: denn bisher hatten ja nur Graf Teja und die vertrautesten Freunde Totilas Brautschaft und Braut gekannt. Cassiodor und Julius hatten als hohe Ehre den Auftrag angenommen, die Verlobte des Königs aus Taginä abzuholen und nach Rom zu führen.
Südwestlich vom jetzigen Monte Testaccio, wo der Tiber längs der aurelianischen Umwallung hinläuft und die Stadt verläßt, ragte auf sanftem Hügel eine alte kaiserliche Villa aus der Zeit der Antonine.
Totila liebte den Ort, der von der Höhe einen wundervollen Ausblick den Fluß hinab und in die Campania gewährte: den Fluß, den jetzt wieder zahlreiche kleine Handelsschiffe bevölkerten, die von dem Hafen Portus herauf die Frachten der großen Seeschiffe in die Stadt führten: die Campania mit ihren wieder aus dem Schutt und der Zerstörung von zwei Belagerungen emporsteigenden Landhäusern.
Mit geringer Nachhilfe hatte der König den alten Cäsarenpalast wieder wohnlich herstellen lassen, auf der prachtvollen, breiten Terrasse vor der Villa, welche die Krone der bis an den Fluß hinabsteigenden Marmortreppe bildete, sollte die Festfeier ihre reich geschmückte Stätte finden.
Totila hatte von Neapolis den alten Bildhauer Xenarchos, der zuerst die Dioskuren zusammengefügt, entboten und ihn beauftragt, aus der Fülle von verfügbaren Statuen in Rom und den nächsten Städten die vorzüglichsten zu wählen und sie auf den leeren Postamenten zu beiden Seiten der Marmortreppe aufzustellen. Mit liebevollem Eifer hatte sich der Alte seines Auftrags entledigt: und eine herrliche Doppelreihe von Göttern, Göttinnen und Heroen schloß bald von beiden Seiten die Mamorstufen ein.
Die Terrasse war überwölbt von einem weiten Purpurzelt, wie man sie über die Räume des Amphitheaters spannte, zum Schutz gegen die Sonne, geöffnet aber gegen den kühlenden Wind vom Flusse her: nach rückwärts verlief die Terrasse in das säulengetragene Vestibulum der Villa.
Das Königszelt, die Treppe, das Vestibulum, die ganze Villa waren aber umschlungen von zahllosen Gewinden des immergrünen Laubes, das im Winter und Sommer den Garten Italias schmückt.
Von der Spitze des Königszeltes wallte stolz durch die römischen Lüfte das neue, prachtvolle Banner Totilas, das Valeria und ihre Genossinnen zu Taginä kunstvoll mit Gold und Silber in hellblaue Seide gestickt: den goldnen Schwan zeigend, der gegen den blauen, von silbernen Sternen besäten Himmel mit ausgespannten Schwingen auffliegt. Höher noch ragte zur Rechten das alte, ruhmvolle Amalungenbanner Dietrichs von Bern, mit dem steigenden goldnen Löwen. Niedriger, zur Linken, eine Trophäe: das Banner Belisars, das Totila vor dem tiburtinischen Tor erbeutet hatte, das war als Siegeszeichen mit gesenkter Spitze aufgesteckt.
Es war der Tag der Juni-Kalenden, auf den das Siegesfest angesetzt war.
Die Bevölkerung Roms wogte von den frühesten Morgenstunden an durch die geschmückten Straßen und Plätze der Stadt gegen den aventinischen Hügel und den Fluß, der von zahllosen Gondeln belebt war: rings um die Villa hin waren Zelte, Laubhütten, Tische aufgeschlagen, an denen das Volk von Rom gespeist wurde.
Nachdem Cassiodor in der Sankt Peterskirche unter den Gebeten eines arianischen und eines katholischen Priesters—der letztere war Julius—die Tochter seines alten Freundes dem König verlobt und sie die Ringe getauscht hatten, schritt das Paar in glänzendem, feierlichem Aufzug über den Janiculus gegen das rechte Tiberufer, überschritt den Fluß auf der festlich geschmückten, von Laubbogen überwölbten Brücke des Theodosius und Valentinian und erreichte dann, dem Laufe des Stromes folgend, unterhalb des Emporiums die Festhalle der Villa.
Hier, im Angesicht des versammelten Volksheeres, unter dem an seinem Speer aufgehängten Goldschild des Königs, trat die Römerin in den linken Schuh des gotischen Bräutigams, und er legte die gepanzerte Rechte auf ihr dunkles, von durchsichtigem Schleier bedecktes Haar.
So war die Verlobung nach kirchlichem, nach römischem und nach germanischem Brauch geschlossen.
Nun nahm das Brautpaar an dem Mitteltisch der Terrasse Platz, Valeria von edeln Römerinnen und Gotinnen, Totila von Herzogen und Grafen seines Heeres umgeben; abwechselnd spielten und sangen griechische und römische Flötenspieler: und römische Tänze wechselten mit dem Schwertersprung gotischer Jünglinge, indessen auf dem Fluß, an beiden Ufern desselben und rings um die Villa her die römischen und gotischen Gäste des Königs gemeinsam schmausten, tranken und den milden Herrn und seine schöne Braut um die Wette feierten.
Ernst sinnend blickte Valeria in die Ferne, sie öffnete leise die Lippen. «Welchen Namen nanntest du?» fragte sie der König, ihr seinen Becher zum Vortrinken reichend. Sie tat Bescheid und sprach, die goldne Schale zurückgebend: «Miriam!»—«Miriam Dank und Ehre!» sagte der König, ernst den Becher hebend.
Aber da klang es goldhell von Harfensaiten: und in ganz weißem, goldgesäumtem Festgewand, einen Kranz von Lorbeern und Eichenblättern um die Schläfe, trat Adalgoth vor das Paar, warf noch einen fragenden Blick auf seinen Harfen- und Waffenlehrer, Graf Teja, der dem König zur Rechten saß, und sang mit heller Stimme zu den Akkorden seiner Harfe:
«Hört, alle Völker, fern und nah,
Byzanz, vernimm es wohl:
Der Gotenkönig Totila
Thront hoch im Kapitol!
Wie weit ist doch vom Tiberstrom
Held Belisar verschreckt:
Vom Orkus ist, nicht mehr von Rom,
Cethegus nun Präfekt.
Aus welchen Blättern ziemt ein Kranz
Dem König Totila?—
An seiner Brust in Rosen Glanz
Erglüht Valeria.
Den Frieden schirmet und das Recht
Sein Schwert, sein Schild, sein Stern:
Olive, leih dein fromm Geflecht
Mir für den Friedensherrn!
Wer trug den Schreck des Rachekriegs
Gewaltig bis Byzanz?
Komm, Lorbeer, welsches Kraut des Siegs
Komm reich in meinen Kranz!
Doch nicht wuchs ihm die Siegeskraft
Aus Romas Moderstaub:
Frisch kröne seine Heldenschaft
Germanisch Eichenlaub.
Hört, alle Völker, fern und nah,
Byzanz, vernimm es wohl:
Der Gotenkönig Totila
Thront hoch im Kapitol!»
Rauschender Beifall folgte seinem Lied, indes ein römischer Knabe und ein gotisches Mädchen, vor dem Brautpaare kniend, je einen Kranz von Rosen, Oliven, Lorbeern und Eichenblättern überreichten.
«Auch unsere Sänger, Valeria», lächelte Totila, «sind nicht ganz ohne Wohllaut. Und nicht ohne Kraft und Treue. Mein Leben dank' ich dem Sänger da.» Und er legte die Hand auf Adalgoths Haupt.—«Gar unsanft schlug er deinem Landsmann Piso, seinem Kollegen in Apollo, auf die geschickt skandierenden Finger:—zur Strafe, daß er an meine Valeria mit diesen Fingern wohl manchen Vers geschrieben und in derselben Hand nun das tödliche Eisen gegen mich schwang.»
«Nur eins hätt' ich noch lieber gehört, mein Adalgoth», sagte Teja leise zu diesem, «als dein Jubellied.»
«Was, mein Schwert- und Harfen-Graf?»
«Den Todesschrei des Präfekten, den du leider nur im Gesang in die Hölle geschickt hast.»
Aber Adalgoth ward von einer Menge von gotischen Kriegern die Treppe hinabgerufen und lange nicht wieder freigegeben: denn seinen gotischen Hörern, welche die Siege Totilas mit erfochten, gefiel sein Lied viel besser als es vielleicht dir, liebe Leserin, gefällt.
Herzog Guntharis umarmte und küßte ihn und sprach, indem er ihn zur Seite führte: «Mein junger Held! Das ist ein Ähnlichkeit! So oft ich dich sehe, ist mein erster Ausruf, Alarich.»
«Ei, das ist mein Schlachtruf», sagte Adalgoth, und im Gespräch verschwanden sie unter der Menge.
Gleichzeitig blickte der König nach der Säulenhalle der Villa zurück, da plötzlich das Spiel der dort aufgestellten Flötenbläser abbrach. Er erkannte den Grund wohl: und er selbst sprang, mit einem Rufe des Staunens, von seinem Sitz.
Denn zwischen den beiden kranzumwundenen Mittelsäulen des Eingangs stand eine Gestalt, die nicht irdisch schien. Ein wunderholdes Mädchen in ganz weißem Gewand, einen Stab in der Hand und einen Kranz von weißen Sternblumen um das Haupt.
«Ah, was ist das? Lebt dies reizvolle Bild?» fragte erstaunt der König.
Und alle Gäste, all' die Frauen und Männer umher, folgten dem Blick seines Auges, der Bewegung seiner Hand mit Staunen. Denn was an der schmalen Öffnung die Blumengewinde übriggelassen, war ausgefüllt von einer lieblichen Erscheinung, derengleichen sie nie geschaut.
Das Kind—oder Mädchen—hatte das glänzend weiße Linnenkleid auf der linken Schulter mit einer Saphirspange geheftet: den breiten, goldnen Gürtel schmückte ein großer Kreis von Saphiren: wie zwei weiße Flügel fielen die langen weißen Zipfelärmel von ihren Schultern: Efeuranken umwoben die ganze Gestalt, die Rechte hielt, auf der Brust ruhend, den blumenumwundenen, gekrümmten Hirtenstab: die Linke hielt einen wundervollen Kranz von Waldblumen und ruhte auf dem mächtigen Haupt eines großen, braunzottigen Hundes, der um den Hals auch einen Blumenkranz trug. Ohne Furcht, sinnig, forschend fiel ihr Blick über die glänzende Versammlung. Staunend harrten eine Weile die Gäste, regungslos stand das Mädchen.
Da stand der König auf von seinem Thron, schritt auf sie zu und sprach: «Willkommen in der Goten Königssaal, bist du ein irdisch Wesen», lächelte er. «Bist du aber,—was ich fast lieber glauben möchte—der Licht-Elben wundervolle Königin,—nun, so sei uns auch willkommen: dann muß dir ein Thron hoch über des Königs Sitz gerüstet werden.» Und anmutig begrüßend lud er sie, mit beiden Armen winkend, näher.
Sie aber trat nun, schwebenden Schrittes, über die Schwelle der Säulenhalle auf die Terrasse, errötete und sprach: «Wie sprichst du doch liebliche Torheit, Herr König! Ich bin keine Königin. Ich bin ja Gotho, die Hirtin. Du aber bist—ich seh's mehr an deiner lichten Stirn als an dem Goldreif—du bist Totila, der Gotenkönig, den sie den Freudenkönig nennen.
Da hast du Blumen, du und deine schöne Braut—ich hörte: eurer Verlobung gilt dies Fest—Gotho hat nichts andres zu spenden: ich pflückte und wand sie, wie ich des Weges durch die letzten Haine kam. Und nun, König, der Waisen Schirmherr und des Rechtes Schutz, nun höre mich und hilf mit deinem Schutz.»
Der König nahm wieder neben Valeria Platz: das Mädchen stand zwischen beiden: die Braut faßte ihre Hand: der König legte ihr die Hand aufs Haupt und sprach: «Bei deinem eignen wundersamen Haupte schwör' ich dir Schutz und Recht. Wer bist du? und was ist dein Begehr?»
«Herr, ich bin eines Bergbauern Enkelin und Kind. Ich bin erwachsen auf dem Iffaberg unter Blumen und Einsamkeit. Ich hatte nichts Herzliebes auf Erden als einen Bruder. Der ist mir davon gezogen, dich zu suchen. Und als der Großvater zu sterben kam, schickte er mich zu dir: bei dir soll ich den Bruder, Recht und Schicksalslösung finden.
Und er gab mir zu Begleitung den alten Hunibad mit von Teriolis: aber dessen Wunden waren nicht ausgeheilt, und sie brachen bald wieder auf, und schon in Verona blieb er liegen. Und lange Zeit hatt' ich ihn zu pflegen, bis auch er starb.
Und dann zog ich ganz allein, nur mit Brun, dem treuen Hunde, quer durch all dies weite, heiße Land, bis ich endlich Romaburg und dich gefunden.
Und gute Ordnung hältst du, Herr König, in deinem Land:—man muß dich loben. Deine Königsstraßen sind Tag und Nacht bewacht von deinen Sajonen und Lanzenreitern. Und gar freundlich und gut waren sie mit dem einsam wandernden Kinde. Und wiesen mich jede Nacht zu einem Hause guter Goten, wo die Hauswirtin mein pflegte. Und sie sagen ja: solchen Rechtsfrieden schirmst du im Lande, daß man goldne Spangen auf deine Königsstraßen legen und sie nach vielen, vielen Nächten dort sicher wieder finden kann.
Und in einer Stadt, Mantua glaub' ich, hieß sie, war, gerade als ich über den Markt schritt, groß Gedräng, und alles Volk lief zusammen. Und deine Sajonen führten einen Römer in ihrer Mitte zum Tode und riefen: ‹Marcus Massurius muß des Todes sterben auf König Totilas Befehl: er hatte ihn freigegeben, den Kriegsgefangenen: da raubte der Freche mit Gewalt ein jüdisches Mädchen: König Totila hat des großen Theoderich Gesetz erneut.› Und sie schlugen ihm den Kopf ab auf offnem Markt, und alles Volk erschrak vor König Totilas Gerechtigkeit.
Nun, treuer Brun, hier darfst du schon rasten, hier tut mir niemand was zuleide. Auch seinen Hals hatt' ich, euch zu Ehren, heut' mit Blumen bekränzt.»
Und sie schlug dem gewaltigen Hund leise auf sein zottiges Haupt: mit einem klugen Blick trat er vor an des Königs Thron und legte die linke Vorderpranke zutraulich auf dessen Knie. Und der König gab ihm Quellwasser zu trinken aus flacher, goldner Schale. «Für goldne Treue», sprach er, «goldnen Becher. Wer aber ist dein Bruder?»
«Ja», sagte sie nachdenklich, «nach vielem, was mir Hunibad unterwegs und auf dem Krankenbett erzählt, glaub' ich, daß sein Name nicht der rechte. Aber er ist leicht zu kennen», fuhr sie errötend fort.
«Goldbraun wogt sein Gelock: und sein Auge ist blau wie dieser lichte Stein: und seine Stimme ist hell wie die der Lerche: und wenn er Harfe schlägt, blickt er nach oben, als sähe er den Himmel offen...—»—
«Adalgoth», rief der König!—«Adalgoth!» wiederholten alle Goten.
«Ja, Adalgoth heißt er», sprach sie.
Da flog dieser—sein Name schlug, laut gerufen, an sein Ohr—die Stufen herauf: «Meine Gotho!» jubelte er. Und sie hielten sich umschlungen.
«Die gehören zusammen», sagte Herzog Guntharis, der dem Jüngling gefolgt war.
«Wie Morgenrot und Morgensonne», sprach Teja.
«Nun aber laß mich», sprach das Mädchen, sich losmachend, «meinen Auftrag erfüllen: des sterbenden Großvaters Gebot. Hier, Herr König, nimm diese Rollen und lies sie: Da soll alles Schicksal drin stehen für Adalgoth und Gotho: Vergangenheit und Zukunft sprach der Ahn.»
Und der König entsiegelte die äußeren Schnüre und las:
«Dies hat geschrieben Hildegisel, des Hildemut Sohn, den sie den Langen nennen, ehemals Priester, dermalen Burgmann zu Teriolis. Geschrieben auf Vorsprechen des alten Iffa: und ist alles wahrhaftig aufgeschrieben. Also: nun kommt's.
Das Latein ist wohl oft nicht, wie es in der Kirche gesungen wird. Aber Ihr werdet's schon verstehn, Herr König.
Denn wo's schlecht Latein, da ist's gut Gotisch. Also nun kommt's aber wirklich.
So spricht Iffa, der Alte: ‹Herr König Totila. Was in dieser hier eingewickelten Rolle geschrieben steht, ist die Niederschrift des Mannes Wargs, der aber nicht mein Sohn war und nicht Wargs hieß—sondern Alarich hieß er und war der Balte, der verbannte Herzog von—›»
Ein Ruf des Staunens ging durch die Versammlung der Goten. Der König hielt inne. Herzog Guntharis aber sprach:
«Dann ist Adalgoth, der sich den Sohn des Wargs nannte, der Sohn des Balten Alarich, den er selber als des Königs Herold, umreitend in allen Städten auf weißem Roß, mit lautem Heroldspruch gesucht. Und niemals sah ich größere Ähnlichkeit als die zwischen Vater Alarich und Sohn Adalgoth.»
«Heil dir, Herr Herzog von Apulien!» rief lächelnd Totila und schloß den Knaben in die Arme.
Sprachlos vor Staunen sank Gotho nieder in die Knie, ihre Augen füllten sich mit Tränen, und zu Adalgoth aufblickend seufzte sie: «Also nicht mein Bruder? O Gott!—Heil dir, Herr Herzog von Apulien. Leb' wohl, auf immer!» und sie stand auf und wandte sich, zu gehen.
«Nicht meine Schwester?» jubelte Adalgoth. «Das ist das Beste an dem ganzen Herzogtum Apulien! Halt da»—und er fing sie auf, drückte ihr Köpfchen an die Brust, küßte sie herzhaft auf den Mund und sprach zum König: «Herr König Totila, nun gebt uns zusammen. Hier ist meine Braut—hier steht meine Herzogin.»
Totila aber, welcher einstweilen beide Urkunden durchflogen hatte, lächelte: «Ja, da braucht's nicht Salomons Königsweisheit dazu, hier das Rechte zu finden.—Junger Herzog von Apulien, so verlob' ich dir die Braut.»
Und er legte das weinende, lachende Kind in seine Arme. Zu den Goten umher aber sprach er: «Vergönnt, daß ich euch aus dem etwas ungeschlachten Latein von Hildemuts Sohn—ich kannte ihn: besser war er mit dem Speer als mit der Feder zu brauchen—und dem Testament des Herzogs die Wunder kurz erkläre, die wir hier sehen. Herzog Alarich beteuert hier seine Unschuld.»
«Die ist jetzt erwiesen: durch seinen Sohn», rief Herzog Guntharis, «und ich hatte nie an seine Schuld geglaubt.»
«Er erfuhr erst spät den geheimen Ankläger. Unser Adalgoth hat dessen Namen aus der zertrümmerten Cäsarstatue ans Licht gebracht. Cethegus der Präfekt hatte eine Art Tagebuch geführt, in geheimer Schrift: aber Cassiodorus hat sie, mit Staunen und Entsetzen über die Frevel des so lang von ihm bewunderten Mannes, entziffert. Da fand sich ein Eintrag folgenden Inhalts in dem vor etwa zwölf Jahren geschriebenen Anfang: ‹Baltenherzog verurteilt. Daß er unschuldig, glaubt nur noch er selbst und sein Ankläger. Wer Cethegus ins Herz trifft, soll nicht leben. Als ich damals am Tiberufer aus Tod gleicher Betäubung erwachte, war diese Rache mein erster Gedanke: sie ward mein Schwur: er ist erfüllt.›
Geheimnis schwebt noch auf den Gründen dieser Rachsucht: doch müssen sie irgendwie zusammenhängen mit Julius Manilius Montanus, unserem Freund. Wo ist er?—»
«Er hat sich mit Cassiodorus schon wieder in die Peterskirche zurückbegeben», sprach Graf Teja: «du mögest sie entschuldigen: sie beten um diese Stunde jeden Tag um den Frieden mit Byzanz. Und Julius auch für des Präfekten Seele», fügte er mit bittrem Lächeln bei. «Nur schwer hatte König Theoderich an die Schuld des tapfren Herzogs geglaubt, mit welchem innige Freundschaft ihn verbunden.»
«Hatte er ihm doch», fiel Herzog Guntharis ein, «einst einen breiten, goldnen Armreif geschenkt mit einer Runenschrift.»
Der König fuhr fort, aus der Rolle lesend: «Und diesen Armreif hier habe ich mitgenommen in Verbannung und Flucht mit meinem kleinen Knaben. Dieser Armreif, entzweigebrochen zwischen dem Runenspruch, mag einstmals die echte Geburt meines Sohnes als Wahrzeichen beweisen.»
«Er trägt das Wahrzeichen im Antlitz», meinte Herzog Guntharis.
«Aber es fehlt auch an dem goldnen nicht», sprach Adalgoth: «wenigstens ein Stück hat mir der alte Iffa mitgegeben: hier ist's», und er holte nun den halben Armreif, den er an einer Schnur auf der Brust trug, hervor. «Ich habe nie den Sinn der Runen enträtseln können:
‹Dem Balten...
Dem Falken...
In Not...
Dem Freunde...›»
«Ja, dir fehlte die andre Hälfte, Adalgoth», sprach die Hirtin und holte aus dem Busentuch das zweite Stück. «Sieh, hier lauten die Runen:
‹...der Amaler,
...der Adler,
...und Tod,
...der Freund.›»
«‹Dem Balten der Amaler.
Dem Falken der Adler.
In Not und Tod
Dem Freunde der Freund›»
So las, nun beide Halbringe zusammenhaltend, Teja.
Totila aber fuhr fort: «Endlich aber hatte mich der König nicht mehr schützen können, als ihm Briefe vorgelegt wurden, so meisterhaft gefälscht und meiner Handschrift nachgebildet, daß ich selbst, als mir zuerst ein harmloser Satz aus dem Inhalt, auf einem herausgeschnittenen Pergamentstreifen, vorgelegt wurde, ohne weiteres anerkannte ‹ja, das hab' ich geschrieben›. Da paßten die Richter den Streifen wieder in das Pergament und lasen mir das ganze vor: und so sollte ich denn geschrieben haben an den Hof von Byzanz, ich wolle den König ermorden und Süditalien räumen, wenn man in Byzanz mich als König von Norditalien anerkennen wolle. Da verurteilten mich die Richter.
Als ich aus dem Saal geführt wurde, traf ich auf dem Gange Cethegus Cäsarius, meinen langjährigen Feind—: es war mir gelungen, ein Mädchen, um das er warb, dem unheimlichen Mann zu entziehen und einem wackern Freund in Gallien als Gattin zuzuführen—er drängte sich durch die Wachen, schlug mir die Schulter und sprach: ‹Wem die Liebe entrissen, den tröstet der Haß.› Und an seinem Blick erriet ich es: er und kein andrer war der falsche Ankläger.
Als letzte Gnade gewährte mir der König die Mittel, aus dem Kerker zu entfliehen. Aber ich ward geächtet, friedlos gehetzt mit meinem ganzen Haus; mein Erbe eingezogen. Lang zog ich unstet in den Nordbergen umher, bis ich mich entsann, daß auf dem Berg der Iffinger bei Teriolis altgetreue Gefolgen meines Geschlechts siedelten: dorthin wanderte ich mit meinem Knaben und wenigen Schatzstücken des Baltenhauses.
Und die Getreuen nahmen mich auf und meinen Knaben und bargen mich unter dem Namen Wargs—‹der Verbannte›—und gaben mich für den Sohn des alten Iffa aus und entfernten alle unverlässigen Knechte, die mich hätten verraten können. Und so leb' ich im Verborgnen manches Jahr.
Meinen Sohn aber will ich und sollen nach mir die Iffinger erziehen zur Rache an Cethegus, dem Verräter.
Ich hoffe, einst kommt der Tag, der meine Unschuld aufdeckt. Bleibt er aber allzulang aus, dann soll mein Sohn, wann er schwertreif geworden, hinunterziehen vom Iffaberg gen Italien, den Vater zu rächen an Cethegus Cäsarius. Dies ist mein letztes Wort an meinen Sohn.»
«Bald aber, nachdem der Herzog dies geschrieben hatte», las der König aus der andern Rolle weiter, «verschüttete ihn mit einigen meiner Gesippen der Berg in einem Felsenrutsch. Ich aber, Iffa der Alte, habe den Knaben als meinen Enkel auferzogen und als Gothos Bruder, weil immer noch die Friedlosigkeit lastete auf dem Geschlecht des Herzogs Alarich und ich nicht auch auf ihn die Rache des Höllenmannes lenken wollte. Und auf daß der Junge andern ganz gewiß nichts von seiner gefährlichen Abkunft sagen könne, habe ich ihm selber nichts davon gesagt.
Als er aber nun schwertreif geworden und ich vernahm, daß in Romaburg ein milder und gerechter König walte, der den höllischen Präfekten niederkämpfe wie der Morgengott den Nachtriesen, da sandte ich jung Adalgoth zur Rache aus und erzählte ihm, daß er ein edles Adelshaupt, den Schutzherrn unsres Geschlechts, nach seines Vaters Auftrag an Cethegus, dem grimmen Verfolger und Verderber, zu rächen habe. Aber daß er Alarichs, des Baltenherzogs Sohn, verschwieg ich ihm, denn ich scheute die Acht, die noch auf ihm lag. Seines Vaters Name konnte ihm, solang die Schuld darauf haftete, nichts nützen, nur schaden.
Ganz eilfertig aber schickte ich ihn fort, seit ich erkannte, daß ihn selbst die geglaubte Schwesterschaft nicht abgehalten, meine Enkelin Gotho gar unbrüderlich lieb zu gewinnen. Ich hätte ihm nun zwar wenigstens sagen können, daß Gotho nicht seine Schwester. Das aber soll mir fern sein, daß ich meines alten Herrn-Hauses altadligen Sproß, gleichsam durch Betrug, mit meinem Blut, mit dem schlichten Hirtenkind, verbände. Nein: er wird, wenn Recht auf Erden lebt, dereinst der Herzog von Apulien, wie sein Vater vor ihm.—
Und da ich fürchte, daß ich zu sterben komme und Adalgoth noch keine Kunde von des Präfekten Untergang geschickt hat, habe ich den langen Hildegisel gebeten, dies alles aufzuschreiben.
(Und ich, Hildegisel, habe für die Schreibung zwanzig Pfund besten Käse erhalten und zwölf Krüge Honig, was ich dankbar bekenne, und beide waren sehr gut.)
Und mit alle dem und mit den Schatzstücken, mit den blauen Steinen und feinen Gewändern aus dem Balten-Erbe, und den Goldsolidi sende ich das Kind Gotho an den gerechten König Totila: ihm soll sie alles aufdecken. Er wird die Acht, die Friedlosigkeit nehmen von dem unschuldigen Sohn des unschuldigen Mannes. Und wenn Adalgoth weiß, daß er der edeln Balten Sproß und daß Gotho nicht seine Schwester—dann mag er tun nach seinem Willen: er soll dann frei die Hirtin wählen oder meiden. Nur das wisset, daß der Iffinger Geschlecht nie unfrei war, sondern vollfrei von jeher, wenn auch in des Baltenhauses Schutz. König Totila, du entscheide über sie.»
«Nun», lächelte der König, «diese Mühe hast du mir schon abgenommen, Herr Herzog von Apulien.»—«Und die junge Herzogin», schaltete Valeria ein, «hat sich gleich, als hätte sie's geahnt, bräutlich für diesen Tag geschmückt.»
«Für euer Brautfest», erwiderte die Hirtin. «Als ich vor den Toren der Romaburg erfuhr von dieser Feier, da öffnete ich, wie der Ahn befohlen, das Bündel und schmückte mich für euch.»—
«Unser Verlöbnis», sprach Adalgoth zu seiner Braut, «fiel auf den Verlobungstag des Königspaars—soll auch unser Hochzeitstag der des Königspaares sein?»
«Nein, nein», fiel Valeria hastig, fast ängstlich ein. «Nicht noch ein Gelübde, geknüpft an ein älteres, noch ungelöstes! Ihr Kinder des Glückes: seid weise. Heute habt ihr euch gefunden, haltet das Heute fest, das Morgen gehört den ungewissen Göttern.»
«Recht sprichst du», jubelte Adalgoth, «heute noch soll Hochzeit sein», und er hob Gotho hoch auf seinen linken Arm, sie allem Volke zeigend, «seht hier, ihr guten Goten, meine kleine Frau Herzogin.»
«Mit Vergunst», sprach da eine bescheidene Stimme, «wo so viel Glück und Sonnenschein auf die Gipfel und Höhen des Volkes fällt, da möchte sich auch niederes Gewächs dran laben.» Vor den König trat ein schlichter Mann, an der Hand ein hübsches Mädchen.
«Du bist es, wackrer Wachis», rief Graf Teja, zu ihm tretend, «und nicht mehr Knecht, im langen Haar der Freien?»
«Ja, Herr: König Witichis, mein armer Herr, hat mich freigelassen, als er mich mit Frau Rauthgundis und Wallada entließ. Seither ließ ich das Haar als Freier wachsen. Und Frau Rauthgundis wollte—ich weiß es ganz gewiß—ihre Magd Liuta hier auch freilassen: und wir sollten nach Volksrecht Ehe schließen als Freie: aber sie kam ja nicht mehr zurück in das Haus bei Fäsulä. Wohl aber ich aus unsrer Waldhütte: und gerade zur rechten Zeit noch flüchtete ich meine Liuta aus der Villa. Tags drauf kamen die Sarazenen Belisars und brannten und mordeten die Stätte aus. Nach Frau Rauthgundis erblosem Tode—denn ihrem Vater Athalwin hatte schon vor ihrem Untergang der Südsturm eine Lawine über Haus und Haupt geworfen—ist nun Liuta dem König als Eigentum zugefallen: und ich möchte daher den König bitten, daß er auch mich wieder zum unfreien Knecht aufnehme, auf daß wir nicht gestraft werden, wenn wir uns freien—und—»
Totila ließ ihn nicht aussprechen: «Wachis, du bist treu», rief er gerührt. «Nein, nach Volksrecht sollt ihr die Freien-Ehe schließen. Reicht mir ein Goldstück.»
«Hier, Herr König», rief eifrig Gotho, aus ihrer Hirtentasche eins hervorholend—«es ist mein letztes, von den sechsen.»
Der König nahm es lächelnd, legte es auf Liutas rechte, offne Handfläche und schlug es dann, von unten nach oben, aus ihrer Hand, daß es klingend auf das Mosaikgetäfel sprang und sprach:
«Frei und frank
Laß ich dich, Liuta,
Ledig und lastlos!
Freie du fröhlich
In Königsfrieden.»
Da trat Graf Teja vor und sprach: «Wachis, du trugst schon einmal glücklosem Herrn den Schild. Willst du nun mein Schildträger werden?» Feuchten Auges ergriff der Treue des Grafen Rechte mit beiden Händen. Und nun erhob Teja den Goldpokal und sprach feierlich:
«Ihr glänzet im Glück:—
Schön scheint euch der Schimmer
Der seligen Sonne:
Doch denket drum doch
Treu traurig der Toten!
Ohne Glanz, ohne Glück,
Doch treu, tapfer und trefflich
Rang ruhmvoll der Recke:
Witichis, Waltharis wehrlicher Sohn
Feiert ihr fest-froh,
Lichte Lieblinge
Gütiger Götter,
Goldne Gelage,—
Ehre doch immer
Der Goten Geschlecht
Der glücklosen Gatten
Geweihtes Gedächtnis.
Ich mahne euch, Minne
Traurig zu trinken
Des mutigen Mannes,
Des wackersten Weibes:
Witichis' und Rauthgundens Minne trink ich.»
Und alle taten, schweigend, freiervoll und trauervoll, Bescheid.
Dann hob König Totila nochmal den Becher und sprach laut vor allem Volk: «Er hatte es verdient—ich habe es erreicht: ihm bleibt unvergessene Ehre!»
Als er sich niedergelassen—die beiden andern Paare wurden mit an des Königs Tisch gesetzt—, stieg Graf Thorismut von Thurii (seine treue Tapferkeit war durch die Grafenwürde belohnt, aber das Amt des Herolds und Waffenträgers ihm auf seinen Wunsch belassen worden) die Stufen herauf, neigte vor dem König seinen Heroldstab und sprach: «Fremde, fernher gesegelte Gäste meld' ich, König der Goten. Jene große Flotte, die, leicht hundert Segel stark, schon seit mehreren Tagen von deinen Seewarten und Hafentürmen gemeldet wurde, ist nun in Portus eingelaufen. Nordleute sind es: wogenkundig, kühnes Volk, aus fernstem Thule-Land. Hochbordig ragen ihre Drachenschiffe, und Schreck verbreiten deren ungetüme Bugsprietbilder. Aber zu dir kommen sie friedlich. Und das Königsschiff hatte gestern schon Boote ausgesetzt, und hohe Gäste segeln den Fluß herauf. Ich rief sie an und erhielt zur Antwort: ‹König Harald von Götaland und Haralda (seine Gattin, wie es scheint), die wollen König Totila begrüßen.›»
«Führ sie herauf. Herzog Guntharis, Herzog Adalgoth, Graf Teja, Graf Wisand, Graf Grippa, geht ihnen entgegen und geleitet sie.»
Und alsbald erschienen, unter den kriegerischen Tönen ihrer fremdartigen, gewundenen Muschelhörner, umgeben von zwanzig ihrer ganz in Stahlringen gepanzerten Helden und Segelbrüder, auf der Terrasse zwei hohe Gestalten, die selbst den schlanken Totila und seine Tafelgenossen überragten.
König Harald trug auf dem Helm die beiden fußlangen Schwingen des schwarzen Seeadlers: das Federkleid desselben Vogels bedeckte das eherne Helmdach. Vom Rücken floß ihm eines ungeheuren schwarzen Bären Fell, dessen Rachen und Vorderpranken vorn über den Brustharnisch von handbreiten Erzringen herabhingen. Ein eisendraht-geflochtener Wappenrock, der bis an die Knie reichte, wurde durch einen breiten, muschelbesetzten Gurt von Seehundfell um die Hüften gehalten, Arme und Beine waren nackt, doch von breiten Goldringen geschmückt zugleich und geschirmt. Ein kurzes Messer hing an stählerner Kette an seiner Seite: in der Rechten aber trug er einen langen, harpunengleichen Widerhakenspeer. Seine dicken, hellgelben Locken fluteten, mähnengleich, tief über seine Schultern.
Zu seiner Linken stand, nicht um eine Fingersbreite kleiner, die Walkürengestalt seiner Begleiterin. Das hellrote, metallisch schimmernde Haar floß, in langem, schlichtem Schweife, bis fast an ihre Knöchel, hervor unter dem goldnen, offnen Helme mit den kleinen Flügeln der Silbermöwe, über einen schmalen Streif von dem weißen Pelze des Eisbären, der, mehr als Schmuck denn als Mantel, ihren Rücken bedeckte. Ein ganz eng anschließender Panzer von kleingeschupptem Golde zeigte den unvergleichlichen Wuchs der Schildjungfrau, jeder Bewegung der atmenden Brust elastisch folgend. Ihr bis an die halbe Wade reichendes Untergewand war aus den weißen Haaren des Schneehasen kunstvoll gefertigt. Die Arme schmückten, halb sie verhallend, Ärmel aus aneinandergereihtem und durchbohrtem, goldgelbem Bernstein, der in der Abendglut der römischen Sonne funkelte. Auf ihrer linken Schulter aber saß gravitätisch der zierliche weiße Falke von Island. Ein kurzes Handbeil stak in ihrem Gurt: die Rechte trug die über die Schulter gelehnte, langgeschweifte Harfe mit dem Schwanenbug von Silber.
Gaffend folgten, nachdrängend, die Römer, die Augen weit aufreißend über solche Gestalten: aber auch die Goten bewunderten das so viel hellere Weiß dieser Arme, die eigenartig hellen, blitzenden Augen.
«Nachdem der schwarze Held, der mich empfing», sprach der Wiking, «sagt: er sei's nicht, kannst nur du der König sein», und er reichte Totila die Hand, erst den Kampfhandschuh aus Haifischhaut abstreifend.
«Willkommen am Tiberstrom, ihr Vettern aus Thuleland», rief Totila, zutrinkend.
Und auf rasch bereiteten Stühlen nahm das Fürstenpaar am Königstische Platz, ihre Gefolgen an den nächsten Tafeln: Adalgoth schenkte Wein aus hohen Henkelkrügen.
König Harald trank und schaute bewundernd umher.
«Bei Asathor», rief er dann, «hier ist es schön!»—«So denk' ich mir Walhalla!» sprach seine Begleiterin.
Kaum verstanden sich die Goten und die Nordleute untereinander.
«Gefällt es dir bei mir, Bruder», sprach Totila langsam, «dann weile lang unter uns mit deiner Gattin.»
«Hoho, Romkönig», lachte die Riesin und warf das Haupt zurück in den Nacken, daß die rote Haarwelle flutete—kreischend umflog sie dreimal der Falke: dann kehrte er ruhig auf ihre Schulter zurück:—«Noch ist kein Mann gekommen, der Haraldas Herz und Hand bezwungen: nur Harald, mein Bruder, biegt mir den Arm, überspringt meinen Sprung, überwirft meinen Speer.»
«Geduld, klein Schwesterlein, ich vertraue: bald meistert ein markiger Mann dir das trotzige Magdtum. Hier dieser König, blickt er auch mild wie Baldur, gleicht doch Sigurd, dem Fafnirschläger. Ihr solltet euch messen im Speerwurf.»
Haralda warf einen langen Blick auf den Gotenkönig, errötete und drückte einen Kuß auf ihres Falken glattes Köpfchen.
Totila aber sprach:
«Übles gedieh, nach der Sänger Bericht, aus Sigurds Wettkampf mit der Schildjungfrau. Begrüße vielmehr friedlich Weib das Weib: reiche die Hand, Haralda, meiner Braut.»
Und er winkte Valeria, der nur unvollständig Herzog Guntharis das Gesprochene in Latein vermittelte.
Valeria erhob sich in edler, anmutvollen Hoheit von ihrem Sitz, im weißen, langwallenden, römisch-griechischen Gewand mit goldnem Gürtel und einer Kamee als Schulterspange, nur einen Lorbeerzweig um die edlen Schläfen, den Totila aus Adalgoths Kranz genommen und durch ihr schwarzes Haar geschlungen: wie Musik umfloß sie die Schönheit, der Rhythmus ihres Faltenwurfs und ihrer Bewegungen: so reichte sie schweigend der nordischen Schwester die Hand.
Einen scharfen, nicht eben freundlichen Blick hatte diese auf die Römerin geschleudert: aber Bewunderung verdrängte zornige Überraschung von ihrem Antlitz, und sie sprach: «Bei Freias Halsgeschmeide, du bist das schönste Weib, das ich je gesehen. Ich zweifle, ob dir ein Wunschmädchen in Walhall gleichen mag. Weißt du, Harald, wem diese Fürstin gleicht? Vor zehn Nächten haben wir im blauen Griechenmeer auf einer Insel geheert und einen Säulentempel ausgeleert—. Da stand ein hohes Marmorweib aus weißem Stein, auf der Brust ein schlangenumlocktes Haupt, zu Füßen den Nachtvogel, in faltenreichem Gewand——Sven hat sie leider zerschlagen, wegen der Edelsteine, die sie in den Augen trug—: dieser Marmor-Göttin gleicht die Königsbraut.»
«Das muß ich dir dolmetschen», lächelte Totila der Geliebten zu: «nicht dein poetischer Verehrer Piso hätte dir ausgesuchter schmeicheln können als diese Bellona des Nordens.—Sie haben—so ward uns gemeldet—auf Melos gelandet und dort die schöne Athena-Statue des Pheidias zerschlagen. Der bist du ähnlich, sagt sie! Ihr habt übel gehaust», fuhr Totila fort, «ich hörte es, auf allen Inseln zwischen Kos, Chios und Melos. Was führte euch dann so friedlich zu uns?»
«Das will ich dir sagen, Bruder. Aber erst nach einem neuen Trunk.» Und er hielt Adalgoth den tiefen Becher hin. «Nein!—nicht mit Wasser verderben den herrlichen Saft! Wasser muß salzig sein—damit man's gar nicht trinken kann—außer man ist ein Hai oder Walroß. Wasser ist gut, daß es uns trage auf seinem Rücken, nicht, daß wir es tragen in unsrem Bauche. Und es ist ein wunderbarer Trank, dieses euer Reben-Bier. Unsern Met habe ich mir immer bald satt getrunken:—der ist wie fade, süße Speise. Aber dieser Reben-Met:—je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Und trank man zuviel—was kaum denkbar—, ist's nicht wie beim Ael- oder Metrausch, daß man Asathor bitten möchte, einem um den Schädel mit seinem Hammer einen Eisenring zu schmieden—nein, der Rebenrausch ist wie süßer Wahnsinn der Skalden: den seligen Göttern dünkt man sich gleich. Nun also so viel vom Weinrausch.
Wie wir aber hierher gekommen sind, das will ich dir erzählen.»
«Also: wir sind daheim in Thuleland, wie es die Skalden nennen, in Götaland, wie wir es heißen. Denn Thuleland ist das Land, wo man nicht wohnt, wo nur, noch weiter nach den Eisbergen hin, andre Männer wohnen.
Unser Reich reicht gegen Aufgang an die See und unsre Insel Gotland. Gegen Niedergang an Hallin und das Skioldunga-Haff. Gegen Mitternacht an Svealand. Gegen Mittag an Smaland, Skone und der See-Dänen Reiche.
König aber ist mein Vater, Frode, den Odin liebt.
Er ist viel weiser denn ich.
Er hat mich aber jetzt zum Mit-König krönen lassen auf dem heiligen Stein zu Kind-Sala, weil er schon bald hundert Jahre alt ist und blind.
In unsern Hallen aber singen die Sänger noch immer die Wandersage, daß ihr Goten mit den Amalerfürsten und den Balten ursprünglich unsre Brüder wart, und nur durch Verirrung auf der Wanderung seiet ihr allmählich immer weiter nach Süden abgekommen: denn ihr folgtet der Kraniche Flug vom Kaukasus ab, wir aber dem Rennen der Wölfe.»
«Wenn dem so ist» lächelte Totila, «zieh' ich die Kraniche als Wegweiser vor.»
«So mag dir das jetzt wohl noch scheinen hier in dieser stolzen Methalle», sprach König Harald ernst.
«Aber mein weiser Vater Frode meint anders. Wie dem nun sei—(ich glaub's nicht recht, denn sonst müßten wir unsre Worte leichter verstehen)—. Wir ehren hoch und treu die alte Blutsgemeinschaft, sind wir nicht Brüder, sind wir doch sicher Vettern.
Und lange Zeit kam von eurem warmen Gotaland in unser kaltes immer nur frohe, stolze Kunde höchsten Ruhms: und mein Vater und euer König Thidrekr, den unsrer Skalden Harfenlieder preisen, tauschten einmal Gesandte und Geschenke, vermittelt durch die Bernstein-Esthen, die an dem Austrweg wohnen. Diese führten unsre Boten zu den Wenden an der Wyzla: diese zu den Langobarden an der Tisia: diese zu den Herulern am Dravus: diese durch Savien nach Salona und Ravenna.»
«Du bist ein weg- und länderkundiger Mann», meinte Totila.
«Das muß der Wiking sein. Sonst kommt er erst nicht vorwärts. Und dann oft nicht mehr zurück.—Lange also hörten wie nur vom Glück und Glanz bei euch.
Aber einmal und dann öfter kam durch Kaufleute, die von uns Pelz, Eiderdunen und Bernstein kaufen und den Friesen, Sachsen und Franken zuführen und uns künstlich Gerät und Gold und Silber zubringen—und immer trauriger kam zu uns die Kunde, daß König Thidrekr gestorben und nach seinem Tod groß Unheil ausgebrochen sei in eurem Reich. Unsieg, Verrat, Königsmord, Krieg von Goten wider Goten und der falschen Fürsten Grekaland Übergewalt.
Und es hieß: zu vielen Tausenden hättet ihr euch die Schädel eingerannt an den hohen Mauern eurer eignen Romaburg, die aber nicht ihr hättet, sondern ein Mann wie Asathor und ein zweiter, noch schlimmerer, wie Loki der Feuer-Arge.
Und wir forschten, ob euch denn gar niemand Hilfe leiste von den vielen Königen und Fürsten, die um Thidrekrs von Raven Gunst gebettelt. Aber da lachte der fränkische Kaufmann, der in meines Vaters Halle feines Gewebe feilbot von der Wahala, und sprach: ‹Bricht Glück, bricht Treue. Alle haben sie von den glücklosen Gotenhelden gelassen, Westgoten und Burgunden, Heruler und Thüringe und zumeist wir Franken. Denn wir sind klug vor andern.›
Da warf aber mein Vater, König Frode, seinen Stab zürnend zur Erde und rief: ‹Wo ist Harald, mein starker Sohn?›
‹Hier›, sprach ich, ‹Vater›, und ergriff seine Hand.
‹Hast du gehört›, fuhr mein Vater fort, ‹die Kunde von der Südlandskönige Untreue? Solches soll man nicht singen und sagen von den Männern von Götaland. Wenn alle untreu geworden gegen die Goten von Gardarike und Raven:—wir wollen Treue halten und ihnen helfen in ihrer Not.
Auf, mein starker Harald und du, meine kühne Haralda, rüstet hundert Drachenschiffe aus und füllt sie mit Männern und Waffen—greift tief in meinen Königshort zu Kingsala und schonet nicht die gehäuften Goldringe—und fahret aus mit Odins Hauch in den Segeln.—
Von Konghalla erst an den Inseldänen und den Jüten vorüber gen Niedergang, dann entlang den Küsten der Friesen und Franken durch den Schmalpfad der See. Weiter segelt um das Reich der Sueven in dem Bergland, das da Asturia heißt: und um der Westgoten Land biegt nach Süden: dann windet euch wieder durch den Schmalpfad der Weit-See, wo Asathor und Odin zwei Säulen gesetzt haben: dann seid ihr schon im Meer von Midilgardh, wo zahllose Eilande liegen in immergrünen Büschen, daraus weiße Marmorhallen schimmern, getragen von hohen, runden Steinbalken.
Auf diesen Eilanden heeret: denn sie gehören den falschen Fürsten von Grekaland.
Und dann fahret gen Romaburg oder gen Raven und helfet dem Volke Thidrekrs wider seine Feinde und kämpfet für sie zu Wasser und zu Lande und stehet treu zu ihnen, bis niedergekämpft sind alle ihre Feinde.
Dann aber sprecht zu ihnen: So rät euch König Frode, der bald hundert Winter gesehn hat und vieler Fürsten und Völker Geschicke hat aufsteigen sehn und wieder sinken, und der selber in jungen Jahren jenes Südland gesehn hat als Wiking.
So rät euch König Frode: Räumet das Südland, so herrlich es ist.
Ihr werdet nicht darin dauern.
So wenig die Eisscholle dauert, die im Südmeer treibt. Es zehren schmelzend an ihr unablässig Sonne, Luft und leise nagende Wellen. Und mag sie noch so mächtig sein—sie muß zerrinnen, und keine Spur wird bleiben ihres Daseins.
Es ist aber besser, im armen Nordland leben als im reichen Südland sterben.
Besteigt unsre Drachenschiffe und rüstet eigne und ladet darauf all euer Volk, Männer, Frauen, Kinder, Knechte und Mägde, und Rinder und Rosse und Waffen und Edelgerät, und räumet den heißen Boden, der euch sicher verschlingen wird: und fahret von dannen und kommt zu uns. Wir wollen zusammenrücken oder den Finnen, den Wenden und Esthen so viel Land nehmen als ihr braucht.
Und ihr sollt erhalten bleiben, frisch und grünend.
Dort unten verwelkt und versengt euch die Südsonne. So rät euch König Frode, den die Menschen den Weisen nennen seit fünfzig Jahren.›
Und wir hörten nun freilich schon, wie wir einfuhren in das Meer von Midilgardh, von den Seefahrern, daß eure Not gewendet sei durch einen neuen König, den sie schilderten wie den Gott Baldur, daß ihr Romaburg und alles Land von Gardarike wiedergewonnen und siegreich in Grekaland selbst geheert habt.
Und wir sehen ja jetzt mit Augen, daß ihr unsre Waffenhilfe nicht braucht. Ihr lebt herrlich und in Freuden in dieser Methalle: und alles ist voll roten Goldes und weißen Gesteins. Aber doch muß ich wiederholen meines Vaters Wort und Rat: folgt ihm! Er ist weise! Noch jeder hat's bereut, der König Frodes Rat verschmäht.»
Allein Totila schüttelte lächelnd das Haupt und sprach:
«Großen Dank sagen wir König Frode und euch für edle, seltne Treue. Unvergessen soll in der Goten Gesänge solche Brudertreue sein der Nordland-Helden. Aber, o König Harald, folge mir und blick' um dich her.»—
Und er stand auf, nahm den Gast an der Hand und führte ihn an den Eingang des Zeltes, die Vorhänge zurückschlagend: da lagen Strom und Land und Stadt in glühendem Licht des Sonnenuntergangs: «Sieh dies Land, unvergleichlich an Herrlichkeit des Himmels und des Bodens und der Kunst:—siehe diesen Tiberstrom von glücklichen, jubelnden, schönen Menschen bedeckt, schau' diese Büsche von Lorbeer und Myrten: blicke hin auf die Säulenpaläste, die dort von Rom her im Abendstrahl schimmern, auf die hohen Marmorbilder auf diesen Stufen—: und sage du selbst, würdest du dies Land räumen, wenn es dein wäre? Würdest du diese Herrlichkeit vertauschen mit Nordes Fichten und Föhren und frühlingslosem Eise, mit den rauchgeschwärzten Holzhütten auf nebliger Heide?»
«Ja, das würd' ich, beim Hammer Thors! Dies Land hier ist gut, drin zu heeren, drin zu schwelgen, drin zu siegen: jedoch dann schleunig auf und davon gefahren mit der Siegesbeute nach Hause!
Ihr aber seid hier hereingeworfen wie Wassertropfen auf heißes Eisen. Und wenn jemals wir Odins-Söhne dieses Südland beherrschen, dann werden das doch nur solche von uns, die einen breiten Rückhalt haben an andern Odins-Söhnen.
Ihr aber—: ihr seid ja selbst schon ganz anders geworden als wir. Welsche Frauen haben eure Großväter, eure Väter, ihr selbst gefreit: in wenigen Geschlechtern, wenn das so fortgeht, seid ihr verwelscht: schon seid ihr kleiner, dunkler an Haut und Augen und Haar geworden als wir, wenigstens viele von euch.
Ich sehne mich aus dieser schwülen, weichen Luft nach dem Nordwind, der über unsre Wälder und Wogen braust.
Ja, und auch nach der rauchgeschwärzten Holzhalle, wo die Götterrunen eingebrannt sind in die Firstbalken und die Harfen der Skalden an den Holzpfeilern hangen und das heilige Herdfeuer immer gastlich lodert. Ich sehne mich nach unsrem Nord zurück:—denn er ist unsre Heimat.»
«So vergönne, daß auch wir unsre Heimat lieben, dies Land Italia!»
«Nie wird's eure Heimat, nur vielleicht euer Grab. Fremd seid ihr, und fremd bleibt ihr. Oder ihr verwelscht. Aber eures Bleibens, als Odins-Söhnen, ist nicht in diesem Land.»
«Mein Bruder Harald, laß es uns doch versuchen», lächelte Totila. «Ja, wir sind verändert seit den zwei Menschenaltern, die unser Volk nun unter Lorbeern lebt. Aber sind wir verschlechtert? Muß man notwendig ein Bärenfell tragen, um ein Held zu sein? Muß man Goldbilder rauben, Marmorbilder zerschlagen, um sich an ihnen zu erfreuen? Kann man nur Barbar sein oder Welscher? Können wir nicht der Germanen Vorzüge behalten, ihre Fehler ablegen, der Welschen Vorzüge uns aneignen, ohne ihre Fehler?»
Aber Harald schüttelte das mähnenumwallte Haupt.
«Mich soll's freuen, wenn's euch gelingt. Aber ich glaub's nicht. Die Pflanze nimmt die Art des Bodens und des Himmels an, darauf und darunter sie wächst. Und ich möcht' es gar nicht, selbst wenn's mir und den Meinen gelänge. Mir sind unsre Fehler lieber als der Welschen Vorzüge: wenn sie welche haben.»
Totila mußte der Worte gedenken, die er einst selber Julius entgegnet.——
«Vom Nordland geht alle Kraft aus—dem Nordvolk gehört die Welt.»
«Sag's ihnen doch», fiel seine Schwester ein, «in deines Lieblingsliedes Worten.» Und sie reichte ihm die Harfe hin: Harald aber spielte und sang eine Stabreim-Weise, die Adalgoth, in Schlußreime übertragen, Valeria folgendermaßen verdolmetschte:
«Thor stand am Mitternachts-Ende der Welt:
Die Streitaxt warf er, die schwere:
‹So weit der sausende Hammer fällt,
Sind mein das Land und die Meere!›
Und es flog der Hammer aus seiner Hand,
Flog über die ganze Erde,
Fiel nieder an fernsten Südens Rand,
Daß alles sein eigen werde.
Seitdem ist's freudig Germanenrecht,
Mit dem Hammer Land zu erwerben:
Wir sind von des Hammer-Gottes Geschlecht
Und wollen sein Weltreich erben!»
Lauter Beifall der gotischen Hörer dankte dem königlichen Sänger, der ganz danach aussah, das stolze Lied verwirklichen zu wollen und zu können.
Harald leerte nochmals den tiefen Goldbecher. Dann rief er: «Nun wohlauf, klein Schwesterlein Haralda, auf, ihr meine Segelbrüder da drüben. Nun brechen wir auf.
Auf Deck der Midgardschlange müssen wir sein, bevor der Mond drauf scheint. Wie lautet der Wikingabalk?
‹Schlecht schlummert das Schiff,
Liegt der Lenker an Land.›
Lange Freundschaft—kurzer Abschied, so ist's Nordland-Brauch.»
Totila legte die Hand auf seines Gastes Arm. «Eilt's dir so sehr?
Du fürchtest wohl, mit zu verwelschen? Bleibe nur noch: so rasch geht's nicht: und bei dir hat's damit gute Wege.»
«Ja, da hast du recht, Romkönig», lachte der Riese, «und beim Hammer Thors: ich rühme mich dessen. Aber wir müssen fort.
Drei Dinge hatten wir hier zu tun nach König Frodes Gebot: Euch zu helfen im Kampf. Ihr braucht uns nicht. Oder braucht ihr uns noch? Sollen wir bleiben, bis neuer Kampf entbrannt?»
«Nein», lächelte Totila, «Friede, nicht neuer Kampf steht bevor. Und käm' es wirklich abermals zum Krieg—soll ich dir dann recht geben, Bruder Harald, daß wir Goten zu schwach, uns allein in Italia zu halten? Haben wir nicht die Feinde geschlagen ohne eure Hilfe? Können wir sie nicht wieder schlagen, wir Goten allein?»
«Ich dachte mir's wohl», entgegnete der Wiking.—«Zum zweiten kamen wir, euch zurückzuholen ins Nordland: Ihr wollt es nicht. Und zum dritten: zu heeren auf des Kaisers von Grekaland Inseln. Das ist ein lustig Geschäft und noch lange nicht genug geübt. Kommt mit: helft dabei, rächt euch.»—«Nein, ein Königswort ist heilig. Wir haben Waffenstillstand noch auf Monde. Und höre, Freund Harald. Verwechsle mir ja nicht aus Versehen unsre Inseln mit denen des Kaisers. Unlieb wäre mir, wenn—»
«Nein, nein», lächelte Harald, «sorge nicht. Wir haben's schon gemerkt. Vortrefflich gehütet sind eure Häfen und Küsten. Und hier und da hast du ja hohe Galgen aufrichten lassen und Tafeln daran in römischen Runenzeichen—dein Seegraf zu Panormus hat sie uns gedolmetscht:
‹Landräuber gehängt,
Seeräuber ertränkt;
Das ist das Raubrecht
In Totilas Reich.›
Da haben meine Segelbrüder einen heftigen Abscheu bekommen vor deinen Stangen und Tafeln und Runen. Leb' wohl nun, Romkönig der Goten: möge dein Glück dauern: leb' wohl, schöne Schwarzkönigin. Lebt wohl, all ihr Helden: wenn nicht früher—in Walhall treffen wir uns wieder.»
Und rasch sich verabschiedend schritten die Nordleute hinweg.
Haralda warf ihren Falken in die Luft. «Flieg voraus, Snotr, auf Deck!» und pfeilschnell schoß der kluge Vogel hinweg, gerade über den Fluß hinabfliegend.
Der König und Valeria geleiteten die Gäste bis auf die vorletzte Stufe der Treppe: dort tauschten sie den letzten Händedruck.
Noch einen raschen Blick warf die Jungfrau auf Totila. Harald bemerkte es, und er flüsterte ihr zu, als sie allein die letzte Stufe herabstiegen: «Klein Schwesterlein, deinetwegen scheid' ich so rasch. Gräme dich nicht um diesen schönen König.
Du weißt, ich habe vom Vater die Gabe geerbt, todverfallne Männer zu erkennen. Ich sage dir: auf dieses Königs sonnigen Brauen sitzt der Speertod.
Er wird den Mond nicht mehr wechseln sehn.»
Da zerdrückte die Kriegerin eine Träne in den stolzen Augen.
Graf Teja, Herzog Guntharis und Herzog Adalgoth geleiteten die Gäste bis an ihre Boote im Tiber und verweilten, bis sie abgestoßen.
Mit ernstem Blick sah ihnen Teja nach. «Ja, König Frode ist weise», sagte er. «Aber oft ist die Torheit süßer als die Wahrheit. Und großartiger.—Geh nur voran zum Zelt zurück, Herzog Guntharis. Ich sehe da den Fluß herauf das Botenschiff des Königs eilen. Ich will sehen, welche Nachricht es bringt.»
«Ich bleibe bei dir, mein Meister», sprach Adalgoth besorgt, «du siehst so furchtbar ernst. Was hast du?»
«Eine Ahnung, mein Adalgoth», sprach Teja, den Arm um des Jünglings Nacken schlingend. «Sieh, wie rasch die Sonne sinkt. Mich schauert.—Laß uns dem Botenschiff entgegengehen—da unten wird es landen, wo die alten, gestürzten Marmorsäulen liegen.»
Totila und Valeria waren nach dem Zelte zurückgewandelt.
«Hat dich bewegt», fragte die Römerin erschüttert, «mein Geliebter, was jener Fremdling sprach? Es war—Guntharis und Teja haben mir's erklärt—, es war sehr ernst.»
Aber Totila erhob rasch das nachdenklich gesenkte Haupt. «Nein, Valeria, es hat mich nicht erschüttert. Des großen Theoderichs großes Werk hab' ich auf meine Schultern genommen. Der Traum meiner Jugend, der Gedanke meines Königtums:—ich will für ihn leben und sterben. Komm:—wo bleibt Adalgoth, mein Mundschenk?—Komm, noch einmal tu Bescheid mit dem Becher, Valeria—laß mich trinken auf das Glück des Gotenreichs.» Und hoch erhob er den Pokal.
Aber er vermochte nicht, ihn zu Munde zu führen, denn Adalgoth eilte, laut rufend, die Stufen hinan, gefolgt von Teja.
«König Totila», rief jetzt Adalgoth atemlos, «bereite dich, ein Furchtbares zu hören, fasse dich...»
Totila setzte den Pokal nieder und fragte erbleichend:
«Was ist geschehn?»
«Dein Botenschiff brachte die Kunde von Ancona her: Der Kaiser hat den Waffenstillstand gebrochen—er hat...»
Da war Teja heran: sein langes, schwarzes Haar flatterte im Winde. Geisterblaß war sein Antlitz, und sein Auge sprühte: «Auf, König Totila», rief er, «den Kranz aus dem Haar, und den Helm auf das Haupt! Auf der Höhe von Senogallia, nahe bei Ancona, hat eine Flotte des Kaisers die unsere, die im Schutz des Waffenstillstandes lag, plötzlich feindlich überfallen.
Unsere Flotte ist nicht mehr.
Von unsern vierhundertsiebzig Segeln sind nur elf gerettet.
Ein starkes Heer des Kaisers ist gelandet.
Und Feldherr ist—: Cethegus, der Präfekt.»
In dem Lager Cethegus' des Präfekten bei Setinum, am Fuß des Apenninus, wenige Meilen nördlich von Taginä, schritt Lucius Licinius, der soeben von Epidamnus her zur See eingetroffen war, in eifrigem Gespräch mit Syphax vor dem Zelt des Feldherrn auf und nieder.
«Mit Schmerzen erwartet dich mein Herr, o Kriegstribun. Schon seit mehreren Tagen. Hoch erfreut wird er sein, dich zu finden im Lager», sprach der Numider. «Er muß bald zurückkehren von einem Ritt der Kundschaftung.»
«Wohin ritt er?»
«Mit Piso und den andern Kriegstribunen gegen Taginä.»
«Ja, das ist die nächste, feste Stadt der Goten nach Süden zu. Nun aber erzähle mir, kluger Maure, von den letzten Dingen, die zu Byzanz geschahen. Du weißt: mich hatte dein Herr zu den Langobarden auf Werbung geschickt, lange bevor in Byzanz eine Entscheidung erreicht war. Als ich nun, nach gefahrvoller Reise durch das Land der Langobarden und der Gepiden, bei Novä über den reißenden Ister wieder glücklich in das Reich Justinians gelangt war und bei dem Gastfreund in Nikopolis die verabredete Weisung des Präfekten abholte, die meine weiteren Schritte lenken sollte, fand ich nur den lakonischen Befehl: ihn in Senogallia zu treffen.
Ich staunte. Denn daß er, an der Spitze von Flotte und Heer des Kaisers, als Sieger, den Boden Italiens wieder beschreiten würde, wagte ich kaum zu hoffen. Von Senogallia her eilte ich eurem Marsche bis hierher nach. Die Heerführer, die ich bisher im Lager getroffen, haben mir nun zwar den Lauf der Dinge ungefähr erzählt bis kurz vor Belisars Verhaftung. Aber von dem Hergang bei dieser und von den späteren Dingen haben sie offenbar keine genauere Kunde. Du aber...—»
«Ja, ich weiß diese Sachen: so gut fast wie mein Herr. Denn ich war selbst dabei.»
«Ist's möglich? Belisar wirklich ein Verschwörer gegen Justinian? Nie hätt' ich's geglaubt.»
Syphax lächelte schlau: «Darüber hat Syphax kein Recht, zu urteilen: ich kann nur genau sagen, was geschah.
Nun höre, aber tritt ins Zelt und labe dich, mein Herr würde schelten, ließ ich dich hier draußen, unverpflegt, und es spricht sich auch sichrer drinnen», fuhr er fort, den Zeltvorhang hinter dem Eintretenden schließend.
Während er nun den Gast seines Herrn auf den Feldstuhl nötigte und mit Früchten und Wein versah und bediente, hub er an zu erzählen: «Bei Einbruch der Nacht jenes Schicksalstages kauerte ich in einer Nische des Muschelhauses des Photius, des Freigelassenen Belisars, hinter der hohen Statue eines Christenheiligen, dessen Namen ich nicht weiß, der aber einen sehr löblich breiten Rücken hat. Zugedeckt von seinen Schultern konnte ich durch eine Lücke oben in der Mauer spähen, die dem Saale frische Luft zuführen soll.
Bei schwacher Beleuchtung erkannte ich Photius und eine Anzahl vornehmer Männer, die ich oft in dem Kaiserpalast oder in Belisars Haus oder bei Prokopius hatte aus- und eingehen sehen. Das erste, was ich verstand—denn mein Herr hat mich die Sprache der Griechen, die sich ‹Romäer› nennen, lernen lassen—war das Wort des Hausherrn an einen Eintretenden: Freue dich: Belisarius kommt. Nachdem er mich gestern früh kaum eines Blickes gewürdigt, als ich ihn erwartungsvoll in der Ringschule des Zenon anhielt, sprach er mich heute abend selber an, da ich an der offnen Türe seines Hauses lauernd langsam vorüberschritt. Denn ich wußte, daß er gegen Abend wiederkommen werde von der Jagd mit den persischen Leoparden. Vorsichtig drückte er mir dies Wachstäfelchen in die Hand, umspähend, ob ihn niemand sehe. Hier aber steht: ‹Nicht länger widersteh' ich eurer Werbung. Neue Gründe zwingen mich. Ich komme heute.›
‹Aber wo ist Piso, wo Salvius Julianus, wo die andern jungen Römer?› fragte Photius.
‹Sie kommen wohl nicht›, sprach der Eintretende. ‹Ich sah sie fast alle auf Booten im Bosporus. Sie sind wohl zu einem Schmause nach des Präfekten Villa vor dem Tor des Constantin gesegelt.›
‹Laß sie, wir brauchen sie nicht, die brutalen Latiner, nicht den stolzen und falschen Präfekten: Belisar wiegt wahrlich mehr als sie.›
Da trat Belisarius ein. Er trug einen weiten, seine Gestalt verhüllenden Mantel.
Der Hausherr eilte ihm entgegen, alle drängten sich ehrfurchtsvoll um ihn. ‹Großer Belisarius›, sprach der Freigelassene, ‹wir wissen diese deine Tat zu würdigen. Du bist erschienen:—so bist du unser Haupt.›
Und er drängte ihm den kleinen Elfenbeinstab auf, den der Leiter der Versammlungen führt, und geleitete ihn an den erhöhten Sitz des Vorstehers der Gesellschaft, den er selbst eben verlassen. ‹Sprich—befiehl—handle—wir sind bereit.›
‹Ich werde handeln zur rechten Zeit›, sprach finster Belisarius und ließ sich auf dem Ehrensitz nieder.
Da eilte verwirrten Haares und fliegenden Gewandes der junge Anicius in das Gemach, ein Schwert in der Hand. ‹Flieht›, rief er, ‹wir sind entdeckt und verraten.›
Belisar erhob sich gespannt.
‹Man ist in mein Haus gedrungen. Meine Sklaven sind gefangen. Eure Waffen, die ich geborgen, sind gefunden und—aus sicherstem, nur mir bekanntem Versteck—eure Briefe und Urkunden und ach! auch meine Briefe verschwunden. Aber noch mehr. Als ich in den Hain des Constantinus bog, der dieses Haus umgibt, glaubte ich, in den Gebüschen Waffen und Männer klirren und flüstern zu hören. Man ist mir gefolgt; rettet euch.›
Die Verschwornen stoben nach den Türen.
Nur Belisarius blieb ruhig stehen vor dem Ehrensitz.
‹Faßt euch›, mahnte der Hausherr, ‹nehmt euch ein Beispiel an eurem Haupt und Helden.›
Aber da scholl vor der großen Haustüre der Ruf der Tuba: für mich das Zeichen, meinen Späherposten zu verlassen und mich meinem Herrn anzuschließen, der an der Spitze der kaiserlichen Lanzenträger und Goldschildner mit dem Präfekten von Byzanz und mit Leo, dem Archon der Palastwache, in das Haus stürmte, dessen Fenster und Türen alle umstellt wurden.
Prachtvoll sah er aus, mein Gebieter», rief Syphax begeistert, «als er, vom purpurnen Helmbusch umflattert, die rotschimmernde Fackel in der Linken, das Schwert in der Rechten, in das Gemach stürmte: so mag der Feuerdämon aussehn, wenn er in Afrika aus dem flammenden Berge taucht.
Ich zog das Schwert und sprang an seine linke Seite, den fehlenden Schild zu ersetzen.
Und er hatte mir geboten, den jungen Anicius gleich unschädlich zu machen. ‹Nieder mit jedem, der widersteht›, gebot Cethegus, ‹im Namen Justinians.› Sein Schwert war über und über rot, denn mit eigner Hand hatte er die Leibwächter niederstoßen helfen, die Belisar am Ausgang des Hains aufgestellt hatte.
‹Ergebt euch›, rief er den Erschrockenen zu, ‹und du, Archon des Palastes, verhafte alle die Verschwörer, verstehst du? Alle.›
‹Ist's möglich? Schändlicher Verräter!› schrie der junge Anicius und sprang mit dem Schwerte gegen meinen Herrn. ‹Ja, das ist der purpurfarbne Helmbusch: stirb, Mörder meines Bruders.›
Aber schon lag er schwer getroffen zu unsern Füßen, ich riß mein Schwert aus seiner Brust und entwaffnete Photius, der allein noch Widerstand wagte. Die andern ließen sich greifen wie vom Gewitter betäubte Hammel.
‹Brav, Syphax! Durchsucht seine Kleider nach Geschriebenem! Nun bist du fertig, Archon?› fragte mein Herr.
Der Archon hatte scheu vor Belisar haltgemacht, der in seiner Ruhe verharrte. ‹Wie?› zweifelte er jetzt, ‹soll ich auch den Magister Militum?—›
‹ Alle, habe ich gesagt. Verstehst du nicht mehr griechisch? Du siehst ja—: ihr alle seht es—: er ist das Haupt der Verschwörung, er trägt den Stab, er steht an dem Ehrenplatz.›
‹Ha›, schrie nun Belisarius, ‹steht es so? Wachen herbei! Helft, meine Leibwächter, Marcellus, Barbatio, Ardaburius!›
‹Die Toten hören nicht, Magister Militum. Gib dich gefangen! In des Kaisers Namen! Sieh hier sein großes Siegel! Er hat mich für heute nacht zu seinem Stellvertreter ernannt, und tausend Lanzen starren um diesen Saal.›
‹Treue ist Wahnsinn›, rief Belisar, warf das Schwert weg und hielt die starken Arme dem Archonten hin, der ihn fesselte.
‹In den Kerker alle Gefangenen. Photius und Belisar, getrennt, in den Rundturm des Anastasius, im Palaste selbst. Ich eile zum Kaiser, bringe ihm seinen Ring und dieses Eisen›, er hob das Schwert des Belisar vom Boden, ‹und melde ihm, daß er ruhig schlafen kann. Die Verschwörung ist aus. Das Reich ist gerettet.›
Schon am andern Morgen begannen die Verhöre in dem Hochverratsprozeß. Viele Zeugen wurden vernommen: auch ich. Ich beschwor, daß ich Belisar als Haupt der Verschwörung hatte begrüßt werden und handeln sehn. Das Wachstäfelchen hatte ich selbst aus des Photius Kleidern gezogen.
Belisar wollte sich auf das Zeugnis seiner Leibwächter berufen: aber sie lagen alle tot.
Auf der Folter gestanden Photius und andere Gefangene, daß Belisar endlich eingewilligt habe, das Haupt der Verschwörung zu werden. Antonina wurde streng in dem roten Hause bewacht. Die Kaiserin weigerte ihr die stürmisch verlangte Unterredung.
Sehr schwer belastete es sie selbst wie Belisar, daß Späher der Kaiserin beschworen, sie hätten den jungen Anicius, in dessen Zisterne man die Waffen und Urkunden der Verschwörer gefunden, und der mit Gewalt hatte gebändigt werden müssen, wochenlang viele Nächte heimlich in Belisars Haus schleichen sehen: und daß dies Anicius selbst, Antonina und Belisar hartnäckig und unverschämt leugneten, während es ganz zweifellos bewiesen war, empörte die Richter aufs äußerste.
Ich mußte Antonina gleich nach der Verhaftung Belisars von meinem Herrn melden, daß dieser im höchsten Grade überrascht gewesen, Belisar wirklich als Haupt der Verschworenen anzutreffen, und ihr zugleich sagen, nicht bloß Briefe des Hasses habe Cethegus in der Zisterne des Anicius gefunden. Bei diesem meinem Wort, das ich selber nicht verstand, sank die schöne Frau ohnmächtig zusammen.
Übrigens brachen wir von Byzanz auf, ehe noch das Urteil über Belisar gefällt war. Nur Photius und die meisten Verschworenen waren bereits zum Tode verurteilt, als wir uns mit der kaiserlichen Flotte einschifften nach Epidamnus, wo meines Herrn Kriegstribunen und Söldner und starke, ursprünglich für den Perserkrieg bestimmte Streitkräfte des Kaisers auf uns harrten.
Denn meinem Herrn war die neu geschaffene Würde eines Magister Militum per Italiam verliehen und der Befehl über das ‹erste Heer›. Das ‹zweite› soll uns Prinz Areobindos nachführen, wenn er das leichte Geschäft vollbracht hat, mit fünffacher Übermacht die kleinen gotischen Besatzungen in den paar Städten von Epirus und den Inseln zu bezwingen. Die sind verloren, wie Sandkörner, die in das Meer gefallen.»
«Was verlautet von der Belisar drohenden Strafe? Ich hätte es nie geglaubt, daß dieser Mann...—»
«Die Richter werden ihn gewiß zum Tode verurteilen: denn er ist schlagend überführt. Und man streitet, ob in dem Kaiser der Romäer die alte Gnade siegen werde oder der neue Zorn. Man meint: er werde die Todesstrafe in Blendung und Verbannung umwandeln. Sehr schlimm für Belisar, sagt mein Herr, dies unsinnige Leugnen. Und ihm fehlt als Rechtsbeistand und kluger Helfer sein Freund Prokopius, der fern in Asien die Bauwerke des Kaisers aufsucht.
Cethegus aber betrieb die Einschiffung des Heeres zu Epidamnus so geheim, daß die dummen Goten hier bei Ancona kaum davon vernahmen. Auch bauten sie auf den Waffenstillstand und erwarteten den bevorstehenden Friedensschluß. Den Vorwand für die Flottenrüstung gewährten Verheerungen, die fremde Schiffe aus Thuleland auf den Inseln des Kaisers anrichteten. So überfiel mein Herr die gotische Flotte in der Nacht, während die Bemannung auf dem festen Lande schlief: und fast ohne Blutvergießen nahm, verbrannte, versenkte er über vierhundert ihrer Kiele.
Aber horch:—das ist mein Herr—: ich kenne seinen Gang—: so schreitet nur noch in meiner Heimat der Löwe von Auras.»
«Willkommen, Licinius, in Italien und im Siege», rief Cethegus im Eintreten. «Wo hast du die Langobarden?»
«Salve, Flottenzerstörer», antwortete der Tribun. «Die Langobarden kommen zwanzigtausend Mann.»
«Das sind sehr viel!» sprach Cethegus, plötzlich sehr ernst. «Ich hatte nur siebentausend gewünscht:—ich weiß kaum, woher das Gold für die fast dreifache Zahl aufzubringen. Denn wohl gemerkt: in meinem, nicht in des Kaisers Sold, will ich sie haben.»
Freudestrahlend, stolzen Auges aber sprach der junge Ritter: «Ich hoffe auf deine Zufriedenheit, Magister Militum. Unentgeltlich kommen die Langobarden nach Italien.»
«Wie das? Und so viele?»
«Ja: der Sohn ihres Königs Audoin,—Alboin ist sein Name, den schon weithin das Heldenlied der Germanen preist bis zu den Bajuvaren am Önus und den Saxonen an dem Wisurgis,—ein sehr tapfrer und für einen Germanen erstaunlich kluger Jüngling...—»
«Ich weiß von ihm—er diente lang unter Narses», meinte Cethegus mißtrauisch
«Dieser kühne und schlaue Barbar hat sich im vorigen Jahre, als Roßhändler verkleidet, nach Italien geschlichen und unerkannt das ganze Land bis Rom und Neapolis durchwandert, die Wege erforscht und die Waffenplätze der Goten. Er wäre noch länger geblieben, hätte ihn nicht derselbe Gote, der meinen armen Bruder erschlagen...—»
«Der schwarze Teja?»
«Derselbe—mit Argwohn verfolgt und ihn zuletzt als Späher festzunehmen gedroht. Da floh Alboin zurück nach Pannonien. Aber Wein und köstliche Edelfrüchte unseres Landes brachte er mit nach Hause und zeigte sie seinem Vater und seinem Volk: und seither brennen alle Langobarden, dieses Wunderland zu betreten. Alboin verlangt nur alle Beute, die seine Langobarden machen werden, und verzichtet auf Sold: es sind prachtvolle Barbaren, diese Langbärte, viel wilder und rauher als die Goten. ‹Ja›, meinte Alboin lachend, als ich ihm dies sagte, ‹wir haben ein Sprichwort: der Gote der Hirsch, der Langobarde der Wolf.› Er trinkt aus dem Schädel des Gepidenkönigs, den er im Kampf erschlug. Du wirst deine Freude haben an ihm und seinen Reitern—die sind mehr wert als Isaurier und Abasgen.»
«Ich danke deinem Eifer», sagte Cethegus zögernd, «er ist mir fast allzugroß. Es sind so viele.»
«Ja, auf geringere Zahl ließ sich Alboin nicht ein: ‹rudelweise rennen die Wölfe!› lachte er.»
«Nun», schloß Cethegus, «ich vertraue: an der Spitze von zwei kaiserlichen Heeren und von Italien halt' ich auch diese große Zahl von Raubtieren in Gehorsam. Zu den Goten werden sie sich doch nicht schlagen?»
«Nein, mein Feldherr. Es geht ein alter Haß durch die Geschichte beider Völker: aus einem jener unfaßlichen Gründe, die nur diese Germanen zum Hasse finden. In grauer Vorzeit hat einmal eine langobardische Königin einen Gotenfürsten ermorden lassen oder umgekehrt:—wer kann sich diese Dinge merken!—und seither ist es Ehrenpflicht von Geschlecht zu Geschlecht, sich zu hassen und zu morden. ‹Wir sind die Totengräber und die Erben dieser Goten›, sagte mir Alboin.»
«Wohl: ihr Unglück sollen sie erben», drohte Cethegus, «sonst haben die Goten nichts zu hinterlassen: sie sterben in der Fremde auf italischer Scholle! Und wann kommen sie, diese pannonischen Wölfe? Ich brauche sie bald.»
«Das hat Alboin noch nicht bestimmen können. Sie haben einen Bund mit den noch wilderen Awaren—das sind keine Germanen!—geschlossen, gemeinsam das arme Volk der germanischen Gepiden noch vollends auszumorden und deren Land zu teilen.»
«Ein grimmiges, gefährliches Geschlecht», sprach Cethegus kopfschüttelnd.
«‹Ja›, lachte Alboin, ‹Wolf und Geier jagen gemeinsam und teilen das Reh.—Ist diese Arbeit getan, dann geht's über Dravus, Savus und Sontius nach Venetia: ich kenne die Wege.›»
«Er kennt sie so gut», sagte Cethegus halb zu sich, «daß man diesen Wolfs-Jüngling sie gar nicht mehr zurückschreiten lassen darf. Licinius, ich brauche rasche und starke Verstärkung. Der Angang war gut: aber nun gehts nicht recht vorwärts. Die Italier, schmählich zu sagen, stehn nicht auf: sie halten zu den Barbaren», lächelte er zornig, «aus ähnlichen Gründen wie mein zu Tod gefressener Freund Balbus. Gewiß rückt der Gotenkönig schon vor Rom heran, mit starkem Heer, seine Flotte zu rächen. Ich kenne ihn: er greift an! So schicke ich denn Eilboten nach Eilboten an Areobindos, der wirklich ein Prinz der Schnecken ist, rasch das ‹zweite Heer› heranzuführen: er soll die versprengten Goten in Epirus an der eignen Tollkühnheit ihrer Stellung zugrunde gehen lassen. Aber kein Areobindos kommt. Und mit meinen Byzantinern kann ich im offenen Feld diesen Totila nicht schlagen, wenn er die Übermacht hat.»
«Und Ravenna? Wird es sich noch halten können, wenn du nicht eilig Entsatz bringst?»
«Ravenna ist befreit. Nach Zerstörung der gotischen Flotte schickte ich auf die Reede von Classis dreißig meiner Trieren unter dem Nauarchen Justinus: sie drangen in den Hafen Classis und versahen die Stadt mit neuen Vorräten. Und vor einigen Tagen vernehme ich, daß der alte Hildebrand die Belagerung auch auf der Landseite aufgehoben und sich in Eilmärschen, westlich um uns herum, mit seinen wenigen Tausendschaften nach Florentina und Perusia gezogen hat. Angeblich, aber das ist eine handgreifliche Unmöglichkeit! weil ein ungeheures Heer des Kaisers auf dem Landweg von Dalmatien, von Salona her, durch Venetien in Eilmärschen gegen Ravenna heranrücke.
Wäre dem doch so! Aber leider weiß ich besser, daß das ‹zweite Heer›, das übrigens kleiner als das meine, nicht in Dalmatien steht und nicht in Salona, welche Stadt die Goten haben und nicht der Kaiser, sondern drüben in Epidamnus sich sammelt, unglaublich langsam. Denn Prinz Areobindos, dem man sehr mit Unrecht Eilmärsche zutraut, pflückt lieber noch wohlfeile Lorbeern in Epirus.
Und deine schöne Gönnerin, mein Licinius, die Kaiserin, ist mir zwar gewogen: aber mich sehr geschwinde siegen zu sehen ist weder ihr noch dem Kaiser der Romäer erwünscht. So muß ich denn harren und harren, bis der Schneckenprinz heranschleicht. Aber da oben bei Senogallia war unseres Bleibens nicht.
Mich zog's gen Rom!
Auch sind die Stellungen da oben zu schwach, sie gegen Übermacht zu halten. Diese treffliche Stellung hier bei Setinum, Caprä und Taginä habe ich mir schon lang einmal ausgewählt.
Und so eilte ich hierher—schnell! Aber doch nicht schnell genug. Denn Setinum zwar gelang es noch zu erreichen.
Aber nicht mehr Caprä und Taginä, die notwendige Deckung.
Und doch ist Taginä der Schlüssel der Stellung:—ohne Caprä und Taginä ist mein Lager eine Festung zwar mit Wall, aber ohne Graben: die drei Flüßchen bei Caprä und Taginä sind deren natürliche Gräben. Sofort sprengte ich selbst von Setinum aus gegen Taginä mit den sarazenischen Reitern: aber zu spät.
Graf Teja—er muß auf den Schwingen des Sturmwindes von Rom herangebraust sein!—Graf Teja hatte Taginä kurz vor mir erreicht mit einer fliegenden, dem Hauptheer vorangeworfenen Schar: und obwohl die Sarazenen sieben gegen drei waren, hat er sie mit seinen gotischen Beilreitern blutig zurückgeworfen: es war kein Halten mehr, nachdem er den Sarazenenkönig Abocharabus den Jüngeren mit dem Beil vom Turban bis zum Gurt durchspalten, heulend rissen meine Sarazenen die Renner herum und jagten davon, über Caprä zurück, mich mit fortreißend.
Heute suchte ich nun die Stärke der Besatzung von Taginä zu erkunden—denn gern möchte ich den Verhaßten erdrücken, ehe das gotische Hauptheer eintrifft—aber die Stellung von Caprä war heute schon nicht mehr zu durchdringen. Und bereits soll der Barbarenkönig selbst im Anzug sein: die Nachhut führe der Herzog Guntharis heran.
Und wo bleibt, wann kommt mein ‹zweites Heer›?»
Am Tage darauf traf König Totila mit einem Teil des Heeres wirklich in Taginä ein: Valeria, die jetzt am sichersten geborgen war im Lager des Königs, begleitete ihn: auch Julius, der sich wieder in seine Klosterstiftung nach Avenio in Gallien begeben wollte, und Cassiodor, der diese prüfen sollte.
Die Hauptmacht des Heeres sollten Herzog Guntharis und Wisand, der Bandalarius, auf der flaminischen Straße von Süden heranführen, während von Westen, von Florentia her, der alte Hildebrand im Anzug war. Erst nach dem Eintreffen dieser Truppen konnte der Angriff auf die sehr feste Stellung des Präfekten unternommen werden.
Und auch Cethegus wies das Drängen der jungen Ritter zum Angriff ab. «Ich bin nicht gekommen, Schlachten zu gewinnen, sondern Italien. Demnächst haben wir die Übermacht:—dann hat es Sinn, zu schlagen.»
Eines Morgens trat Julius in des Königs Zelt und reichte ihm schweigend einen Brief.
Totila furchte die Stirn, da er die Handschrift erkannte und las: «An Julius Manilius Cethegus, der Präfekt von Rom und Magister Militum per Italiam. Ich höre, du weilst im Lager der Barbaren. Licinius sah dich reiten neben dem Tyrannen. Soll das Unerhörte geschehen, daß Julius gegen Cethegus die Waffen führt, der Sohn gegen den Vater?
Gewähre mir heute, um Sonnenuntergang, eine Unterredung bei dem zerfallenen Tempel des Silvanus, der zwischen unsern und der Barbaren Vorposten liegt.
Der Tyrann hat mir Italien, Rom und deine Seele geraubt. Ich werde ihm alle drei wieder entreißen—und dich zuerst. Komm: ich befehle es als dein Vater und Erzieher.»
«Ich muß ihm gehorchen—ich verdanke ihm so viel.»
«Ja», sagte Totila, ihm den Brief zurückgebend.
«Aber die Stelldichein des Präfekten sind gefährlich.
Du hast mich gebeten, nie mehr über deinen ‹väterlichen Wohltäter› mit dir zu sprechen. Ich hab' mein Wort gegeben und hab's gehalten. Aber warnen darf ich, muß ich.»
«Er wird mein Leben nicht bedrohen.»
«Aber vielleicht deine Freiheit! Nimm fünfzig Reiter mit. Ohne solches Geleit lasse ich dich nicht aus dem Lager.»
Gegen Sonnenuntergang erreichte Julius mit seiner Bedeckung das zerfallene Gemäuer. Nur wenige Säulen des alten Fanum standen noch aufrecht, die Mehrzahl lag umgestürzt an den Seiten des Hügels, auf welchem sich der schlichte Monopteros erhob: auch das Dach des Gewölbes war zum Teil herabgestürzt. Üppig wuchernder Efeu umkleidete die Säulenschäfte, Steinbrech und allerlei Unkraut überwucherte die zahlreichen Marmorstufen, die hinanführten zu dem ringsum offnen Bau.
Diesmal hatte Totila dem Präfekten ohne Grund mißtraut. Denn als Julius am Fuße des Hügels angelangt war mit fünfzig Reitern,—fünfzig folgten auf des Königs Befehl ihm später noch aus dem Lager und näherten sich nun ebenfalls—sah man Cethegus allein in dem Innenraum des Tempels wartend auf und nieder schreiten.
Julius war vom Pferde gestiegen und schritt die Stufen hinan. Cethegus empfing ihn mit vorwurfsvollem Blick. «Du lässest dich erwarten: der Sohn vom Vater. Beim ersten Wiedersehn, nach so langer Zeit.
Ist das Mönchs-Moral? Und wohl gehütet kommst du! Wer hat dich gelehret, mir mißtrauen? Wie? Folgen uns deine Barbaren bis hierher?»
Und er wies auf einen Anführer der zuletzt gekommenen in braunem Mantel und übergeschlagner Kapuze, der, mit zwölf seiner Begleiter, vom Rosse sprang und sich mit den Seinen die Stufen herauf lagerte bis an die oberste Staffel.
Julius wollte sie entfernen, aber ein zweiter Anführer, Graf Thorismut, antwortete kurz: «Befehl des Königs!» und lagerte sich auf die zweite Stufe.
«So sprich griechisch», sagte Julius. «Das verstehn sie nicht.»
Cethegus streckte ihm beide Hände entgegen. «So sieht Odysseus, der Weitumwandernde, seinen Telemachos wieder.»
Aber Julius trat zurück von ihm. «Schwarze Gerüchte gehen über dich, Cethegus. Hat diese Hand nur im Kampfe Blut vergossen?»
Cethegus ballte die zurückgewiesene Hand grimmig zur Faust. «Haben deines Busenfreundes Lügen mir ganz dein Herz vergiftet?»
«König Totila lügt nicht. Er hat seit Monden nicht mehr deinen Namen genannt. Ich bat ihn darum. Denn ich konnte dich nicht verteidigen gegen seine furchtbaren Anklagen. Ist es denn wahr, daß du seinen Bruder Hildebad...?»
«Ich bin nicht gekommen, Entschuldigungen zu geben, sondern sie zu heischen. Seit Jahren tobt der Kampf um Rom mit Priestern, Griechen, Barbaren. Und ich stehe allein. Müde, wund, halb verzweifelnd, von den Wogen des Geschicks bald emporgetragen, bald tief in den Abgrund geschleudert. Aber immer allein. Und wo ist Julius, mein Sohn, der Sohn meiner Seele, mich zu erquicken mit seiner Liebe? In Gallien unter den Mönchen, in Byzanz oder in Rom als Werkzeug oder als Gast des Barbarenkönigs. Fern von mir und meinem Wege.»
«Ich warnte dich vor diesem Wege: rote und schwarze Flecken liegen darauf: ich kann ihn nicht mit dir gehn.»
«Nun: und wenn du so weise bist und so eifrig im Dienste deines Glaubens—wo warst du, mich zu erleuchten und zu retten?» und nun entsandte Cethegus ein lang und sorgfältig gezieltes Geschoß der Überredung, das er bis zuletzt sich aufgespart. «Wenn meine Seele sich der Liebe, der Wärme immer mehr verschloß, wenn sie versteinte und vereiste,—wo war Julius, mich zu erweichen und zu erwärmen? Hast du deine Pflicht als Sohn, als Christ, als Priester an mir erfüllt?»
Diese Worte machten erschütternden Eindruck auf den frommen Sinn und das sanfte Gemüt des jungen Mönches. «Vergib», sagte er, «ich erkenne: ich habe gefehlt gegen dich.»
Cethegus ersah blitzschnell seinen Vorteil. «Wohlan: so mach' es gut. Ich verlange nicht, daß du Partei ergreifst in diesem Kampf. Erwarte den Ausgang. Aber erwarte ihn bei mir, an meiner Seite, in meinem Lager: nicht bei den Barbaren und nicht in Gallien. Bin ich Saul, der Gottes Gnade verwirkt hat,—wohlan, sei du David und erhelle meine Seele, die oft verdüsterte. Deine heiligste Gewissenspflicht zwingt dich an meine Seite. Sonst:—auf dein Haupt die Verantwortung! Ja, du bist der gute Genius meines Lebens. Ich brauche dich und deine Liebe, soll ich nicht ganz jenen Mächten verfallen, die du hassest. Gibt es eine Stimme, die mich dem Glauben gewinnen mag, der da, wie du lehrst, allein selig macht,—so ist es deine Stimme, Julius. Nun entscheide dich:—nach Gewissenspflicht.»
Der eifrige und pflichttreue Christ vermochte nicht zu widerstehen: «Du hast gesiegt!—Ich folge dir, mein Vater!» und er war im Begriff, sich an des Überwinders Brust zu werfen.
«Verfluchter Heuchler!» scholl da eine helle, starke Stimme. Der Reiterführer, der auf der obersten Tempelstufe sich gelagert hatte, sprang auf die Plattform im Innenraum und schlug die Mantel-Kapuze zurück. Es war König Totila, das nackte Schwert in der Hand.
«Ha, der Barbar hier!» schrie Cethegus in tiefstem Grimm des Hasses.
Auch sein Schwert blitzte: und in tödlichem Hasse trafen die Feinde zusammen: die Klingen kreuzten sich klirrend. Aber Julius warf sich zwischen die Kämpfer, mit beiden Händen ihre Arme hemmend. Es gelang ihm, sie für den Augenblick zu trennen.
Jedoch drohend standen die beiden, die Schwerter fest in der Faust, einander gegenüber.
«Hast du gehorcht, König der Barbaren?» knirschte der Präfekt. «Das ist ja echt königlich und heldenhaft.»
Allein Totila gab ihm keine Antwort. Zu Julius gewendet sprach er: «Nicht nur um deine äußere Freiheit und Sicherheit war ich besorgt. Ich kannte, ich ahnte seine Anschläge auf deine Seele. Ich habe versprochen, ihn nie mehr, den Abwesenden, zu verklagen. Aber nun steht er mir und dir gegenüber. Er soll mich hören bis zu Ende und sich verteidigen, wenn er kann. Aufdecken will ich dir, daß seine Seele und jeder Gedanke seines Geistes schwarz und falsch sind wie der Satan.
Siehe, selbst diese Worte, die der Augenblick, das warme Gefühl erzeugt zu haben schien, die dich schon für ihn gewonnen hatten,—sie sind falsch, erheuchelt, ausgesonnen seit Jahren. Sich her, Julius, kennst du diese Schrift?»
Und er wies dem Erstaunten eine beschriebene Papyrusrolle.
«Die Barbaren stehlen sonst nur Gold», sprach grimmig Cethegus. «Briefe stehlen macht infam, ist ehrlos.» Und er griff nach der Rolle.
Aber Totila fuhr fort: «In seinem Hause, an geheimer Stätte hat Graf Teja sie erbeutet. In welchen Abgrund ließen sie mich schauen, seine Tagebücher! Ich schweige von den Verbrechen gegen andre. Hier aber schreibt er, was dich betrifft: ‹Julius geb' ich noch nicht verloren. Laß sehen, ob den Schwärmer nicht die Pflicht der Seelenrettung gewinnt. Er wird meine Hand fassen zu müssen wähnen, um mich zum Kreuz empor zu ziehn. Aber mein Arm ist der stärkere: und ich reiße ihn herüber in meine Welt. Schwer wird mir nur der erforderliche Ton der Zerknirschung werden. Ich muß dafür in Cassiodor lesen›.»
«Cethegus», rief Julius jammernd, «hast du das geschrieben?»
«Ich dächte, du kennst den Stil. Aber oh, er wird leugnen.—Alles leugnen, was ich weiß oder ahne. Leugnen wird er, daß er den Baltenherzog Alarich mit Fälschungen verleumdet, daß er für Athalarich und Kamilla Gift gemischt, daß er durch Amalaswintha die drei andern Baltenherzöge gemordet, daß er Mörder gegen mich geschickt, daß er Amalaswintha an Petros, Petros an die Kaiserin, Witichis an Belisar, Belisar an Justinian verraten: leugnen, daß er den Sohn des Boëthius in den Tod geschickt, daß er meinen Bruder gemordet, daß er im Waffenstillstand unsre Schiffe friedschändend überfallen: er wird all dies leugnen—denn Lüge ist der Hauch seines Mundes.»
«Cethegus», flehte Julius, «sprich ‹Nein›, und ich glaube dir.»
Aber der Präfekt, der anfangs die Worte Totilas mit halb geschlossenen Augen wie Keulenschläge schweigend hingenommen, stieß jetzt das Schwert in die Scheide, richtete sich hoch auf, kreuzte die Arme über die Brust und sprach: «Ja, ich habe das getan. Und andres mehr. Ich habe hinweggeräumt, was mir den Weg versperrte, mit Kraft und Klugheit. Denn der Weg führt zum höchsten Ziel, zum Heil des Römerreichs. Und zugleich zum Thron der Welt. Aber mein Erbe in dieser Weltherrschaft—solltest du sein, Julius. Für Rom und für dich—am wenigsten für mich selber!—hab' ich meine Taten getan. Warum für dich? Weil ich dich liebe, dich allein auf Erden. Nicht mit deiner christlichen Nächstenliebe, welche die ganze Menschheit gleichmäßig umspannen soll. Diese lauwarme Schwäche habe ich immer verachtet. Nein, heiß, mit Schmerz und Leidenschaft. Statt der Menschheit lieb' ich dich. Ja, mein Herz ist versteint in Verachtung der Kleinheit der Menschen. Nur ein Gefühl sprießt noch aus diesem Granitfels: die Liebe zu dir.
Du hast sie nie verdient, diese Liebe.
Aber ein Wesen, dessen Züge du trägst, dessen Bild mir dein Anblick emporführt aus dem Grabe, aus der Jugendvergangenheit, webt ein geheimnisvoll zwingendes Band zwischen mir und dir. Erfahre denn jetzt vor meinem Feinde das heilige Geheimnis, das du erst zu der Stunde erfahren solltest, da du ganz mein Sohn geworden.
Es gab eine Zeit, da des jungen Cethegus Cäsarius Herz weich war und zart, wie das deine. Und darin lebte eine Liebe, heilig und rein wie die Sterne, zu einem, ach, unvergleichlichen Geschöpf Und sie liebte mich wie ich sie. Aber alter Haß trennte das Geschlecht der Cethegi und der Manilier seit Jahrhunderten.»
Da erbleichte Julius; Totila warf das Schwert in die Scheide und hörte, mit beiden Armen auf den Griff gestützt, nun aufmerksamer zu.
«Sie mit dem Senat—wir mit den Gracchen. Sie mit Sulla—wir mit Marius. Sie mit Cicero—wir mit Catilina. Sie mit Pompejus, wir mit Cäsar. Und doch war mir's endlich gelungen, den harten Sinn des Vaters zu erweichen: er schien bereit, zögernd sein Ja zu sprechen. Denn er sah, wie wir uns liebten. Sie folgte mir willenlos, wie Eisen dem Magnet, und ich fühlte, daß sie mein guter Genius war. Da kam ein Gotenherzog, dessen Seele den Furien geweiht sei, der mich langher kannte und haßte. Er warnte Manilius, der anvertrauend zu ihm aufblickte, weil er bei dem ersten Andrang der Barbaren in Italien ihn und sein Haus vor Bedrückung beschützt. Er warnte den Vater vor dem Mann Cethegus mit dem bösen Blick, wie er sagte, und er weckte den alten Groll: und er ruhte nicht, bis der Vater sein Kind, das widerstrebende, einem gallischen Senator, einem Freunde des Baltenherzogs, verlobte.
Umsonst flehte Manilia um Erbarmen. Da beschlossen wir die Flucht. Im Landhaus am Tiber vor der Porta Aurelia wohnten sie. Jedoch argwöhnisch beschleunigte der Vater die Vermählung. Als ich zur verabredeten Nacht die Gartenmauer überstieg und in ihr Schlafgemach schlich, fand ich es leer. Aber vorn im Atrium scholl Hymenäen-Gesang und Flötenspiel. Atemlos schleiche ich an die Vorhänge und spähe hinein. Da ruht meine Manilia, in der Neuvermählten Tracht, an ihres Vaters Seite, der Bräutigam bei ihr—und ungezählte Gäste, Manilias bleiches Antlitz, ihre tränenfeuchten Augen seh' ich—ich sehe, wie Montanus den Arm um ihren Nacken spannt.—Da ergreift mich wahnsinnige Verzweiflung: ich stürme in den Saal und umschlinge sie und reiße sie mit mir mit hochgeschwungenem Schwert.
Aber sie waren zu neunzig, die Tapfern: lang erwehrte ich mich ihrer, da traf mich des Balten Alarich Schwert—: und sie rissen mir die Schreiende aus dem Arm und warfen mich blutend, für tot, über die Gartenmauer nah an den Tiber.
Allein damals, vor bald sechs Lustra—wie vor Jahr und Tag!—hat mich der Hauch des Flußgottes aus der Betäubung des Todes geweckt.
Fischer fanden mich, pflegten mich: ich genas.
Aber das Herz war mir aus der Brust gerissen worden jene Nacht.
Und viele, viele Jahre vergingen. Ich haßte die Welt und ihren Gott, wenn einer lebte.
Und das Geschlecht der Manilier und der Balte Alarich haben es verspürt, daß ich nicht tot war. Geächtet flohen sie alle aus dem Lande, schwer getroffen von meiner Rache. Nur ein Bild blieb unvergleichlich, rührend schön in meiner Seele.—
Und abermals nach Jahren kam ich reisend nach Gallien an den Rhodanus. Da war Krieg entbrannt zwischen den Barbaren. Franken und Burgunden waren eingefallen in das Gallien der Goten und hatten eine Villa am Rhodanus zerstört. Und als ich die gestürzten Säulen des Atriums und den zertretenen Garten betrachtete, lief ein kleiner Knabe aus dem Innenhause und weinte und rief mich an: ‹Hilf, o Herr, denn meine Mutter stirbt!›»
«O Cethegus», rief Julius mit schmerzerstickter Stimme.
«Und ich drang in das Haus, das noch dampfte von kaum erloschenem Feuer. Da lag im Frauengemach ein bleiches Weib, einen Pfeil in der Brust. Und sonst war das Haus leer: die Sklaven waren geflohen oder fortgeschleppt. Und ich kannte die sterbende Frau: und ihr Kind hieß Julius. Ihr Gatte war bald nach deiner Geburt gestorben. Und die Sterbende schlug die Augen auf, da sie meine Stimme vernahm.
Denn sie liebte mich noch immer.
Und ich gab ihr Wein und Wasser aus meinem Helm zu trinken. Und sie trank und dankte und küßte mich auf die Stirn und sprach: ‹Habe Dank, Geliebter! Sei du meines Knaben Vater: versprich es mir.›
Und ich versprach es ihr in die erkältende Hand. Und küßte sie und schloß ihr die gebrochenen Augen.
Und ob ich mein Wort gehalten an dem Knaben:—du magst entscheiden.»
Und der eiserne Mann drückte mit Gewalt die Brust, die mächtig atmende, zusammen.
Julius brach in einen Strom von Tränen aus: «O meine Mutter!» rief er.
Totila aber schritt bewegt in der Rotunde auf und nieder.
Cethegus fuhr fort: «Und nun:—wähle!
Wähle zwischen mir und deinem ‹unbefleckten› Freund.
Aber wisse: die Taten, die dir nicht gefallen, hab' ich zumeist für dich getan. Laß mich denn einsam—wende dich von mir:—geh' zu ihm, ich halte dich nicht mehr.
Jedoch wenn mich Manilias Schatte nach dir fragt, werde ich wahrheitstreu antworten: ‹Ein Vater war ich ihm:—er mir kein Sohn›.»
Julius verhüllte sein Haupt im Mantel.
Totila aber machte halt vor dem Präfekten und sprach: «Unväterlich zerfleischest du sein Herz. Du siehst ihn hin und her gezerrt von widerstreitenden Gefühlen. Auf, ich weiß ein Mittel, die Wahl ihm zu sparen. Auf, Cethegus, enden wir allein den drohenden Krieg. Ein zweiter Gotenkönig ladet dich zum Zweikampf.
Hier, im Antlitz deines Lieblings, schelt' ich dich: Lügner, Fälscher, Verräter, Mörder, ehrloser Neiding.
Des Bruders Blut bluträchend heisch' ich von dir.
Heraus dein Schwert, wenn du ein Mann. Laß uns, um Leben, Rom und Julius fechtend, in kurzem Kampf den langen Haß vollenden. Verteidige dich!»
Und in wild aufloderndem Haß rissen beide die Schwerter aus den Scheiden: zum zweitenmal kreuzten sich die Klingen.
Und abermals warf sich Julius zwischen die Ergrimmten mit ausgebreiteten Armen.
«Haltet ein, ihr grausamen Männer der Hasses und der Welt. Jeder Streich trifft in mein blutend Herz. Hört mich an: gefaßt ist mein Entschluß. Ich fühl's: der Geist meiner Mutter gab ihn mir ein.»
Grollend senkten die beiden Feinde die Schwerter, ohne sie einzustecken.
«Cethegus, ein Vater bist du mir gewesen mehr als zwei Jahrzehnte. Was du gefrevelt und getan,—nicht dem Sohne ziemt zu richten. Ich fasse deine Hand liebevoll:—und wäre sie noch tiefer in Mord getaucht meine Tränen, mein Gebet sollen sie reinigen.»
Totila trat zürnend einen Schritt zurück, und des Präfekten Auge leuchtete auf in Siegesfreude.
«Aber nicht ertragen kann ich», fuhr der Mönch fort, «dein furchtbares Wort: um meinetwillen, für mich habest du getan, was du verbrochen. Wisse, nie, niemals, selbst wenn es sonst mich lockte,—mich aber lockt die Dornenkrone von Golgatha, nicht die blutbefleckte Krone Roms—könnt' ich dein Erbe antreten, an welchem solche Flüche hangen. Ich bin dein:—aber sei du auch meines Gottes: sei mein, nicht der Welt und der Hölle eigen. Wenn du mich wirklich liebst,—entsage deinen verbrecherischen Plänen. Aber mehr—mehr: du mußt bereuen. Ohne Reue und Buße keine Erlösung.
Und ich will mit Gott ringen im Gebet, bis er dir vergibt. Widerrufe in Gedanken deine Taten.»
«Halt an», sprach Cethegus, sich hoch aufrichtend. «Was sprichst du da von Reue, der Knabe zum Mann, zum Vater der Sohn? Laß du ruhig meine Taten auf meinem Haupt: ich habe sie zu tragen, nicht du.»
«Nein, Cethegus, nimmermehr. Wenn du beharrst, kann ich dir nicht folgen. Bereue,—beuge dich,—nicht vor mir, wahrlich: vor Gott dem Herrn.»
«Ha», lachte Cethegus, «sprichst du zu einem Kinde?
Alles, was ich getan,—wär's ungeschehn:—ich würd' es alles, alles noch mal tun.»
«Cethegus», rief Julius entsetzt, «welch schrecklich Wort! Glaubst du denn wirklich nicht an einen Gott?»
Aber gereizt fuhr Cethegus fort: «Bereuen! Bereut das Feuer, daß es brennt? Du kannst es nur ersticken: nicht hemmen, daß es brennt, solang es lebt. Lob' es, schilt es, wie du willst: doch laß es Feuer sein! So muß Cethegus den Gedanken folgen, die wie der Lauf des Blutes durch sein Haupt rinnen. Ich will nicht, ich muß wollen. Und, wie der Gießbach niederschäumt von Bergeshöhn, bald durch blumige Wiesen, bald durch schroffes Gezack, bald segnend befruchtend, bald tödlich zerstörend, ohne Wahl, ohne Vorwurf, ohne Dankrecht:—so reißt mich das Geschick dahin den Weg, den Eigenart und die gegebene Zeit und Welt um mich her vorzeichnen. Soll ich bereuen, was ich auf meinem Weg zerstört, zerstören mußte? Ich tät' es immer wieder.»
«Entsetzlicher! In diesen Worten weht der Hauch der Hölle! Wie kannst du erlöst werden, wenn du nicht erkennst, daß du gesündigt? Des Menschen Wille ist frei.»
«Ja, so frei wie der geworfene Stein, der sich einbildet, er könne fliegen.»
«O fürchte, Cethegus, fürchte den lebendigen Gott!»
Aber, grimmiger als zuvor, lachte Cethegus. «Ha, wo ist er denn, dieser lebendige Gott?
Ich habe, den Himmel entlang, den Gang der Gestirne, ich habe die grausame Natur, ich habe die grausamere Geschichte der Menschen durchforscht und keinen Gott gefunden als das Recht des Stärkeren, die Notwendigkeit, die furchtbar erhabene Göttin, deren Anblick versteint wie der der Meduse.
Du birgst dich, Knabe, in die Mantelfalten deines geträumten Gottes, du steckst dein Haupt in seinen Vaterschoß, starrt dich des Schicksals Walten mit den Gorgonenblicken an. Wohl, es sei: aber schilt nicht den Mann, der, den Blick erwidernd, spricht: ‹Es ist kein Gott› und würd' er drob zu Stein.
Ja, das Lächeln und das Weinen sind zwei holde Genüsse. Prometheus aber hat nicht gelächelt, als ihm Pandora die betörende Büchse bot. Aber er hat auch nicht geweint, als ihm Gewalt und Kraft die Glieder an die Felsen schmiedeten. Und an den Geier, der ihm das Herz zerfleischt—nun, an den Geier—hat er sich gewöhnt. Und eher ermüdete das Schicksal, den Titanen zu quälen, als daß sich der Titane gebeugt.»
«Cethegus», flehte Julius, «sprich nicht so! Ich sage dir: es ist ein Gott.»
«So? wo war er denn, als man Manilia mit Gewalt zu verhaßter Ehe zwang, als man für ewig des Cethegus Herz vergiftete? Wo war er denn, als ihr der blinde Zufall einen Frankenpfeil in das Herz gejagt?
Ha, auch ich habe an ihn geglaubt: genauso lang war ich der Spielball der andern.
Später aber hab' ich gehandelt unter der Voraussetzung, die mich mein eignes Schicksal gelehrt: ‹Es ist kein Gott›. Und siehe da: seither treffen alle meine Schlüsse zu!
Wo war er denn, dein gerechter, allmächtiger, allweiser, allgütiger Gott, als die schuldlose Kamilla den nicht für sie gemischten Becher trank? Wo blieben da seine Wunder und Engel? Als Calpurnius den Knaben des Witichis von den Felsen warf, warum haben die Engel Gottes nicht das Kind aufgefangen—fällt ja doch kein Sperling vom Dache ohne Gottes Wille!—und den Mörder zerrissen? Wo war er denn, dein rettender Gott, als ich den Massagetenpfeil auf jene wackre Rauthgundis entsandte? Ha, lebte ein Gott im Himmel:—rückprallen mußte der Pfeil von dem treuen Weibe und des Cethegus Brust durchbohren! Aber der Pfeil war scharf und gut gezielt: und darum starb Rauthgundis, wie wenn sie die Möwe des Padus gewesen. Drum rede mir nicht vom lebendigen Gott, du lallender Knabe.»
«Cethegus!» sprach Julius, «mir graut. Das ist die furchtbarste Gotteslästerung, die ich je gehört.»
Totila wandte sich schaudernd ab und warf das Schwert in die Scheide.
«Wer so denkt», rief er, «ist genug bestraft. Doch, Präfekt von Rom:—du kennst noch das Ende deiner Taten nicht. Erwarte es: vielleicht glaubst du dann an den rächenden Gott.»
«Das Ende meiner Taten», lachte Cethegus, «ist mein Tod. Das weiß ich längst. Ob ich ihn nun finde auf dem Throne nur des Okzidents oder des Weltkreises, ob in verlorner, ob in siegreicher Schlacht, ob durch Beil oder Schwert:—das ist für unsre Gottesfrage gleich. Und wenn es eine Hölle gäbe—wohlan: auch an den Kaukasus geschmiedet blieb Prometheus er selbst. Aber genug der Worte und übergenug. Hierher zu mir, an meine Brust, Julius, denn du bist mein.»
«Ich bin Gottes des Herrn, nicht dein!» sprach Julius, bekreuzigte sich und trat einen Schritt von ihm zurück.
«Du bist mein Sohn—gehorche mir.»
«Du aber bist Gottes Sohn gleich mir. Du verleugnest—ich bekenne unsern Vater. Für immer sag' ich mich los von dir.
Denn wenn, wie unser Glaube lehrt, ein Luzifer lebt, der Dämonen Oberster, der lichte Morgenstern, der stärkste, der herrlichste der Geister Gottes, der aus Stolz und Gottesleugnung herabgesunken ist zur Hölle—dann bist du es, entsetzlicher Mann.»
«Ha, aber Luzifer ward aus einem Diener des Himmels ein Kaiser: ob zwar ein Kaiser der Hölle. Lieber als im Himmel der Zweite, in der Hölle der Erste. Folge mir.» Und hingerissen von Leidenschaft, zog er den Mönch am Arm auf seine Seite herüber.
Da blitzten zum drittenmal Totilas Schwert und das Schwert des Präfekten.
Und diesmal ward es Ernst: nicht gelang es Julius mehr, die Grimmen zu scheiden.
Totila schlug gegen des Präfekten Stirn: der Hieb war zu stark, ganz abgewehrt zu werden: der Helm flog dem Römer rücklings vom Haupt und Blut schoß aus seiner Wange.
Der Gegenstoß des Präfekten drang durch Totilas Mantel: zwar hielt der Ringpanzer die Spitze auf, aber von der Kraft des Stoßes flog Totila einen halben Schritt zurück.
Tödlich drohte der nächste Zusammenstoß zu werden:—Schilde fehlten ja beiden.
Und nochmals prallten sie zusammen: ein Weheschrei des Mönches, der sich zwischen sie warf, hätte sie kaum noch getrennt—des Präfekten Schwert hatte ihm die hemmende linke Hand gestreift—: aber nun wurden beide Kämpfer auseinandergerissen von Männern, die, unbeachtet von den drei im leidenschaftlichen Ringen Wogenden, die Tempelstufen in den letzten Augenblicken emporgeeilt waren.
Totila von Thorismut und Wisand, Cethegus von Licinius und Syphax.
«Die Verstärkungen sind da und wichtige Kunde aus dem Süden», rief Graf Thorismut. «Graf Wisand kam als Bote von Guntharis. Komm rasch zurück: die Schlacht steht bevor.»
«Komm rasch zurück ins Lager!» rief Licinius Cethegus zu, «das ‹zweite Heer› ist da.»
«Mit Areobindos?»
«Nein, Herr», rief Syphax: «die Kaiserin Theodora ist plötzlich gestorben: Narses ist der gesendete Feldherr: und er kommt mit hunderttausend Mann.»
« Narses?» frug Cethegus erbleichend, «ich komme! Auf Wiedersehn, Julius, mein Sohn!»
«Ich bin Gottes Sohn!»
«Er ist mein!» rief Totila, ihn umschlingend.
«Wohlan: der Kampf um Rom wird auch diesen Kampf entscheiden. Aus der Barbaren Lager hol' ich dich heraus.»
Und er eilte die Stufen hinab.
Gleich darauf sprengte Cethegus mit den Seinen nach Norden, Totila und Julius mit den Ihrigen nach Süden in ihre Lager.
Der Präfekt fand in seinen Zelten noch nicht Narses selbst, auch keine Boten dieses Feldherrn, was ihn erstaunte: Piso und Salvius Julianus, die er mit dringender Mahnung an Areobindos nach Ancona entsendet hatte, waren schon bei Cale auf die Vorhut des Narses—germanische Reiter, wie sie sagten—gestoßen und hatten von diesen und einem byzantinischen Archon Basiliskos Dinge erfahren, die sie zur schleunigsten Umkehr bewogen, Cethegus zu warnen.
«Ja, er hat mich offenbar überraschen wollen», sprach Cethegus nachsinnend: «aber warte nur, Narses», schloß er grimmig. «Auch Belisar stand mit Übermacht bei Capua: und ich hab' ihn doch gemeistert, solang er im Lande war und zuletzt hinausgeschoben aus meinem Italien. Laß sehn, ob der Krüppel stärker ist als der löwenherzige Held.»
«Sei vorsichtig, mein Feldherr», warnte Piso. «Es liegen schlimme Dinge in der Luft:—es wird schwül über deinem Haupte. Dieser Basiliskos, des Narses Vertrauter—ich kenne ihn von Byzanz her—war mir höchst unheimlich.»—
«Ja», fügte Salvius Julianus bei, «er war so einsilbig: nichts war aus ihm herauszuforschen, als was er selbst mitzuteilen wünschte.»—«Mehr, als wir von ihm, erkundeten unsere Sklaven von den seinen.»—«Aber als der Führer der Germanenreiter dazukam, wie sie plauderten, schlug er einen Diener des Basiliskos tot auf dem Fleck.»—«Da wurden die Lebendigen so stumm wie ihr toter Kamerad.»—«Zusammenhanglos, widerspruchsvoll, verworren ist, was wir so erkundeten.»—«Fest steht nur: in Byzanz muß ein plötzlicher Umschwung aller Dinge eingetreten sein.»—«Und zwar noch am Tage deines Abgangs aus der Stadt.»—«Die Kaiserin, flüsterten die einen, habe sich selbst in Kohlendunst erstickt.»—«Der Prozeß gegen Belisar», schaltete der Jurist ein, «ist in ein neues Stadium getreten, auf Antrag Tribonians, sagt man, oder Prokops habe der Kaiser das Urteil des Senates vernichtet.»—«Man nannte die Namen: Narses, Antonina, Anicius, Prokopius in unklarem Zusammenhang.»—«Der Prinz Areobindos soll erkrankt und deshalb durch Narses ersetzt sein.»—«Aber ich besorge: an dieser Krankheit sterben eher andre Leute als der Statthalter über die Schnecken.»
«Und meine vierzehn Boten an das zweite Heer?» forschte Cethegus, die Stirn furchend.
«Ich glaube», argwöhnte Licinius, «Narses hat sie festnehmen lassen, sowie sie eintrafen.»—«Die Germanenreiter lachten so höhnisch, als ich nach ihnen fragte», bestätigte Julianus. «Narses ist wirklich mit einem Heere, wie es noch niemals der Kaiser des Geizes gespendet hat, aus den Toren von Byzanz gezogen.»—«Und wahr ist alles, was du als unmöglich verworfen, o Feldherr.»—«Nicht nach Epidamnus ging Narses:—die dort stehenden und die übrigen Truppen des Areobindos, unbedeutend im Vergleich mit seinem kolossalen Heer, hat er zur See den jonischen Busen hinauf nach Pola in Istrien beordert. Er selbst zog auf dem Landweg, in Eilmärschen, in das gotische Dalmatien, rollte vor sich her, wie der Sturm die dürren Blätter, die wenigen Tausendschaften der Barbaren dort im Lande auf, nahm Salona, Scardona, Jardera.»—«Ja, und ein furchtbares System befolgt er dabei. Er läßt, wohin er kommt, nicht einen Goten: alle, auch Weiber und Kinder, läßt er greifen und zu Schiff sofort nach Byzanz in die Sklaverei führen. So geht er, wie eine zermalmende, eiserne Walze, dahin über das Gotenvolk, und wo Narses vorübergezogen, lebt kein Gote mehr in Stadt und Land.»
«Das ist gut», sagte Cethegus, «das ist groß.»
«Er hat geschworen bei dem Zepter Justinians, sagt man, nicht zu rasten, bis kein freier Gote mehr im Orbis Romanus lebt. Und in der Schlacht macht er keine Gefangenen.»
«Das ist gut», sagte Cethegus.
«In Pola mit dem ‹zweiten Heer› vereinigt, brach er in das gotische Venetien ein und durchzog das Land mit breitester Stirn, mit dem rechten Flügel umschwenkend—der linke diente als Drehpunkt: von der See im Süden bis an die Berge im Norden: wie eine wandelnde Mauer von Erz alles vor sich niederwerfend oder aus dem flachen Lande in die Städte drängend, die, eine nach der andern, rasch fielen.
‹Denn die Belagerung versteht mein Narses wie kein andrer›, sprach Basiliskos, der diese kriegerischen Ereignisse ohne Rückhalt erzählte. ‹Sie sind bald auch dem Präfekten kein Geheimnis mehr›, lächelte er boshaft, ‹so wie meines Narses großer strategischer Gedanke.› Narses sprach: ‹Italien ist ein Stiefel: man muß von oben nach unten hineinfahren. Mein heftiger Kollege Belisar war so töricht, von unten, bei dem kleinen Zeh, hineinschlüpfen zu wollen. Drängt man», fuhr er fort, «die gotischen Flöhe von unten, vom Wasser her, nach oben, nach den Bergen, ins Trockne, so sterben sie nicht.
Umgekehrt, von den Bergen, vom Trocknen, von oben her, nach unten, in das Wasser, muß man sie allmählich treiben und schieben. Und zuletzt wirft man den Rest, wo das Land schmal zu Ende läuft, alle zusammen ins Wasser, daß sie elend ersaufen.› Denn die Flotte hat er ihnen ja schon genommen—gestohlen freilich mehr als geraubt!—der vortreflliche ‹Magister Militum per Italiam›, so schloß Basiliskos.»
«Man flüstert», schaltete Julianus ein, «diese Würde sei schon längst wieder aufgehoben.»
«Davon müßte doch ich, dieser Würde Träger, auch wissen.»
«Wer weiß: man raunt, du seist abgesetzt. Narses habe geheime Aufträge vom Kaiser—versiegelt—mitbekommen, die er erst nach Vernichtung des Königs Totila zu öffnen und zu vollziehen habe.»
«Wer sagte das?» frug Cethegus rasch. «Basiliskos selbst?»
«O nein: der spricht nur vom Krieg. Nein, der eine Sklave. Und gerade, da der Germanenführer dies vernommen, schlug er ihm mit seiner Keule den Schädel ein.»
«Das ist schade», sagte Cethegus nachsinnend, «das heißt, er schlug zu früh.»
«‹Es war›, fuhr Basiliskos fort uns zu erzählen, ‹ein herrlich Schauspiel, dieser alles umspannende, alles erdrückende Marsch. Den linken Flügel im Süden als feststehenden Angelpunkt an das Meer gelehnt, das die starke Flotte sperrte, schwenkte der rechte, der bis an die Alpenpässe im Norden reichte und sie durch starke Wachen schloß, von rechts nach links herab nach Süden ein. Wie der Vogelsteller sein Schlagnetz zusammenschlägt ob den ängstlich hüpfenden, flatternden Vögelein, und ist kein Entrinnen vor ihm.
Nur über Tridentum und Bolzanum hinaus nach Norden und gegen die Täler der Athesis und der Passara hinaus entrannen einige Tausende der Barbaren mit Weib und Kind. Und sie schlugen, verstärkt durch die Besatzung von Castrum Teriolis bei Mansio Majä, den verfolgenden Archonten Zeuxippos, daß er schleunigst zur Hauptmacht zurückkehrte.
Aber mit Ausnahme von diesen in die Berge entkommenen Haufen und von Verona lebt kein Gote mehr hinter Narses' Rücken, soweit er bis jetzt gedrungen: Aquileja, Concordia, Forum Julii, Ceneta, Tridentum, Tarvisium, Comaclum fielen vor Narses.
Er eilte nach Ravenna. Schleunigst entwichen die gotischen Belagerer, nach Westen ausbeugend, vor der ungeheuren Übermacht solchen Entsatzheeres. In Ravenna versöhnte er sich mit dem blutigen Johannes...›—»
«Das glaub' ich nicht», unterbrach Cethegus. «Johannes ist der eifrigste Anhänger Belisars. Er haßt Narses mehr als Belisar selbst diesen anfeindet.»
«Ja, so zweifelten auch wir: ‹und doch hat ihn Narses gewonnen›, lächelte Basiliskos: ‹ihr werdet noch mehr Dinge erleben, ihr römischen Ritter und Kriegstribunen, von Narses, die ihr jetzt nicht ahnt.›
Und richtig ist, daß Johannes unter Narses dient, wie früher unter Belisar: er befehligt seine Leibwache und die Hunnen.»
Cethegus schüttelte staunend den Kopf.
«‹Leider aber verunglückte›—so erzählte Basiliskos uns weiter», fuhr Piso fort—«‹bald nach dem Aufbruch aus Ravenna Martinus, der Geschützmeister.›»
«Was?» frug Cethegus staunend. «Auch Martinus, das Werkzeug, das Geschöpf, der Rechenmeister Belisars diente unter Narses?—Hier liegt, ihr habt recht, ein sehr großes Geheimnis.»—
«‹Nämlich hinter Ravenna›, berichtete uns Basiliskos, ‹stieß Narses auf den ersten starken Widerstand. Nicht durch Krieger, sondern durch Werke des Barbarenkönigs. Dieser hat, durch seinen Feldherrn Teja, ein höchst geschickt ersonnenes Verteidigungssystem herstellen lassen, das Italien gegen einen Angriff vom Norden her sichern sollte; in Ämilia ist es schon vollendet—zum Glück war es noch unfertig in Venetia: sonst wäre auch die Übermacht des Narses nicht so rasch vorgedrungen:—er hat durch Verhaue und Gräben alle wichtigsten Übergänge der Höhenzüge und Straßen so meisterhaft gedeckt, daß ganz geringe Kräfte den Marsch des größten Heeres tagelang hinter jedem solchem Hindernis aufzuhalten vermögen.
Mit Bewunderung erkannte Narses diese Anlagen. «Dieser Totila ist ein viel größter Feldherr als Antoninas Gemahl!» rief er. Er hatte auch durch die Ämilia mit breitester Stirn nach Süden ziehen wollen, alles gotische Leben erdrückend.
Er mußte aber seinen Plan, von Ravenna westlich in das Innere des Landes zu marschieren, aufgeben, nachdem bei einem Versuch, ein solches Bollwerk bei Imola auf geheimnisvolle Weise zu zerstören, Martinus ein geheimnisvolles Ende fand. Als Narses ratlos vor der Feste stand und aussprach, sein ganzer Plan könne an diesen Stockungen scheitern und—zum erstenmal auf dem Feldzug—vor Erregung von seiner bösen Krankheit «Epilepsis» niedergeworfen wurde, da sprach Martinus zu Johannes, der sich eine tüchtige Brustwunde bei seinem abgeschlagenen Sturm geholt hatte: «Der Rächer Belisars soll nicht durch diese Steine aufgehalten werden, wenn Martinus richtig gerechnet hat. Freilich», sagte er, «das letzte Experiment im kleinen mißlang und hätte mir fast den Kopf weggerissen, aber es gilt, Belisar zu rächen, und dafür wag' ich gern meinen Kopf.» Und in der Nacht schlich sich Martinus mit einigen Steinarbeitern an die Felswände hinan und bohrte an ihnen ein kleines Loch.
Aber plötzlich wurden wir alle aus unsern Zelten geschreckt durch einen furchtbaren Knall, desgleichen wir nie vernommen.
Wir eilten an die Felswand.
Diese war freilich auseinander gesprengt, als hätte sie der Blitz getroffen:—aber nicht von oben nach unten, von unten nach oben. Die gotische Besatzung auf den Wällen war zerrissen: aber auch schrecklich verstümmelt und ganz schwarz lagen unser armer Martinus—sein kluger Kopf zwölf Schritte von dem kleinen Körper—und alle seine Arbeiter.›»
«Rätselhaft!» sagte Cethegus. «Kennt man die Erfindung?»
«Nein, er hat sie mit ins Grab genommen. Er sagt ja: er war noch nicht ganz mit ihr fertig. In seinem Zelte fand man ein Häufchen kleiner Körnchen, wie schwarzes Salz, welches Narses eifrig ihm noch in der Nacht zu bringen befahl. Aber auf dem Wege fiel ein Funke von der Pechfackel des Trägers auf die offene Schale: und hell auflodernd puffte und flammte das Gift in die Höhe: doch diesmal ohne Knall und ohne Schaden.»
«Hätt' ich doch dieses schwarze Salz», seufzte Cethegus. «Dann wehe Narses und Byzanz.»
«Ja: ähnlich mag Narses gedacht haben», lächelte Piso. «Denn nach des Basiliskos Bericht durchsuchte und durchstöberte er alle Schalen und Schreibereien des Verunglückten. Aber ohne Erfolg.»
«‹Imola hatten wir nun zwar›, fuhr Basiliskos fort zu erzählen», so berichtete Salvius Julianus. «‹Aber schon ganz in der Nähe, bei Castrum Brintum, lag wieder eine solche Wegsperre. Und kein Martinus lebte mehr, sie zu sprengen. Ratlos hielt Narses inne.›
‹Johannes›, fragte er endlich, ‹du kennst genau den Küstenweg von Ravenna südöstlich bis Ancona?›—‹Ja›, erwiderte dieser, es war der Weg meiner schönsten Siege unter Belisar.—‹Und dort werden die Wegsperren fehlen›, frohlockte Narses, ‹weil der Barbarenkönig die zahlreichen natürlichen Wegsperren, die Flüsse, die von Westen her in den Meerbusen münden, durch seine Flotte zu beherrschen glaubte. Die Flotte hat uns der Präfekt von Rom freundschaftlich aus dem Wege geräumt. Wendet! Brecht das Lager ab; wir ziehen hart an der Küste nach Südosten.›—‹Wie willst du über die brückenlosen Flüsse setzen?› fragte Basiliskos staunend. ‹Die Brücken, Freund, tragen wir auf den Schultern mit uns.›»
«Darauf bin ich gespannt», unterbrach Cethegus.
«‹Und so zogen wir denn zuerst ostwärts›, schloß Basiliskos seinen Bericht, ‹an die Küste und von hier aus ganz hart an der See nach Süden, geführt von Johannes. Die Flotte aber segelte dicht an der Küste, mit dem Landheer gleichen Schritt haltend, und wo ein Fluß das Landheer zu hemmen drohte, sandte die Flotte zahllose kleine Boote stromaufwärts, und auf diesen setzten die Truppen über. Und wenn zwei Flüsse durch nur kurze Strecken Landes getrennt waren, trugen Roß und Mann die leichten Fahrzeuge auf Rücken und Schultern von Fluß zu Fluß.
So zogen wir denn über den Sapis nach dem alten Ficocle, über die drei Arme des cäsarischen Rubico, über einen mir unbekannten Fluß und über den Ariminus nach Ariminum, wo Usdrila, der Goten tapfrer Führer, im Ausfall umkam.
Aber auf der flaminischen Straße vorzudringen war unmöglich. Diese sperrte das feste Petra pertusa; so wandten wir uns denn nach Südwesten und zogen über den Metaurus gegen den Apennin, zu Hilfe dem Präfekten von Rom und Statthalter von Italien, das aber andere Leute haben, dem großen Magister militum per Italiam, der aber nur ein kleines Heer hat, auf daß nicht König Totila und Graf Teja von Tarentum ihn samt euch, ihr edeln römischen Ritter, erdrücken wie die Mühlsteine das Korn.›»
«Daß aber deine Boten festgehalten wurden zu Epidamnus...—» fuhr Piso fort.
«Allerdings, es kam keiner zurück, auch die nicht, denen ich schleunige Umkehr befohlen», sprach Cethegus nachsinnend.
«Das schließe ich daraus, daß auch uns der schlaue Byzantiner, unter höflichsten Formen, das gleiche tun wollte. Er wollte uns durchaus zu Narses, weiter von dir fort, geleiten lassen. Vor unsre Zelte setzte er uns Germanen als ‹Ehrenwachen›, und als wir, die Absicht erkennend, zur Nacht aus unsern Zelten eilten und aus dem Lager, da schossen unsre Ehrenwachen uns, zum Ehrenabschied, noch ihre Pfeile nach, töteten zwei unsrer Sklaven und verwundeten mein Pferd.»
«Ich sollte also durchaus überrascht werden von dem großen Epileptiker:—ferngehalten werden von ihm bis zum letzten möglichen Augenblick.—Gut. Syphax, mein Pferd: Wir reiten noch heut' nacht Narses entgegen.»
«O Herr», flüsterte leise der Maure, der die Unterredung mit angehört, «hättest du mich, wie ich dich bat, nach Epidamnus geschickt!»
«Dann hätten sie auch dich eingesperrt, wie die andern Boten.»
«Herr, in Afrika haben wir ein gutes, altes Sprichwort: wenn das Feuer aus dem Berge nicht zu dir kommt, sei froh: und gehe nicht der Lava entgegen.»
«Das könnte man ins Christliche übertragen», lächelte Piso: «wenn der Teufel dich nicht holen soll, such' ihn nicht auf. Wer reitet von selber in die Hölle?»
«Ich! Und zwar schon seit ziemlich langer Zeit», sprach Cethegus, «lebt wohl, ihr römischen Kriegstribunen. Licinius vertritt mich hier im Lager bis zu meiner Rückkehr. Auch der Barbarenkönig weiß jetzt wohl schon von Narses' Nähe und Macht. Er greift in der Nacht heute nicht an, wie damals in Rom.»
Als die römischen Ritter das Zelt verlassen, sprach Cethegus zu Syphax: «Schnalle mir den Harnisch ab.»
«Wie, Herr? Du reitest nicht in Belisars, in Narses' Lager reitest du.»
«Ebendeshalb! Fort mit dem äußern Brustharnisch. Reiche mir das Schuppenhemd, das ich unter der Tunica trage.»
Syphax seufzte tief auf. «Jetzt wird es Ernst. Jetzt, Hiempsals Sohn, sei wachsam!»
Die Nacht über ritt Cethegus mit geringer Begleitung, in tiefes Sinnen versunken, Narses entgegen. Auf der Tribunen Mahnung, das Gefolge zu vermehren, hatte er erwidert: «Hunderttausend kann ich doch nicht mitnehmen!»
Bei grauendem Morgen stieß er bei Fossa nova auf den Vortrab des anrückenden Heeres. Es waren wild aussehende Reiter, von deren spitz zulaufenden Helmen schwarze Roßschweife auf die Wolfsfelle über ihren Rücken flatterten: sie führten Ringpanzer, breite Schlachtschwerter und lange Lanzen: Arme und Beine nackt, nur an dem linken Fuß, an Riemen befestigt, einen Sporn: ohne Sattel saßen sie sehr sicher auf ihren starken Pferden.
Der Führer der Reiter—er trug einen reich vergoldeten Plattenpanzer und statt des Roßschweifs zwei Geierflügel auf dem Helm—jagte pfeilschnell auf seinem roten Roß heran und hielt erst dicht vor Cethegus, der an seines kleinen Zuges Spitze ritt: lange, rote Haare, auf der Stirn gescheitelt, flogen um seine Wangen, und der Schnurrbart hing, in zwei schmalen Streifen, von dem Munde auf die Brünne: aus dem hellgrauen Auge blitzte Kühnheit und Verschlagenheit.
Eine Weile maßen sich die beiden Reiter mit forschenden Blicken. Endlich rief der mit dem Geier-Helm: «Das muß Cethegus sein!—der Beschirmer Italiens.»
«Der bin ich.»
Und der andere riß sein Pferd herum und jagte davon, noch schneller als er gekommen, über die Stellung seiner Reiter hinaus auf ein Waldstück zu, aus dessen Rändern man nun Fußvolk in dichten Reihen heranrücken sah.
«Und wer seid ihr? und wer ist euer Führer?» fragte Cethegus in gotischer Sprache die Reiter, welche er nun erreichte.
«Wir sind Langobarden, Cethegus, in Narses' Dienst», antwortete auf Lateinisch der Gefragte, «und jener dort ist Alboin, unseres Königs Sohn.»
«Also darum, Licinius, hast du deine Mühe verloren!»
Schon sah Cethegus von ferne des Narses offne Sänfte herannahen. Sie war vom einfachsten Holz, ohne Zierat: nur eine Wolldecke, statt der üblichen Purpurpolster, lag darin. Nicht von Sklaven, von erlesenen Soldaten, denen diese Ehre abwechselnd zur Belohnung eingeräumt wurde, ließ sich der Krüppel tragen.
An seiner Seite ritt mit gezogenem Schwerte Alboin und flüsterte ihm zu: «Also du willst wirklich nicht, Narses? Der Mann scheint mir gefährlich, sehr. Du brauchst nicht zu sprechen—ein Zucken deiner Wimper und es ist geschehen.»
«Laß ab zu drängen, du Zukunft der Langobarden.
Ich könnte sonst glauben: du willst den Mann nicht mir, sondern dir selber aus dem Wege räumen.»
«Wir Söhne der Cambara haben ein Sprichwort: Erschlagner Feind hat noch selten gereut.»
«Und wir Romäer haben ein anderes», sagte Narses: «Wirf die Leiter erst um, wann erstiegen der Wall.
Erst, mein eifriger, junger Freund, laß uns Totila durch Cethegus vernichten. Der kennt Rom, Italien und die Goten doch noch besser als Alboin, der Roßhändler. Was diesen Exmagister militum per Italiam selber anlangt, so ist sein Geschick besiegelt...—»
Alboin sah ihn fragend an.
«Aber auch noch versiegelt. Zur rechten Stunde werd' ich es ihm eröffnen und vollenden.»
Gleich darauf hielt Cethegus neben der Sänfte. «Willkommen, Narses», sprach er: «Italien begrüßt den größten Feldherrn des Jahrhunderts als seinen Befreier.»
«Laß das gut sein. Mein Kommen hat dich wohl überrascht?»
«Wer einen Areobindos als Helfer erwartet und einen Narses statt dessen findet, kann nur erfreut sein. Aber, allerdings», fügte er lauernd bei, «da Belisarius begnadigt ist, hätte auch er, seinem Wunsche gemäß, nach Italien gesendet werden können.»
«Belisar ist nicht begnadigt», sagte Narses kurz.
«Und meine Gönnerin, die Kaiserin...—wie starb sie so plötzlich?»
«Das weiß genau nur sie selber.
Und jetzt vermutlich die Hölle.»
«Hier liegt ein Geheimnis», sagte Cethegus.
«Ja:—doch lassen wir's liegen.
Kein Geheimnis aber mehr ist dir, daß jetzt Narses in Italien steht. Bekannt ist dir wohl von früher, daß Narses niemals geteilten Heerbefehl führt. Der Kaiser hat dich mir unterstellt mit dem ‹ersten Heer›. Willst du unter mir in meinem Lager dienen, so soll mich's freuen: denn du verstehst den Krieg, Italien und die Goten. Willst du nicht, so entlasse deine Söldner:—ich brauche sie nicht. Ich befehlige einhundertzwanzigtausend Mann.»
«Du trittst mit großen Mitteln auf»
«Ja: denn ich habe große Zwecke. Und nicht kleine Feinde.»
«Du bist den Goten stark überlegen—wenn sie nicht auch ihr Südheer aus Regium hierher ziehen.»
«Das können sie nicht. Denn ich habe auch vor dem Hafen von Rom und auf der Höhe von Regium zwei Geschwader mit zwanzigtausend kreuzen lassen, die das gotische Südheer vollauf beschäftigen.»
Cethegus staunte. Das war wieder eine Überraschung.
«Du aber wähle», sprach Narses, «bist du mein Gast oder mein Unterfeldherr? Ein Drittes gibt es nicht in meinem Lager.»
Cethegus übersah klar die Lage. Er war Unterfeldherr oder—Gefangener. «Es ehrt mich, unter dir zu dienen, nie besiegter Perser-Überwinder.»—«Warte nur», dachte er: «auch Belisar trat auf als mein Herr, zu Rom ward ich der seinige.»
«Wohlan», befahl Narses, dessen Sänfte während der Unterredung auf die hohen, stelzengleichen Tragestangen war niedergestellt worden: «so ziehen wir gemeinsam gegen die Barbaren. Tragt euren Vater wieder, liebe Kinder.»
Und die Krieger traten wieder an die Sänfte.
Cethegus wollte bei dem Aufbruch sein Pferd an die rechte Seite des Feldherrn lenken. Aber in sehr gutem Latein rief ihm Alboin zu:
«Nichts da, Herr Römer. Mich nennt man die rechte Hand des Narses. Der Ehrenplatz ist mein:—die linke, die Unheilseite, ist noch frei. Wir haben sie für dich aufgehoben.»
Schweigend ritt Cethegus auf die linke Seite.
«Ich weiß nicht», sagte er zu sich selbst, «ob diese rechte Hand vor ihrem Haupte oder nach ihm fallen muß! Am besten zugleich.»
Am Abend dieses Tages noch erreichte das Heer des Narses die Stellungen zwischen den Bergen von Helvillum und von Taginä.
Und gewaltig wahrlich war dieses Heer des Narses.
Der zähe, geizige Sparer Justinian hatte diesmal nicht gespart: mit vollen Händen hatte er gespendet. Seine aus Kleinlichem und Großartigem seltsam gemischte Natur schien für dies Unternehmen das Kleinliche völlig abgestreift zu haben. Die großen Erschütterungen in der Hauptstadt, an seinem Hofe, hatten ihn wachgerüttelt. Klar hatte sein heller, diplomatischer Kopf, viel mehr für die äußere Politik als für die Verwaltung angelegt, die ganze Bedeutung der gotischen Gefahr erkannt. Der Vorwurf, daß er durch unnötige Angriffe diese brennende Gefahr erst heraufbeschworen, machte ihm die Unterdrückung zur Pflicht.
«Er haßte den Namen der Goten und gelobte, sie auszutilgen aus dem Reich», schrieb damals Prokop.
In schonungslosen herben Worten hatte ihm Narses diese Pflicht eingeschärft, und zugleich die klügsten Ratschläge zu ihrer Erfüllung beigefügt. «Nur Germanen schlagen diese Germanen», hatte er gerufen. «Ich brauche zu den Söldnern aus Asien die germanische Waldeskraft, die Goten zu brechen. Lange hab' ich gewarnt, diese friedlichen Männer aufzustören, die uns nicht bedrohten: die Perser, die wahrhaft gefährlichen abzuwehren. Du hast nicht gehört. Jetzt, da sie zum Angriff übergegangen, jetzt sind sie die gefährlichsten:—gefährlicher als die Perser, mit welchen sie übrigens schon im Bunde stehen. Jetzt müssen sie vernichtet werden um jeden Preis, denn sie haben die Schwäche deines Reiches entdeckt. Jetzt also: Germanenkraft herbei, Germanenkraft zu brechen. Ich habe ein tapfres Volk an der Hand mit einem Königssohn, heißhungrig der Eroberung.»
«Wer ist's?»
«Das ist mein Geheimnis. Wildkühne Scharen aus ihnen werb' ich selbst als meine Leibwächter. Aber das reicht nicht. Franken, Heruler, Gepiden müssen helfen. Den Franken bestätigst du, was du ihnen doch nicht entreißen kannst: ihre neuen Erwerbungen in Südgallien, Massilia und Arelate.»
«Ich gebe ihnen dazu das Recht, Geldmünzen mit dem Bilde ihrer Könige zu schlagen, das schmeichelt ihrer kindischen Eitelkeit: der Fürsten und des Volks. König Theudebert zu Mettis, den, wie Childebert von Paris, dieser Totila gewonnen, ist gestorben: sein junger Erbe Theudebald bedarf unserer Gnade.»
«Den Herulern, diesen immer hungrigen Soldläufern, gib ein Stück Dacien bei Singidunum:—haufenweise schicken sie dir dafür ihre bösen Buben zu. Mit den Gepiden, so viele ihrer die Langobarden noch übriggelassen, schließe Frieden. Gib ihnen Sirmium zurück, dann helfen sie dir schon aus altem Haß gegen die Landsleute von Theoderich und Witichis.»
«So viele Zugeständnisse...—»
«Wir nehmen ihnen ja bald alles wieder ab, unsern Hunden, mit denen wir den gotischen Löwen jagen: aber erst muß er nieder mit ihrer Hilfe.»
Und er hatte den Beherrscher der Romäer vollständig gewonnen und überzeugt.
Alle Mittel des kaiserlichen Thesaurus, den der kaiserliche Geizhals immer, jammernd, als völlig leer hingestellt hatte, wurden verschwenderisch an Narses gespendet. Und dieser nicht bescheidne Heischer staunte nun selbst über die Fülle der bisher sorgfältig geheimgehaltnen Schätze.
Der große Krieg mit Persien, der kleine mit allen Nachbarvölkern wurde sofort, mit Opfern, beendet. Die erprobten Veteranen, die seit Jahrzehnten unter Belisar und Narses in Asien und Europa gedient, wurden so verfügbar gegen die Goten.
Und die nämlichen Feinde, die sie bis dahin bekämpft: Perser, Sarazenen, Mauren, Hunnen, Sclavenen, Gepiden, Heruler, Franken, Bulgaren, Awaren, stellten plötzlich Söldner gegen hohe Jahrgelder.
Aus Thrakien und Illyrien wurden alle Waffenfähigen ausgehoben: dreitausend herulische Reiter unter Vulkaris und Wilmuth, siebentausend Perser, eine Gefolgschaft erlesenster Gepiden—hundertundfünfzig wilde Abenteurer unter Asbad,—wurden geworben, zehntausend Mann Fußvolk aus allen Provinzen des fränkischen Reichs, Franken, Burgunden, Alamannen, stellten die Merowinger von Parissi, Mettis und Aurelianum.
Ferner konnte Narses, außer seinen eignen vorzüglich von ihm geschulten Unterfeldherren, diesmal auch die besten Heerführer Belisars verwenden, die früher nie unter Narses gedient: die rätselhafte Aussöhnung der beiden großen Nebenbuhler und der an allen Grenzen gesicherte Friede machte die Vereinigung wie der besten Truppen so der erfahrensten Führer in Italien möglich.
So befehligten unter Narses die beiden ausgezeichneten und innig befreundeten Archonten Orestes und Liberius, die man in Byzanz wegen dieser zärtlichen Freundschaft Orestes und Pylades zu nennen pflegte, ihr eifriges Zusammenwirken in allen Aufgaben machte die Freundschaft auch militärisch wichtig:—aber freilich, in der Schlacht von Taginä sollte sich diese Liebe einmal als übelwirkend erweisen.
Ferner Cabades, des vorletzten gleichnamigen Perserkönigs Neffe, der längst mit vielen Persern sich dem Kaiser unterworfen, Johannes, Basiliskos, Valerianus, Vitalianus, Justinus, Paulus, Dagisthäos, Anzalas der Armenier:—lauter hervorragende Führer. Das vor Portus kreuzende, Rom beobachtende Geschwader und Heer führte Armatus, das zwischen Sizilien und Neapolis wachende Dorotheos.
So waren es hunderttausend Mann, die unter Narses und Cethegus bei Caprä den Goten gegenüberstanden, während Rom und Neapolis durch weitere zwanzigtausend bedroht wurden.
Diesen Zahlen aber hatte König Totila entfernt nicht mehr die Streitkräfte entgegenzustellen, die dereinst Witichis, im ganzen hundertundsechzig Tausendschaften, aufgebracht.
Die Lücken, die der Krieg, die großen allein siebzig Tausendschaften betragenden Verluste vor Rom, dann die Seuchen, der Hunger, die Gefangennehmungen zu Ravenna und zu Senogallia in das gotische Volksheer gerissen hatten, waren nicht wieder ersetzt worden durch die italischen Colonen, die Totila nur dann einreihte, wenn sie es forderten.
So betrug die ganze Macht des Königs etwa siebzig Tausendschaften, von welchen zehn unterhalb Roms zur Abwehr der beiden drohenden Landungen belassen werden mußten unter Herzog Guntharis und Graf Grippa: ungefähr zehn andre Tausendschaften aber wurden durch die—verlornen—Besatzungen in Griechenland und auf den Inseln sowie in den Städten und Burgen Italiens und Dalmatiens abgezogen, die zum Teil schon in des Narses Hand gefallen, getötet oder außer Land geschafft waren.
Es waren also nicht mehr als etwa fünfzig Tausendschaften, die König Totila der doppelt starken Macht der Feinde bei Taginä entgegenführte.
Als Cethegus dies Zahlenverhältnis dem Oberfeldherrn verrechnete, sagte dieser: «Mein großer Freund Belisar hat oft mit der Minderzahl gesiegt, ist aber noch öfter von der Mehrzahl—wie billig—geschlagen worden. Ich, Narses, habe meinen Ruhm nur darin gesucht, jedesmal zu siegen, obzwar nicht mit der Minderzahl. Und diesen bescheidneren, aber zweckmäßigeren Ruhm hab' ich erreicht. Er wird mir auch diesmal nicht entgehn.»
Auch in dem Lager der Goten erkannte man die Überlegenheit der Byzantiner: es fehlte nicht an Stimmen in des Königs Kriegsrat, welche die offne Feldschlacht zu vermeiden und den Rückzug in die noch von den Goten besetzten Städte, ein Hinschleppen des Kampfes durch zähe Verteidigung rieten. Aber der König verwarf diesen Rat aus guten Gründen und beschloß, bei Taginä zu schlagen.
Mit banger Ahnung hatte Valeria allmählich erraten, daß die Entscheidung gerade hier fallen werde, in dem Tal ihrer Sorgen und Schmerzen.
Der König hatte auch den übrigen, das Volksheer begleitenden Frauen, darunter den Neuvermählten Gotho und Liuta, das Kloster und die Kapelle auf den beiden Hügeln im Rücken des Heeres bei «spes bonorum» als den angemessensten und sichersten Aufenthalt angewiesen:—selbst im Fall des Sieges der Feinde gewährten diese katholischen Kultstätten gegenüber den katholischen Überwindern noch am ehesten Schutz.
Das Lager des Königs und die durch dasselbe gedeckten Gebiete wurden aber täglich mehr angefüllt von Angehörigen des Gotenvolks jedes Alters und Geschlechts, die aus den von Narses bedrohten oder durchzogenen Gegenden nach Süden flüchteten: denn das furchtbare System der Ausrottung alles gotischen Lebens, das der Gewaltige verfolgte, war alsbald schrecklich bekannt geworden und jagte die entsetzten Goten in banger Verzweiflung auf, bevor auch über sie hin der eherne Wagen der Austilgung rollte.
Sie erkannten, daß ein Vernichtungskrieg gegen ihr gesamtes Volkstum, nicht nur ein politischer Streit hier geführt werde. Nicht nur die gotischen Krieger, alle Tropfen gotischen Blutes waren die von Narses bedrohten Feinde.
Dazu kam, daß nun auch die Italier diese Natur und Absicht des jetzt erneuten Kampfes erkannten: und nun brach auch in ihnen der alte Barbarenhaß, der Gegensatz des Blutes und des Glaubens, wieder aus: die Versöhnung nach der Kriegsnot und durch die Milde des Friedenskönigs war erzwungen und künstlich—die Ausnahme—gewesen: nun kehrte das Natürliche, die Regel, der Haß wieder. Überall, wo sie sich durch die «Romäer» gesichert glaubten, zeigten diesen die Italier die Wohnstätten oder Verstecke der gotischen Familien an oder lieferten sie gleich selbst in die Gefangenschaft.
So also war es nicht mehr möglich, wie in dem belisarischen Feldzug, daß die Goten-Siedlungen sich vor der vorüberbrausenden Woge des Krieges duckend verbargen, und, nachdem sie weitergestürmt, wieder emporrichteten, wie Halme nach dem Gewitterwind:—nein, so weit Narses kam, kam der Gotenuntergang, und war er weitergezogen, war hinter ihm ausgetilgt das Gotentum.
Daher wurde denn, was noch flüchten konnte, was entronnen war vor der wandelnden Mauer der Vernichtung, von Norden nach Süden in des Königs Lager gedrängt: es nahm der Krieg den Charakter der alten Kämpfe eines Wandervolkes an, dessen Geschick an Schlacht und Lager gebunden war: die Wagenburg der ineinandergeschobenen Karren, welche die Zelte trugen, die einzige Heimat: es war nicht mehr die Verteidigung eines vom Feinde bedrohten Landes und der friedlichen Einwohner durch ein Heer: denn außer dem Lager des Königs und dem von diesem gedeckten Lande gab es fast keine Goten mehr in Italien. Totila ließ, schon um der Hungergefahr zu steuern, welche die Anhäufung solcher Massen Volkes in und hinter dem Lager herbeiführen mußte, die unwehrhafte Menge weiter nach dem Süden führen und verteilen.
Als den König auf einem Erkundungsritt über die Höhen dicht an der «Spes bonorum» vorüber der junge Herzog Adalgoth jenes Abends erinnerte, da sie zuerst die Kapelle besuchten, lächelte jener: «Jawohl—da ich mir die Grabesstätte wählte bei Numa Pompilius. Nun gut: falle ich hier, habt ihr mich nicht weit zu tragen.»
Aber im Grunde seines Herzens war der König nicht ohne Sorge über den Ausgang der hier sich langsam vorbereitenden Schlacht.
Ihn beunruhigte der Mangel an Reiterei: der größere Teil seiner Berittenen stand bei den Truppen von Guntharis und Grippa. Den tapfern Langobarden auf ihren starken Gäulen im Lager des Narses hatte der König keine an Zahl entsprechende Waffe entgegenzustellen.
Aber gerade diesem Mangel schien das alte Glück des Königs abhelfen zu wollen.
In den Gotenzelten gingen schon seit mehreren Tagen dunkle Gerüchte von der Annäherung neuer Hilfsscharen von Osten her, die zugewanderte Goten meldeten.
Der König wußte von keinem Zuzug aus jener Richtung und sandte deshalb vorsichtig, einem etwaigen Flankenangriff der Byzantiner zu begegnen, Graf Thorismut, Wisand, den Bandalarius, und den jungen Adalgoth mit einigen berittenen Sajonen auf Kundschaft aus.
Aber am Tage darauf schon kamen diese zurück, und Graf Thorismut sprach frohen Angesichts, da er mit Adalgoth in das Zelt des Königs trat: «Ich bringe dir, o König, einen alten Freund zur rechten Stunde.»—«Er gleicht ganz dem Königstiger», fiel Adalgoth ein, «den du in den letzten Zirkusspielen dem Volke zu Rom gezeigt. Nie sah ich solche Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier.»—«Er wird dir hochwillkommen sein—da ist er schon.»
Und vor dem König stand—Furius Ahalla, der Korse.
Er neigte das stolze, noch tiefer gebräunte Antlitz und legte die linke Hand auf die Brust «Ich grüße dich, König der Goten.»
«Willkommen, Weltumsegler, in Italien. Woher kommst du?»—«Von Tyrus.»—«Und was führt dich zurück?»—«Das, o König, kann ich nur dir vertraun.»
Auf einen Wink Totilas verließen die andern das Zelt: da faßte der Korse in fiebernder Erregung seine beiden Hände. «O sage ja, sage ja: mein Leben,—mehr als mein Leben hängt daran!»
«Was meinst du?» fragte der König, mit unwilligen Staunen zurücktretend. Die heiße, wilde, hastige Art des Mannes war seiner Natur sehr entgegen.
«Sage ja: du bist mit des Westgotenkönigs Agila Tochter verlobt?—Valeria ist frei?»
Der König furchte die Stirn und schüttelte zürnend das Haupt. Aber ehe er sprechen konnte, fuhr der Korse in heftiger Erregung fort: «Staune nicht—frage nicht! Ja: ich liebe Valeria mit aller Glut, fast hass' ich sie:—so lieb' ich sie. Ich warb um sie vor Jahren. Ich erfuhr, sie sei dein:—vor dir trat ich zurück:—erwürgt hätt' ich jeden andern mit diesen Händen. Ich eilte fort, ich stürzte mich in Indien, in Ägypten in neue Gefahren, Abenteuer, Schrecknisse, Genüsse. Umsonst. Ihr Bild blieb unvermischt in meiner Seele. Höllenqualen der Entbehrung erlitt ich um sie. Ich dürstete nach ihr wie der Panther nach Blut. Und ich verfluchte sie, dich und mich. Und ich wähnte, längst sei sie dein geworden.
Da traf ich im Hafen von Alexandria auf westgotische Schiffe aus Spanien, und die Männer, alte Handelsfreunde von Valerius und mir, erzählten von deiner Erhebung zum König: und als ich nach Valeria, deiner Königin, forschte, beteuerten sie, du seist unvermählt, und sie fügten bei, ihr König Agila habe dir seine Tochter und ein Waffenbündnis angetragen gegen Byzanz: du habest das angenommen. Aber vor allem, wiederholten sie—ja, sie beschworen es, da ich zweifelnd in sie drang—du seiest unvermählt, und deine frühere Braut Valeria, die ihnen sehr wohl bekannt, lebe einsam zu Taginä.
‹Valeria frei!› jauchzte alles in mir auf. Noch dieselbe Nacht lichtete ich die Anker meiner Schiffe, nach Italien zu eilen. Auf der Höhe vor Kreta stieß ich auf ein stattliches Geschwader. Es waren persische Reiter, die Justinian geworben und auf Kauffahrteischiffen nach Italien gegen dich senden wollte unter ihrem Häuptling Isdigerdes, meinen alten Bekannten. Von ihnen erfuhr ich, mit welch' gewaltiger Macht Narses dich bedrohe.
Und nun, König Totila, beschloß ich, die alte Dankesschuld zu zahlen.
Es gelang mir, indem ich das Doppelte bot, Isdigerd und seine Reiter—es sind ganz auserlesene Scharen,—in meinen Sold zu gewinnen, und ich führe sie dir zu: wie ich von deinen Grafen höre, zu höchst erwünschter Verstärkung. Es sind mehr als zweitausend Pferde.»
«Sie sind sehr willkommen», sprach Totila erfreut, «ich danke dir.»
«Daß du noch unvermählt, ward mir bestätigt», fuhrt der Korse fort—«aber—sie sagen—Valeria sei nicht frei—sie sei noch immer—: ich wollt' es, konnt' es, kann es nicht glauben—kann nicht die Hoffnung—nein, nein, schüttle nicht das Haupt.—Ich beschwöre dich: sage ja, sie ist frei.»—Und wieder griff er nach des Königs Händen.
Aber dieser machte sich los, nicht ohne Zeichen des Zornes. «Noch immer die alte, verderbliche, unbändige Glut! Wann erkaltet die Lava? Noch immer—ja, der Sänger hat recht:—die unheimliche Art des Tigers—man kann jeden Augenblick den Sprung im Nacken spüren.»
«Predige nicht, Gote», zürnte der Korse, «sage ja oder nein—ist Valeria...—?»
«Mein ist Valeria», rief heftig der König, «mein jetzt und ewig.»
Da stieß der Korse einen Schrei des Schmerzes, des Ingrimms aus und schlug sich beide Fäuste mörderisch an die Stirn. Dann warf er sich auf das Feldbett des Zeltes, schüttelte den Kopf auf den Kissen hin und her und stieß ein dumpfes Stöhnen aus.
Eine Weile sah ihm Totila mit schweigendem Staunen zu: endlich trat er zu ihm und hielt seine Rechte fest, die seine Brust zerhämmerte. «Fasse dich doch! Bist du ein Mann oder ein pfeilwunder Eber? Ist das manneswürdig, menschenwürdig? Ich dächte: du hast es mit Schmerzen gelernt, wohin sie führt, deine sinnlose Wut.»
Laut schreiend fuhr Ahalla auf, die Hand am Dolch.
«Ah, du bist es, der so sprach—der mich mahnt. Du allein darfst es: du allein kannst es! Aber ich sage dir:—tu's doch nicht wieder. Ich kann es auch von dir nicht tragen. Oh, du solltest nicht schelten, beklagen solltest du mich.
Was wißt ihr Nordlandherzen von der Glut in diesen Adern! Was ihr lieben nennt, ist mattes Sterngeflimmer. Mein Lieben ist brennendes Feuer—ja Lava, du hast recht:—wie mein Haß. Wüßtest du, wie ich um sie gelitten, wie ich aufgeglüht in Hoffnung, wie ich dich segnete und liebte und nun—alles dahin.» Und abermals begann er zu toben.
«Ich fasse dich nicht», sprach Totila streng, im Zelte auf und nieder schreitend und den Tobenden sich selbst überlassend. «Du hast eine niedere Art, vom Weib zu denken.»
«Totila!».drohte der Korse.
«Ja, eine niedere, gemeine Art. Wie von einer Ware, einem Roß etwa, das der zweite haben kann, wenn es der erste nicht festhält. Hat ein Weib keine Seele, nicht Willen und Wahl?
Und wähnst du denn, wenn ich wirklich mit einer andern vermählt oder gestorben wäre, glaubst du denn, Valeria würde dann ohne weiteres dein? Wir sind doch sehr verschieden von Art, Korse. Und ein Weib, das Totila geliebt, wird schwerlich sich trösten mit Furius Ahalla.»
Wie vom Blitz getroffen fuhr der Korse empor.
«Gote, du bist ja sehr stolz. Solcher Hochmut war dir früher fremd. Hat dich der goldne Reif so hochfahrend gemacht? Du wagst es, auf mich herabzusehn? Das trage ich von keinem Mann:—auch nicht von dir. Nimm zurück, was du da gesagt.»
Aber Totila zuckte die Achseln. «Die Eifersucht, die blinde Wut verwirrt dich. Ich habe gesagt: wer mich liebt, wird nicht nach mir dich lieben. Und das ist so wahr, daß selbst deine Wildheit es einsehen muß. Denke dir Valeria, die streng verhaltene, marmorne, vestalische:—und deine maßlos ungezähmte Art. Valeria ist kein weiches Syrerkind wie jene Zoe.»
«Nenne den Namen nicht», stöhnte der Korse.
«Valeria scheut deine Wildheit:—sie hat mir selbst einmal gesagt Grauen flößest du ihr ein.»
Da sprang Furius hinzu und faßte des Königs beide Schultern mit den Händen. «Mensch—du hast ihr gesagt? Hast ihr jenes Unheil aufgedeckt? Du hast?—Dann sollst du nicht...—»
Aber Totila stieß ihn jetzt unsanft zurück. «Genug dieses unwürdigen Tobens. Nein, ich habe es ihr nicht gesagt—bis jetzt. Aber wohl hättest du's verdient. Noch immer, nach solcher Erfahrung»——
«Schweige davon», drohte der Korse.
«Ohne Gewalt über dich in Liebe, Haß und Zorn.
Du packst deinen Freund an wie ein Rasender, wie ein Raubtier. Wahrlich, kennte ich nicht den edlen Kern in dir, diese Wildheit hätte mich längst von dir abgewendet. Mäßige dich oder verlasse mich.» Und der König heftete seinen leuchtenden Blick streng, nicht ohne den Ausdruck überlegener Hoheit, auf den Korsen.
Diesen Blick ertrug der Leidenschaftliche nicht. Er bedeckte die Augen mit der Hand und sprach nach einer Pause mit gebrochener Stimme: «Verzeih mir, Totila. Es ist vorbei. Aber wiederhole nicht jenen Ton, diesen Blick. Er hatte mich in jener Schreckensnacht mehr gebändigt als dein Arm. Ich scheue und hasse ihn durcheinander. Zur Sühne, wenn ich dich verletzt, will ich morgen selbst deine Schlacht mit kämpfen, an deiner Seite, wie meine Reiter.»
«Sieh, das ist dein edler Kern, Furius», sprach der König, «daß du—trotz deiner Enttäuschung—dein Geschenk erfüllen willst. Ich danke dir nochmal. Deine Hilfe, deine Reiterschar macht mir die Durchführung eines trefflichen Schlachtplans möglich, auf den ich seufzend hatte verzichten müssen, aus Mangel an Rossen.»
«Deine Feldherren, die du zum Kriegsrat entboten», meldete ein Sajo, «harren vor dem Zelt.»——«Führe sie ein! Nein, Furius: du bleibst und hörst alles mit an—deine Aufgabe ist die wichtigste nach der meinen.»
«Ich bin stolz darauf und werde sie lösen, daß du zufrieden sein sollst mit dem ‹Raubtier›.»
Es versammelten sich nun um den König der alte Hildebrand, Graf Teja, Graf Wisand, Graf Thorismut, Graf Markja, Aligern und der junge Herzog von Apulien.
Totila wies auf die Wand des Zeltes: dort hing die von ihm selbst mit kundiger Hand gezeichnete Übersicht der Gegend von Taginä: die Grundlage bildete die römische Straßenkarte des Picenums, zumal der Via flamina: auf dieser hatte er die wichtigsten Örtlichkeiten eingetragen.
«Gern, meine Helden», hob er an, «würde ich, nach alter Goten Weise, einfach im Keil auf den Feind losstürmen und sein Herz zu durchstoßen suchen. Aber den größten Feldherrn des Jahrhunderts, an der Spitze eines doppelt starken Heeres, in einer selbst gewählten, vortrefflichen Stellung, schlagen wir nicht mit unsrer von Odin stammenden einfältigen Weisheit», lächelte er.
«Erzürne nicht den Siegesgott durch Spott am Tage vor der Schlacht», warnte der alte Hildebrand.
Aber Totila fuhr fort:
«Wohlan denn: laß sehen, ob der große Stratege, der Germanen durch Germanen schlagen will, nicht durch seine eignen Mittel zu verderben ist.
Die Entscheidung des Tages fällt hier, im Herzen der beiden Stellungen bei Taginä. Die beiden Flügel haben nur hinzuhalten.
Du, Hildebrand, übernimmst unsern linken, gegenüber Eugubium. Ich gebe dir zehn Tausendschaften, dort der Wald und das Flüßchen Sibola, das da in den größeren, den Clasius mündet, geben dir gute Deckung. Desgleichen dir, Teja»—er stand hart an seiner Schulter—«auf dem rechten Flügel, mit fünfzehn Tausendschaften, der Berg rechts hinter Caprä, der fast bis an den Klosterberg der Valerier und an das Grab des Numa stößt.»
«O laß mich, mein König, morgen hart in deiner Nähe, an deiner Schildseite, fechten. Ich hatte einen finstern Traum», fügte er leiser bei.
«Nein, mein Teja», erwiderte Totila, «nicht nach Träumen wollen wir unsern Schlachtplan ordnen. Ihr sollt beide zu fechten genug bekommen, sobald die Entscheidung hier, im Herzen, gefallen. Denn hier»—und er deutete mit dem Finger auf den Raum zwischen Caprä und Taginä—«ich sag' es nochmal: hier liegt die Entscheidung.
Deshalb habe ich die volle Hälfte unsres Heeres, fast fünfundzwanzig Tausendschaften, hier in das Mitteltreffen gestellt.
Im Herzen von Narses' Aufstellung stehen die Heruler und—seine beste Schar—die Langobarden. Er ändert das nicht mehr: denn früher wohl, als ich, der ‹Barbar›, hat der große Schlachtenmeister es erkannt, daß dieser Tag durch das Gefecht der Mitten entschieden wird.
Nun habt wohl acht.
Ich kenne die Langobarden, ihre Kampfgier, ihren Reiter-Ungestüm. Darauf bau' ich meinen Plan: wenn Narses uns durch Germanenkraft vernichten will, so soll er durch Germanenfehler erliegen.
Mit meinen wenigen gotischen Reitern schwärme ich von Caprä aus gegen die Langobarden, die vor Helvillum stehn, des Narses starkes Mittellager. Sie werden nicht säumen, sich mit ihrer Übermacht auf mich zu stürzen. Sofort, durch ihren Anprall scheinbar geworfen, jage ich in ordnungsloser Flucht zurück auf Caprä zum Nordtor herein.
Das Nordtor lass' ich zwar hinter uns schließen. Sonst schöpfen sie Verdacht. Aber nicht verteidigen.
Und schlecht kenne ich die Langobarden, wenn sie nicht, in übermütiger Verfolgungslust des Reiters, die lustige Hetze fortsetzen, weit voran dem langsam folgenden Fußvolk.
Ich weiß gewiß, sie reißen die Tore auf und jagen uns durch Caprä hindurch, noch zum Südtor hinaus, auf das freie Feld zwischen Caprä und Taginä:—hier.
Aber kurz vor Taginä wird die flaminische Straße zu beiden Seiten von zwei waldigen Hügeln überragt, dem Collis nucerius rechts, dem Collis clasius links:—seht ihr? da.
Auf diesen Hügelkronen, im dichten Wald versteckt, liegen unseres vortrefflichen Korsen treffliche Reiter im Hinterhalt, und sowie die Langobarden heran sind, zwischen den beiden Hügeln,—dann wend' ich mich aus der versteckten Flucht zu ernstem Angriff auf der flaminischen Straße selbst.
Das Heerhorn bläst zum Reiterstoß.
Auf dieses Zeichen brechen deine Reiter, Furius, zugleich von beiden Seiten auf die Langobarden, und—»
«Sie sind verloren!» jubelte Wisand, der Bandalarius.
«Aber das ist nur die erste Hälfte meines Planes», fuhr Totila fort. «Narses muß entweder seines Heeres Blüte verloren geben...»
«Das tut er nicht», sagte Teja ruhig.
«Oder mit seinem Fußvolk nachrücken. In den Häusern von Caprä aber halte ich unsere Bogenschützen, in denen von Taginä unsere Speerträger verborgen, und wenn des Narses Armenier zwischen den beiden Städten in den Reiterkampf eingreifen wollen, werden sie von hinten und von vorn zugleich von dem aus den Toren brechenden Fußvolk angegriffen: du, Wisand, befehligst in Caprä, du, Thorismut, in Taginä.»
«Ich möchte morgen kein Langobarde sein», meinte der Korse. «Lange Bärte und kurze Freuden werden sie haben», lachte Adalgoth. «Kein Mann von den Armeniern entkommt», sprach Markja.
«Ja:—wenn der Plan gelingt», schloß Teja.
«Ihr aber, Hildebrand und Teja, sowie ihr das Fußvolk des Narses aus Helvillum gegen Caprä vorbrechen seht, zieht euch mit euren der Mitte nächsten Scharen ebenfalls gegen Caprä:—nur soviel zur Verteidigung eurer Flügel erforderlich, laßt dort stehen—ihr helft uns so, das Mitteltreffen zermalmen. Dann wenden wir uns gegen die beiden Flügel, und leicht sind sie nach links und rechts hin auseinander gerissen: denn ohne Helvillum haben sie keinen Halt: ihre große Zahl selbst wird ihnen hinderlich in jenen Engen, wenn wir sie von Helvillum her in der Flanke fassen.»
Der alte Hildebrand schüttelte dem König die Rechte.
«Du bist Odins Liebling», flüsterte er ihm ins Ohr.
«Schlimm!» antwortete der König, ebenso leise, mit Lächeln. «Du weißt: zuletzt versagt der von Odin geschenkte Speer, und der Siegesgott nimmt seinen Liebling hinauf nach Walhall.—Nun lebt wohl, meine Helden!»
Nachdem die Feldherrn das Zelt verlassen, zögerte der Korse noch an der Türe. «Um eine Gunst noch hab' ich dich zu bitten, König. Wann morgen deine Schlacht geschlagen und gewonnen, geh' ich in See—auf Nimmerwiederkehr.
Laß mich zuvor noch Abschied von... von ihr nehmen, ein letztes Mal ihr Bild mir in die Seele prägen.»
Aber der König furchte die Stirn. «Wozu das? Es kann nur dich quälen und sie.»
«Mich beglückt es. Und du—bist du zu neidisch oder am Ende gar zu ängstlich, andern auch nur zu zeigen, was du besitzest? Bist du eifersüchtig, König der Goten?»
«Furius!» rief der König verletzt und im Innern erbittert über des Korsen ganzes Wesen. «Geh, suche sie auf: und überzeuge dich, wie fern du stehst ihrer Art.»
Fast zur gleichen Zeit, da der gotische Kriegsrat seine verhängnisvollen Beschlüsse faßte, ließ sich Narses, der wieder schwer an epileptischen Anfällen gelitten hatte in diesen Tagen, in seiner offenen Sänfte, umgeben von seinen Heerführern, von seinem Zeit in Helvillum aus auf einen Hügel tragen vor seinem Mitteltreffen, von wo das gesamte Gefilde, das heute Gualdo Tadino heißt, zu überschauen war.
«Hier», sagte er, mit seiner Krücke aus der Sänfte deutend, «hier, zwischen Caprä und Taginä fällt die Entscheidung. Hättest du doch Taginä—oder selbst nur Caprä—noch besetzt, Cethegus.»
«Der schwarze Teja kam mir um drei Stunden zuvor», sagte dieser grollend.
«Es gibt keine solche Verteidigungsstellung gegen Übermacht auf der ganzen flaminischen Straße mehr bis Rom», fuhr Narses fort. «Meisterhaft haben die Barbaren diese Stellung gewählt. Gewannen sie jene Hügel nicht, so ergoß sich unser Heer unaufhaltsam fort bis Rom.
Nun habt acht auf jedes meiner Worte,—das Sprechen wird mir nicht leicht:—Narses sagt nichts zweimal. Nun, Langobarde, was sinnest du?» Und er rührte mit der Krücke an Alboins Schulter, der wie verzückt in die Landschaft hinausgeblickt hatte.
«Ich?» sagte dieser, auffahrend aus seinen Träumen, «ich sinne, wie wunderbar reich und schön dies Land, welcher Segen ringsum! Es ist das Weinland unsrer Lieder.»
«Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines Nächsten Italien und allem, was sein ist», sagte Narses, mit der Krücke drohend. «Die Traube Italia, Fuchs Alboin, hängt sehr hoch.»
«Ja: solang du lebst, ist sie sauer», sprach der Langobarde.
«Einstweilen lebt er noch, der Gotenkönig, dessen Erbe du antreten willst», mahnte Narses. «Also, mein Plan.
Du, Orestes, nimmst mit Zeuxippos den linken Flügel bei den ‹Gräbern der Gallieri› (busta Gallorum), gegenüber dem hohen Waldberg mit den weißschimmernden Klostergebäuden.»
«Woher rührt der Name?» fragte Alboin.
«Hier schlug», antwortete Cethegus, «der Römerkonsul Decius, sich dem Tode weihend für das Vaterland, der Gallier ungeheure Übermacht. Der Boden ist heilig und von guter Vorbedeutung für Rom und», schloß er bitter, «gegen alle Arten von Barbaren.»
«Wann war das?» forschte Alboin weiter.
«Im Jahre vierhundertachtundfünfzig der Stadt.»
«Das ist lange her», meinte der Langobarde.
Narses aber fuhr fort: «Du, Johannes, übernimmst mit Valerianus und Dagisthäos den rechten Flügel bei Eugubium gegenüber dem Fluß Clasius und dem Flüßchen Sibola. Ihr haltet euch ganz ruhig, bis hier in der Mitte die Entscheidung gefallen: alsdann,—denn wer Übermacht hat und sie nicht zur Überflügelung braucht, verdient nicht, sie zu haben—dann schwenkt ihr von beiden Seiten ein—ihr reicht ja weit über die schmale Stirnlinie der Barbaren hinaus—und ihr schneidet ihnen mit zusammenschlagendem Netz den Rückzug nach Rom ab: euer Zusammentreffen ist auf der flaminischen Straße östlich hinter Taginä, in der Nähe von Nuceria Camellaria. Gelingt das, so ist der Krieg zu Ende mit einem Schlag.»
«Schade», meinte Alboin.
«Ja, dir blutet das Herz nicht, mein Wölflein, wenn du des Kaisers Italien recht lange zerfleischen kannst. Aber mir, nicht viele Schlachten gewinnen,—das ist Freund Belisars Vergnügen!—viele Feldzüge mit einem Schlag beenden, das ist meine Art, Erst aber, eh' ihr überflügeln könnt auf den Flanken, muß hier, in der Mitte, in der Ebene die Blutarbeit getan sein. Ich muß Caprä und Taginä stürmen; wenn sie klug sind, die Barbaren, zeigen sie sich nicht auf dem freien Feld vor Caprä: dort würden meine Wölfe sie niederrennen. Nicht wahr, mein Wolfskönig?»
«Ein prächtiger Wiesenplan für die Reiterschlacht!» rief Alboin, «ich sehe sie schon zurückfliehen nach den Toren von Caprä.»
«Sie werden dir den Gefallen nicht tun, sich hierher zu wagen, mein Wölflein. Keinesfalls aber unterstehst du dich, mit deinen Reitern Caprä anzugreifen.»
«Oh», meinte Alboin, «wir sind gewöhnt, abzuspringen und zu Fuß zu kämpfen, wenn's vonnöten. Die Rößlein bleiben lammfromm stehen und kommen auf den Pfiff im Trabe nach.»
Ein heftiger Krampf schüttelte Narses: seine Züge verzerrten sich. «Langbart», sprach er, als er wieder seiner mächtig geworden, «ärgere mich nicht. Ärger und Schreck bringen mir das böse Schütteln. Wenn du dir einfallen läßt, Caprä anzugreifen, ehe mein Fußvolk ganz heran ist, schicke ich dich nach der Schlacht nach Hause.»—
«Das wäre allerdings die härteste Strafe.»
«Du, Anzalas, führst das armenische Fußvolk und du, Cethegus, das illyrische, samt deinen trefflichen isaurischen Söldnern, zum Sturm auf Caprä und Taginä. Ich folge mit der Masse der Makedonen und der Epiroten nach.» Abermals rüttelte den Feldherrn ein Schauer.
«Ich fürchte, morgen kehrt das Übel stärker wieder.
Du, Liberius, vertrittst dann meine Stelle, bis ich wieder sprechen und befehlen kann.»
Cethegus furchte die Stirn.
«Ich hätte dir, Präfekt», fügte Narses, dies bemerkend, bei, «die Vertretung übertragen. Aber du wirst nicht müßig in Helvillum zusehn wollen. Ich brauche dich und dein gefürchtet Schwert beim blutig schweren Sturm auf die beiden Städte.»
«Und wenn ich dabei falle», lächelte Cethegus, «wird des Kaisers Feldherr den Verlust überleben.»
«Wir sind alle sterblich», sprach Narses, «o Präfekt: unsterblich sind nur wenige von uns—nach ihrem Tod.»
An dem Abend desselben Tages erging sich Valeria in dem ummauerten Garten des Klosters unter Thuien und Zypressen. Sie wußte oder ahnte, daß die lang erwartete Schlacht morgen bevorstand. Und ihr Herz war bang.
Sie bestieg ein Türmchen an der Ecke der Gartenmauer, zu welchem eine gewundene, schmale Marmortreppe emporführte. Von hier aus konnte sie das ganze Talgefilde überschauen, in welchem morgen die Entscheidung über Italiens, über ihr eignes Geschick fallen sollte.
Im Westen, ihr gegenüber gerade, weit hinter dem Clasiusflusse, versank die Sonne in blutroten Wolken.
Im Norden lag das langgestreckte, tiefe Lager des Narses mit seinen zahllosen Zelten aus dunklen Fellen und Häuten und geschwärztem grobem Segeltuch. Es zog sich unabsehbar weit, den Horizont umspannend, von busta Gallorum im Osten bis Eugubium (das alte Iguvium) im Westen: es ruhte schon in schwarzen, kalten Schatten: drohend und still, wie die Notwendigkeit.
Unmittelbar zu ihren Füßen schlossen sich die gotischen Zelte dicht hinter dem kleinen Ort Taginä. Die geringe Zahl erschreckte das Auge der Jungfrau: doch hatte ihr Totila beschwichtigend gesagt, seine Leute lägen größtenteils in den Häusern von Caprä und Taginä.
Auch diese Niederung ruhte schon im Schatten.
Nur auf sie selbst, ihre weiße Gestalt, die sich von den Zinnen der Türme scharf abhob, auf die Höhe, wo das Kloster ragte und seine Mauern, sowie auf die noch etwas höher und östlicher gelegene Kapelle bei dem Grab des Numa Pompilius, die Spes bonorum, fiel noch voll und leuchtend der Widerschein der sinkenden Sonne.
Lange blickte Valeria, schwerer Ahnungen voll, hinaus in die heute noch friedlich ruhende Landschaft. Welches Ansehen würde sie wohl morgen um diese Stunde zeigen? Wie viele Herzen, die heute noch trotzig, freudig, heißblutig pochten, waren bis dahin still und kalt.—So träumte sie hinaus in den Himmel und in das Gefilde.—
Sie beachtete es kaum, daß die Sonne längst gesunken, daß es rasch dunkelte, schon brannten einzelne Wachtfeuer in beiden Lagern.
«Wundersames Geschick», sprach die Jungfrau zu sich selbst. «Fröhlich, fast vergessen des Gelübdes, das mich an diesen Ort knüpft, lebe ich jahrelang. Da ergreift mich plötzlich eine Hand aus den Wolken und führt mich, wie mit zwingender Gewalt, hierher an den Ort meiner Bestimmung, nicht meiner Wahl. Und nach bangem, trübem Harren folge ich, wieder hoffend, wieder diesen Mauern entrinnend, dem lockenden Ruf des Freundes hinaus in die Freude, in die Welt der Glücklichen. Ich vertausche diese Grabesstille mit dem rauschenden Brautfest in seiner Königsburg.
Und abermal faßt mich, an der Schwelle der Ehefeier, plötzlich die Hand des Geschickes, reißt uns alle aus Freude und Jubel und führt mich und den Geliebten zur Entscheidung—gerade hierher, an den Ort meines Verhängnisses.
Ist das eine Mahnung, eine Vorverkündung? Soll auch den Freund, der sein Geschick an meines gebunden, hier der auf mir lastende, unheimliche Bann ergreifen? Kann ich ihn davon lösen, wenn ich ihm entsage?
Soll er mit dafür büßen, daß wir das Gelübde nicht erfüllt? Ach, der Himmel bleibt taub für die Fragen des geängsteten Menschenherzens. Er öffnet sich nur, um zu strafen; seine furchtbare Sprache ist der Donner und seine Schicksalsleuchte sein zugleich zermalmender Blitz. Bist du versöhnt, du strenger Gott des Kreuzes? Oder forderst du unerbittlich die dir verfallene Seele ein?»
Aus diesem Träumen und Sinnen weckte sie—schon war es ganz dunkel geworden, und der eben aufsteigende Mond warf noch wenig Licht in den hochgelegenen, ummauerten Garten—der rasche Schritt eines Mannes, der hastig nahte von dem Garten her; der Sand der Gartenwege knisterte unter seinen Füßen.
Das war nicht Totilas schwebender Gang.
Die Jungfrau stieg die Marmortreppe herab und wollte sich auf dem schmalen Gang, der zwischen den Zypressen an der Mauer hinführte, nach dem Hause zu wenden,—da vertrat ihr der Nahende, der ihre weiße Gestalt erkannt hatte, plötzlich den Weg, er selbst im dunkeln Mantel kaum kenntlich—, es war der Korse.
Sie erschrak über den plötzlichen Anblick. Wohl hatte sie von je des Mannes Leidenschaft erkannt, aber mit Grauen, mit seltsamer Furcht. «Du hier, Furius Ahalla! Was führt dich in diese frommen Mauern?» Eine Weile schwieg der Fremde. Er atmete schwer und schien, ringend, nach Worten zu suchen. Allmählich stieg das Licht des Mondes über die Mauer. Hell zeigte er bald der schönen Römerin edle Züge und Gestalt. Endlich sprach Furius abgerissen, mühsam. «Das Verlangen führt mich her...—Abschied zu nehmen, Valeria. Abschied für immer. Wir schlagen morgen eine blutige Schlacht. Dein——König hat mir verstattet, noch einmal zu sehen die... Dasjenige, was ich unter allen Männern nur ihm gönne. Oder», fügte er leidenschaftlich hinzu, auf ihre Gestalt blickend und den Arm leise hebend, «gönnen soll, und doch nicht—gönnen kann.»
«Furius Ahalla», sprach Valeria mit Hoheit zurücktretend,—denn sie hatte jene Armbewegung wohl bemerkt—«Ich bin deines Freundes Braut.»
«O ich weiß es—nur zu gut weiß ich es.» Und er trat, ihr folgend, einen Schritt vor. «In meinem Herzen steht es eingeschrieben mit der brennenden Schrift der Qualen. O ich könnte ihn grimmig hassen. Weshalb schritt er—gerade er!—zwischen dich, du schönheitsschimmerndes Weib, und meine rasende Leidenschaft? Jeden andern würde ich zerreißen. Es ist sehr schwer, ihn nicht zu hassen.»
«Du irrst», sprach Valeria—«und nur um dir dies zu sagen—hörte ich solche Sprache zu Ende. Hätte ich Totila nie gesehen—ich wäre doch nie die Deinige geworden.»
«Warum?» fragte der Korse gereizt.
«Weil wir nicht zusammen taugen. Weil, was mich zu Totila hinzieht, mich von dir hinwegreißt.»
«O du irrst! Es muß jedes Weib gewinnen, sich so rasend, so wütend geliebt zu sehn, wie ich dich liebe.»
«Deine Liebe hätte mir Grauen eingeflößt—und nun laß mich in das Haus.»
Aber Furius versperrte den schmalen Pfad mit seiner Gestalt. «Grauen—das schadet nicht. Süßes Grauen ist die Mutter der Liebe. Es gibt verschiedne Art zu lieben, zu werben. Mir hat von je zumeist des Löwen Werbe-Brauch gefallen. Er läßt der Braut nur die Wahl zwischen Liebe und Tod.»
«Genug dieser Worte, die dir zu sprechen, mir zu hören gleich unziemlich ist. Laß mich vorbei.»
«Ha, fürchtest du dich, Vestalin?» Und er trat noch einen Schritt näher.
Jedoch hoheitsvoll maß ihn Valeria mit kaltem Blick der Verachtung. «Vor dir? Nein.»
«Dann bist du allzukühn, Valeria: denn du hättest allen Grund. Und wüßtest du, was in mir lodert seit Jahren, kenntest du die Folterqualen meiner Nächte,—du würdest zittern. Ah, und könntest du mich nicht lieben,—auch dich zittern sehen—wie jetzt—dich zittern machen, wäre Wollust.»
«Schweig!» rief Valeria und wollte sich an ihm vorüber durch die Bäume drängen. Allein nun vertrat er ihr hier den Weg und griff nach ihrem Mantel—seiner Sinne kaum mehr mächtig. «Nein, ich will nicht schweigen», flüsterte er heiß. «Du sollst es wenigstens wissen und in dir nachglühen fühlen, solang du atmest. Schon fühle ich Schauer des Grauens durch deine stolzen Glieder rieseln. Nicht abkürzen will ich mir die Wonne, dich erbeben zu sehen. Ah, wie würdest du erst zittern in diesen Armen, wie würde diese stolze Gestalt hinschmelzen unter dem heißen Hauch meines Mundes...—Wie solltest du mir...»—Und er griff die Widerstrebende an beiden Schultern.
«Hilfe, Licht! Hilfe!» rief Valeria.
Und schon eilte man mit Licht aus der Tür des Hauses.
Jedoch der Korse, der Türe den Rücken wendend, ließ nicht von ihr.
«Laß meinen Arm los.»
«Nein, einmal sollst du mir—»
Aber in diesem Augenblick ward er mit zorniger Gewalt zurückgerissen, daß er Valeria losließ und gegen die Mauer taumelte. Totila leuchtete ihm mit der Fackel in das glühende Antlitz. Furchtbarer, aber heiliger Zorn loderte aus des Königs Augen. «Tiger!» rief er, «willst du meine Braut ermorden wie die deine?»
Mit einem gellenden Schrei der Wut sprang der Korse, beide Fäuste ballend, gegen ihn an. Allein ruhig blieb Totila stehen und durchbohrte ihn mit den Blicken. Furius faßte sich.
Da flog Valeria an Totilas Brust. «O laß von ihm, rasch fort! Er ist rasend!——Seine Braut hat er ermordet?»
Diese Frage aus Valerias Mund ertrug der Korse nicht:—er warf noch einen Blick auf Totila, sah, wie dieser, bejahend, Valeria zunickte... und sofort war er hinter den Zypressen im Schatten verschwunden.
«Ja», sagte Totila, «so ist es. Hat dich der Wahnsinnige recht erschreckt?»
«Es ist vorüber,—du bist ja bei mir.»
«Mich reute, daß ich ihm verstattet, dich aufzusuchen. Und ich eilte hierher, von Liebe und Beunruhigung getrieben.»
«Gut, daß du kamst und nicht die Leute aus dem Hause. Wie tief hätte es ihn beschämt! Ich rief erst, als ich wirklich glaubte, er rase. Und was ist das für eine grausige Tat? Seine Braut?»
«Ja», wiederholte Totila, den Arm um sie schlingend, die Fackel einer Sklavin reichend, die nun aus dem Hause trat, «aber laß uns noch im Mondlicht wandeln.»
Und er schritt mit der Geliebten wieder tiefer in den Garten, auf und ab wandelnd. «Es ist mir nicht lieb, daß mir es der gerechte Zorn entrissen. Es war das Geheimnis, durch das ich über diesen schwarzen Panther wundersame Gewalt gewonnen.
Vor vielen Jahren traf ich ihn—ich hatte lybische Seeräuber verfolgt mit meinen Schiff—im Hafen von Beronike an der Küste der Pentapolis. Er war im Begriff, sich zu vermählen mit Zoe, der Tochter eines syrischen Kaufherrn, der sich, des Elfenbeinhandels wegen, dort in Afrika niedergelassen.
Der Korse hatte von jeher Neigung zu mir gezeigt—ich hatte ihm auch bei seinem Seehandel oft genützt—und er bat mich, der Hochzeitsfeier auf seinem reich geschmückten Fahrzeug beizuwohnen. Ich erschien, und das Fest verlief ganz fröhlich, nur war der Bräutigam in einer Stimmung, die mehr von Grausamkeit als von Zärtlichkeit an sich trug.
Endlich wollten die Eltern der Braut—nur sehr widerstrebend hatten sie dem Fremden, dessen unbändige Wildheit bekannt und auch bei der Werbung selbst hervorgetreten war, das weiche, zarte Kind zugesagt,—auf kleinem Boot mit mir das Schiff verlassen, welches die Brautleute nach Korsika tragen sollte.
In sehr begreiflicher Rührung des Abschieds warf sich Zoe weinend immer wieder in die Arme ihrer Eltern. Ich bemerkte, daß der Bräutigam hierüber in eine mir ganz unfaßliche Wut geriet. Laut rief er Zoe an, ob sie ihren Vater ihm vorziehe? Ob sie denn ihn nicht mehr liebe? Das sähe ja aus wie Reue. Er drohte, schalt, und das arme Kind weinte immer mehr.
Zuletzt schrie er ihr wütend zu, sie solle augenblicklich aufhören zu weinen und, um nach altem Seemannsbrauch bei Schiffshochzeiten, mit dem Beil, das er in der Hand hielt, das Ankertau zu kappen, auf seine Seite des Schiffes treten.
Zoe gehorchte, riß sich von dem Vater los—, da traf sie auf der Mutter banges, tränenerfülltes Auge—und, anstatt zu Furius zu schreiten, wandte sie sich, wieder laut aufschluchzend, ihrer Mutter zu, diese nochmal zu umarmen. Rasend aber sprang Furius herzu, sein Beil blitzte, sie streifend, über des Mädchens Haupt, und er hätte sie auf dem Fleck erschlagen...»—
«Entsetzlich», rief Valeria.
«Fiel ich ihm nicht in den Arm und entriß ihm das Beil mit einem Blick, der ihn plötzlich bändigte. Lysikrates aber trug sein blutendes Kind aus dem Schiff nach Hause und versagte dem gefährlichen Bräutigam die Ehe.»
«Was ward aus ihr?»
«Sie starb bald darauf. Nicht gerade an der Wunde, aber an den Folgen des Schreckens und widerstreitender Aufregungen. Du solltest sie dem Vereinsamten ersetzen.»
Valeria schauderte. «Er ist mir unheimlich. Dem halbgezähmten Raubtier gleicht er, das unberechenbar und unverlässig bleibt. Jeden Augenblick mag seine tödliche Wildheit erwachen.»
«Laß ihn. Sein Kern ist edel. Er tobt sich jetzt aus,—hörtest du den donnernden Hufschlag seines Rosses den Berg hinab?—und morgen—in der Schlacht—macht er alles gut. Ich will ihm gern verzeihn,—er war nicht bei Sinnen. Aber nun laß uns zurückkehren zu uns selbst, zu unsrem Glück und unsrer Liebe.»
«Ist unsre Liebe dein Glück geworden?» fragte Valeria nachdenklich. «Wie viel stärker stündest du morgen im Kampf, wenn des Westgotenkönigs Tochter, wenn jene Haralda, der du gar sehr gefielst...—»
Aber Totila drückte sie an die Brust. «Wer ersetzt Valeria?»
«Dein Glück?» wiederholte diese bang. «Werden wir je vereinigt werden? Man sagt, die Feinde sind euch doppelt überlegen. Die Schlacht morgen,—hast du keine Besorgnis?»
«Nie in meinem Leben habe ich einem Kampf so freudig entgegengesehen. Das wird mein Ehrentag in der Geschichte! Mein Plan ist gut, mich freut's, den großen Schlachtenlenker Narses mit seiner eignen Kunst zu überwinden. Wie in ein Festspiel reite ich in diese Schlacht. Du sollst mir deshalb Helm und Roß und Speer mit Blumenkränzen und mit Bändern schmücken.»—
«Mit Blumen und Bändern!—Opfer schmückt man so.»
«Und Sieger, Valeria.»
«Morgen mit Sonnenaufgang sende ich dir die Waffen hinab ins Lager, geschmückt mit Blumen, die im Frühtau glänzen.»
«Ja, geschmückt will ich reiten in meine schönste Siegesschlacht—denn morgen ist der Tag, da ich in einem Schlag die Braut mir und Italia erkämpfen—ihr seid eins in meinem Herzen, stets hab' ich in dir, du Marmor-Schöne, das Bild Italiens geliebt.»
Als der König beim Schein der Sterne das kleine Haus von Taginä erreichte, wo er sein Quartier aufgeschlagen, traf er im Hofe, auf dem Rand der Zisterne, einen Mann in dunklem Mantel sitzen, die Harfe auf den Knien, sie blitzte im Mondlicht; leise Akkorde griff er darauf.
«Du bist es, Teja? Hast du nichts zu tun auf deinem Flügel?»
«Ich habe dort alles geordnet. Hier hab' ich zu tun—mit dir.»
«Tritt mit mir ins Haus. Ist Julius nicht darinnen?»
«Er ging noch in die Basilika Sankt Pauls, für deinen Sieg zu beten. Er kommt wohl bald zurück. Ich habe dir eine Rüstung mitgebracht, die ich dich bitte, morgen in der Schlacht—mir zuliebe—zu tragen, sie ist fest und sehr sicher.»
Totila blieb gerührt stehen: «Welche Sorgfalt echter Freundschaft!»
Hand in Hand schritten sie nun in das Mittelgemach des Hauses. Da lag, auf dem Marmortisch aufgerichtet, eine vollständige Rüstung, vom Helm bis zu den geschuppten Schuhen, von dem besten hispanischen Stahl, leicht und doch undurchdringlich; meisterhaft gearbeitet, aber ohne allen Schmuck, ohne Helmzier, mit dicht geschlossenem Visier,—alles von dunkelblauem Stahl.
«Welcher zauberkund'ge Schmied hat dieses Wunderwerk geschaffen?» frug Totila bewundernd.
«Ich», sagte Teja. «Du weißt: ich habe von jeher Gefallen an Waffenarbeit gehabt. Und ich habe—ich schlafe wenig nachts—diese Schuppen für dich gefertigt. Du mußt sie annehmen.»
«Ja», lächelte Totila—«für meine Bestattung, darin will ich meinen Leichenzug begleiten. Aber morgen, mein Teja, reit' ich in vollem Königsschmuck ins Treffen. Italia soll nicht sagen, ihr König und Bräutigam habe sich an seinem Ehrentag versteckt. Nein, wer morgen den Gotenkönig sucht, soll nicht viel Mühe haben, ihn zu finden.»
«Ich hab' es gefürchtet», seufzte Teja. «So laß mich wenigstens morgen an deiner Seite fechten: nimm mir den Befehl des rechten Flügels ab.»
«Nein, er ist hochwichtig. Mich beschützen kann ich selbst. Die Berge aber mußt du mir decken und den Weg nach Rom. Im Fall eines Unglücks liegt auf deinem Flügel die einzige Rettung für den Abzug.»
Da trat Julius ein mit Graf Thorismut und Herzog Adalgoth und die Diener,—darunter auch Wachis, der nun Teja als Schildträger begleitet hatte—brachten das Nachtmahl: Fleisch, Früchte, Brot und Wein.
«Denke, Julius», lächelte Totila diesem entgegen, «der kühnste Held im Gotenheer ist ängstlich geworden.»
«Nicht für mich», sagte dieser. «Aber meine Träume treffen meistens ein. Und sie sind immer schwarz.»
« Eure Träume», lächelte Totila dem jungen Adalgoth, der sich neben ihm niederließ, und Wachis zu, der dem König den Becher fällte—« eure Träume, ihr Frischvermählten, sind wohl nicht schwarz!»
«Kann nicht klagen darüber, Herr König», schmunzelte Wachis. «Doch ich wünschte—»
«Was hast du noch zu wünschen außer Liuta?» meinte Totila.
«Ich wünschte, der Lange wäre da.»
«Welcher Lange?»
«Nun: der gar Lange: der noch deinen tapfern Bruder Hildebad um eines Hauptes Länge überragt haben würde, der mit dem Bärenfell und mit der Falken-Werferin:—wie hieß er doch?»
«Harald», sagte Teja ernst.
«Ja, den meine ich. Der wäre gut mit seinen starken Riesen morgen.»
«Wir werden ihn nicht brauchen.»
«Aber besser ist immer besser, Herr König. Und wenn ich der Herr König gewesen wäre:—den hätt' ich wieder kommen lassen, als der Krieg losbrach.»
«Wir brauchen ihn nicht», wiederholte der König schärfer.
«Ich dachte wie mein Schildmann, o König», sagte Teja, «und habe auf eigne Faust—an deiner Einwilligung zweifelnd—gesendet nach ihm: fortgeschickt hättest du ihn doch nicht, hätte ich ihn zur Stelle schaffen können. Auch mir hat dieser treue Nordlandsheld gefallen—: seine Leute wären gut gewesen wider die Langbärte—: leider war die Flotte von meinem kleinen Schiff nicht einzuholen.»
«Dank, Teja, das war wieder ganz deine Art. Aber mich freut, daß du ihn nicht beischaffen konntest. Wir schlagen und siegen allein. Mein Plan ist ganz unfehlbar, wenn nur...—» Hier flog eine Wolke über des Königs Stirn.
«Wenn der Korse seine Schuldigkeit tut», sprach Teja.
«Sage, Thorismut—ich sandte dich noch vom Kloster aus, wo ich einen kleinen Streit mit ihm hatte, an Furius—ich fragte, ob alles beim alten bleibe zwischen uns:—was antwortete er?»
«Er gab mir diesen offenen Brief an dich.»
«Wo trafst du ihn?» forschte der König, die Wachstafel nehmend.
«Vor Taginä. Er wies seinen Reitern bereits die Stellung im Hinterhalt an. Er hat alles auf das genaueste erfüllt, was du vorschriebst.»
Totila las: «Morgen werd' ich erfüllen, was du von mir erwartest. Du wirst mir nach der Schlacht nichts mehr vorwerfen.»
«Er fügte bei», ergänzte Thorismut, «ein paar Hundert seiner Rosse, die, von der Seereise angegriffen, langsamer marschiert, kämen morgen früh sicher an. Sie sind auch schon gemeldet von Septempeda her: du möchtest, womöglich, die Entscheidung hinausziehen, bis zu ihrem Eintreffen.»
«Warum kommt er nicht selbst hierher?» zürnte Teja.
«Er bemüht sich auf das eifrigste», sprach Thorismut—«ich hab' es selbst gesehen—seinen Reitern genau die Örtlichkeit zu zeigen, wo die Entscheidung fällt. Er hat noch im Mondlicht Gefechtsübungen von den Hügeln herab auf die Straße gemacht.»
Totila aber schloß: «Ich weiß, warum er nicht zu meinem Nachtmahl kommt. Es hat nichts auf sich.»
Und sie setzten sich nun auf die Feldstühle und Truhen, die um den Tisch standen, und begannen das einfache Mahl.
«Der König», hob Teja an, «läßt mich morgen nicht an seiner Seite fechten. So befehl' ich ihn dir, mein tapferer Thorismut: behüte du sein Leben.»
«Das wird er nicht immer können», lächelte Totila, trinkend. «Thorismut muß mir die Speerträger in Taginä befehligen.»
«Solang ich an des Königs Seite halte, geschieht ihm nichts», sagte Thorismut ruhig. «Ich gehe, nochmal zu den Vorposten bei Caprä zu reiten.» Und er schritt aus dem Gemach.
«Ja», rief Totila, «bei Neapolis, am capuanischen Tor, war er mein Retter.»
«Und zu Rom am Tiber der junge Harfenherzog hier», sprach Teja, «wo ist er morgen? Er soll dich wieder decken.»
«Nein!» rief dieser: «Ich habe mir ausgebeten, in dem Reiterangriff voranzureiten und Domna Valerias neue Fahne zu tragen.»
«Nun, frommer Julius», sprach Teja—«du sollst nicht fechten:—aber schirme du des Königs Leben.—Ich weiß, du liebst ihn, auf deine Art: und das wird wohl keine Sünde sein.»
«Ich will um ihn bleiben. Aber besser noch als mein schwacher Arm oder dein starker, Graf von Tarentum, wird mein Gebet zu Gott ihn schützen.»
«Gebet!» sagte Teja. «Noch ist kein Gebet durch die Wolken gedrungen. Und wenn es durchdrang, fand es den Himmel leer.»
«Wie», rief der Mönch, «du leugnest, finstrer Mann, wie—wie Cethegus, den Gott der Liebe aus seiner Welt hinaus? Den Gott, der allweise, allmächtig und alliebend vom Himmel aus der Menschen Pfade lenkt, den leugnest du?»
«Ja», rief Teja und ließ die Hand an den Schwertgriff gleiten. «Den leugne ich! Und wäre ein Wesen da oben, lebendig und wissend, was es tut oder geschehen läßt—, man müßte, wie die Riesen unsrer Göttersage, Berg auf Berg und Fels auf Felsen türmen und seinen Himmel stürmen, und nicht ruhen und rasten, bis man das teuflisch grausame Gespenst von seinem blutigen Schädelthron gestoßen hätte oder selbst gefallen wäre von seinem Blitz.»
Entsetzt sprang Julius auf: «Hat denn der Geist der Gottesleugnung, der Gotteslästerung die gewaltigsten Männer der Welt ergriffen? Ich kann solche Worte nicht anhören.»
«Dann frag' mich nicht!»
Mit Staunen sah auch der König auf den sonst so schweigsamen Freund, aus dessen tief verschlossener Brust plötzlich lang verhaltener, grimmiger Schmerz glühend hervorbrach.
«Ihr staunt», fuhr dieser fort, «daß der grabesstille Teja noch so heiß empfindet. Ich staune selbst zuweilen darüber. Aber morgen ist der Tag der Sommersonnenwende; der Tag, da dereinst meine Sonne für immer sich gewandt. An jeder Wiederkehr des Tages bricht mir die alte Wunde schmerzend auf.»
«Ich begreife deine Düstre jetzt, unsel'ger Mann», sprach Julius nach einer Pause. «Ja, ich fasse nicht, wie du leben kannst—ich könnte nicht atmen: ohne Gott.»
«Wer sagt dir, Mönch, Teja hat keinen Gott? Weil ich ihn nicht nach deinem Glauben sehe, nicht, wie du, vermenschlicht, von Liebe, Haß, Zorn, Eifersucht entstellt? Weil ich nicht denken kann, daß er, der Vorschauende, Wesen schafft, sich und andern zur Qual, sie zu verdammen und sie hintendrein, durch ein Mirakel, durch schuldloses Blut des Edelsten, wieder zu erlösen? Weil ich ihn nicht denken kann wie einen ungeschickten Zimmerer, der seine Baute schlecht gemacht hat und nun immer daran nachflicken muß mit mirakelnder Hand? Ich sage dir: die Majestät meines Gottes ist so furchtbar, daß dein armseliger Engelkönig vor seiner Größe verschwindet, vor seiner unerbittlichen Furchtbarkeit, wie das Gewölbe deiner Kirchen gegen das Gewölbe des Weltalls.
Nein, wäre wirklich ein Allvater in den Wolken, und könnte er dem grausamen Gang der Geschicke nicht steuern:—ihn selber müßte der Gram ergreifen. Er müßte furchtbar leiden unter diesen Schmerzen seiner Kinder wie euer sanfter Jesus litt—das hat mich immer tief gerührt! als er auf dem Ölberg der Menschheit ganzen Jammer trug.
Und weil ich dir, mein Totila, versprochen, dir noch einmal von meiner Harfen- und Liedkunst zu vernehmen zu geben:—so höre den Gesang, den ich dem Allvater Odin in den Mund gelegt.»
Und er griff in die Saiten der kleinen Harfe, die neben ihm bei seinen Waffen lag, und sang dazu mit tiefernster Stimme:
Allvaters Gesang
«Es seufzt meine Seele in unsäglichem Jammer
Um des Schmerzengeschlechts, um der Menschen Geschick.
Denn was in der Welt von wechselndem Wehe
Brandend sich bricht in jeglicher Brust,—
Mitempfinden, mitdurchkämpfen,
Mitdurchklagen muß ich es alles,—
Alles, alles:—denn geheißen
Bin ich ‹Allvater›:
Bald des besiegten, bessern Mannes,
Den ein Böser bezwungen,
Bitter beißenden Seelenbrand,
Wie er grollend in Todesgram
Flucht dem grausamen Schicksal:—
Bald des Liebenden tödlich Leid.
Der in leere Luft mit den Armen langt,
Dem langsam das Leben verlodert
An nie verlöschender Sehnsucht Licht:
Und der Witwe Wehklage, der Weisen Weinen
Und der versinkenden Seele
Letzten schrillen Verzweiflungsschrei—
All dies Elend, öd' und endlos,
Es empfindet's mit Allvater
Und wie wenig wollen dawider
Ach die winzigen Wonnen wiegen,
Die, wie verwehte Rosenblätter,
Wogen auf weiten, weiten Wellen,
Auf des Wehs unendlichem Ozean.
Traum, ein Trost nur tröstet die Trauer:
Ein Ziel ist gezeichnet den zahllosen Zähren,
Eine Endzeit.
Ich segne den Tag, da der sengende Surtur
Erbarmend der letzten Menschen Gebilde
Zugleich mit der müden Erde zermalmt,
Da endlich der Quell unerschöpflicher Qualen
Verquillt: das letzte menschliche Herz.
Willkommen der Tag!—und wären sie weise,—
Noch wärmer wünschten sie selbst ihn herbei.»
«So empfand ich früher in die Seele eines gütigen Gottes hinein. Aber seither—, ich habe viel gegrübelt und gesonnen—habe ich einen andern, meinen furchtbaren Gott gefunden. Doch freilich, diesen meinen Gott muß man erlebt haben in den Todesschmerzen des zuckenden Herzens.»
Julius schwieg kopfschüttelnd. Der König aber fragte: «Und wie hast du ihn erlebt, diesen furchtbaren Gott?»
«Die Stunde ist gekommen, Totila, mein König und mein Freund, da du vernehmen magst, was ich so lange auch dir verschwiegen; mein Schicksalsgeheimnis, den Schatten, der über mein Leben fiel, es verfinsternd für immerdar. Nein, bleibe nur, Christ. Auch du magst es hören und dir es dann zurechtlegen mit der Unerforschlichkeit der Wege Gottes, mit der Züchtigung dessen, den er liebt, und anderer Weisheit der Mönche. Solches magst du bei dir denken. Aber sprich es nicht aus; ich ertrage nicht—heute nicht—es zu hören.—Du kennst, Totila, meiner Eltern fluchbeladenes Geschick: denn wir beide wurden ja zusammen in König Theoderichs Waffenschule zu Regium von dem alten Hildebrand erzogen.»
«Ja, und wir liebten uns wie Brüder», sprach der König.
«Anfangs scheu, verschlossen, niedergedrückt durch das Geschick meiner Eltern, lebte ich in deiner sonnigen Nähe allmählich wieder auf. Da überfielen, mitten im Frieden, Kriegsschiffe des Kaisers—er zürnte mit dem König wegen des Grenzstreits bei Sirmium—feindlich Regium und führten, außer andern Gefangenen, auch uns vierzig Jünglinge, auf ihre Trieren uns verteilend, fort,—nur du warst ihnen entgangen, denn der König hatte dich tags zuvor als seinen Becherwart nach Ravenna in das Palatium entboten.
Der alte Hildebrand und Graf Uliaris setzten, sobald sie es erfuhren, mit der sizilischen Flotte den Griechen nach, holten ihre Schiffe ein auf der Höhe von Catana, nahmen sie und befreiten alle Gefangenen. Nur ein Schiff entkam den Befreiern mit raschen Segeln:—die Triere ‹Naus Petrou›, in welcher ich mit zwei Genossen gebunden lag.
Der Trierarch Lykos, anstatt uns Kriegsgefangene nach Byzanz zu führen, zog es vor, uns als Sklaven zu verkaufen und den Kaufpreis einzustecken. Er lief ein in den Hafen der Insel Paros. Dort verschacherte er uns an seinen Gastfreund Dresos, den reichsten Kaufmann jener Eilande.
So war denn Teja, des Grafen Tagila Sohn, ein freier Gote—Sklave eines Griechen.—Ich beschloß, sobald ich meiner Ketten entledigt und meiner Glieder Herr würde, mich zu töten. Aber als wir, in kleinen Booten ausgeschifft, ans Land gebracht wurden, da—o mein Freund—da... Und er hielt inne und legte die Hand vor die Augen.
«Mein Teja», sprach der König, die Hand auf des Seufzenden Schulter legend.
«Da fiel mein Blick auf die reichvergoldete, offene Sänfte, die neben Dresos hielt—und auf ein Mädchen—wunderbar schön! Bald kamen wir auf des Dresos Villa, nahe bei der Stadt, an. Dresos mißhandelte alle seine Sklaven mit Schlägen und übermäßiger Arbeit, ja er mißhandelte selbst seine Mündel Myrtia, das zarte, wundersame Bild.
Mich traf ein milderes Los.
Als er von mir erfuhr, daß ich Waffen zu schmieden und edles Geschmeide wohl verstand,—ich hatte es vom Knaben an geübt—da behandelte er mich besser, baute nahe seiner Villa mir eine Werkstätte und machte mich zum Vorstand der hier beschäftigten Sklaven.
Auch die Ketten nahm er mir—bei Tage—ab.
Nur bei Nacht ward ich mit meinen zwei gotischen Mitsklaven zusammengekettet an den Amboß in der Werkstatt.
Ich hätte die Flucht bei Tage wohl wagen können.
Aber ach—ich floh nicht! Myrtia hielt mich gefesselt! Sie sehen—sie sprechen: denn oft kam sie in die Werkstatt, Geschmeide, Schmuck zu bestellen, bessern zu lassen, bald auch, mir bei der Arbeit zuzuschauen oder meinem Gesang und Harfenspiel zu lauschen.
Und, o ihr ewigen Sterne, welche Wonne! Was anfangs nur Mitleid gewesen in des schönen Griechenkindes Brust,—ich sah es, ich konnte nicht mehr zweifeln,—sie gestand es in seligem Kuß,—das ward Liebe, volle, seltene Liebe.
Ich kann sie nicht schildern: golden ihr Haar, golden ihr Auge, golden ihr Herz.——
Und auch Teja war einmal glücklich und glaubte an Glück und einen gütigen Gott über den Sternen.
Da kam die Geliebte eines Abends, verstört, in Verzweiflung, zu der leisen Zwiesprache in die Werkstätte. Ihr Vormund hatte sie verlobt: verschachert an denselben Trierarchen Lykos, der uns in die Sklaverei verkauft hatte. Bitten, Tränen, kniefälliges Flehen blieben umsonst; auf ihren sechzehnten Geburtstag ward ihr die Hochzeit angesagt. Das war in wenigen Wochen.
Der längst gehegte Plan zu gemeinsamer Flucht ward nun rasch gereift.
Ich hatte mir schon lange eine Feile zur Lösung unserer Ketten gefertigt: nun schmiedete ich noch einen Schlüssel zur Öffnung der Werkhaustür. Meine Mitgefangenen waren eingeweiht. Auf der kleinen Insel konnten wir uns nicht verborgen halten. Wir mußten zur See entfliehen.
Nahe dem Garten und der Werkstätte lag, in der Meeresbucht seitab von der Villa, ein kleines Segelschiff des Dresos, immer gerüstet für Lustfahrten, vor Anker.
Dies wollten wir benutzen, darauf nach Italien zu fliehen: Mundvorrat hatten wir an unseren Tagesrationen abgespart, Waffen fehlten ja nicht.
Der Geburtstag war—und die Hochzeit wurde anberaumt—an den Kalenden des Julius.
In der Nacht vorher sollte ich, nachdem die Kette durchfeilt, die Tür geöffnet, die Genossen nach rechts von dem Hauptgebäude der Villa in die Bucht und auf das Schiff geeilt, mich nach den links von der Villa gelegenen Frauengemächern schleichen, in welchen Myrtia schlief: eine kleine Strickleiter reichte aus, sie von den niederen Gelassen in meine Arme zu führen. Und ich sollte dann mit ihr auf das einstweilen segelfertig gestellte Fahrzeug eilen. Alles war sorgfältig bedacht und bereitet.
Aber schon zwei Wochen vor dem Hochzeitstag traf Lykos, der tief Verhaßte, ein; derselbe Mann, der mich als Sklaven verkauft, und der mir nun die Geliebte rauben wollte.
Mein Haß gegen ihn war grimmig. Kaum hielt ich mich zurück, ihn zu erschlagen, als er mit Dresos und andern Hochzeitsgästen an meinen Amboß trat und ich ihm meine Kunstfertigkeit zeigen mußte. Doch ich bezwang mich—um Myrtias willen.
Diese aber klagte, der verhaßte Bräutigam dränge immer ungestümer zur Hochzeit: kaum könne sie noch den Vormund abhalten, schon sofort sie ihm zu übergeben. Ihre Freiheit, ihr Kommen und Gehen werde immer strenger überwacht.
Da beschlossen wir, schon früher zu fliehen. Wir wählten die Nacht der Sommersonnenwende, wann, wie wir wußten, in der Villa mit großem Trinkgelage der Männer, das Lichterfest gefeiert werden sollte. Wir hofften, wann die Zecher in Wein und Schlaf versunken lägen, am sichersten zu entkommen. Sowie die Sterne in der Mitternacht standen, sollte ich Myrtia aus dem Frauengemach entführen.
Am Tag der Sonnenwende kam Lykos wieder in die Werkstatt mit Dresos und kaufte einen kostbaren Goldschmuck, den ich gefertigt. ‹Weißt du auch, Sklave, für wen?› lachte er. ‹Für mein Weib Myrtia. Und das sage ich dir, Gotenhund: wenn du nochmal den Knechtesblick so frech auf ihr ruhen läßt, wie gestern, da sie hier eintrat—ihr saht mich nicht hinter den Taxusbüschen, aber ich sah dich,—dann bitte ich Dresos, dich mir zu schenken—und dann!› Und er schlug mir mit dem Schaft des Speeres, den er in der Hand hielt, in das Antlitz.
Ich schrie auf und griff nach dem schweren Schmiedehammer:—aber Aligern, mein mitgefangener Vetter, fiel mir warnend in den Arm. Und mit einem Fluche schritt der Trierarch hinaus. Mit welchem Hasse blickte ich dem geschweiften Helm, mit dem silbernen Wolf auf dem Kamm, und dem gelben Mantel nach!
Endlich kam die Nacht, die Dunkelheit.
Wir hörten bis in unsere Werkstätte herab den wüsten Lärm des Trinkgelages aus der Villa dringen. Wir sahen die Lichter des Lichterfestes oben schimmern. Offenbar lagen Dresos, Lykos und die andern Gäste in taumelndem Schwelgen.
Noch war es nicht ganz Mitternacht—, aber ich hatte bereits die Genossen befreit—. Sie waren glücklich an das Schiff zur Rechten des Gartens gelangt—, der Schrei des wilden Schwans, das mit Aligern verabredete Zeichen, war dreimal erklungen—, und eben trat ich leise aus der Türe, nun nach links hin, nach dem Frauenhause, zu eilen—, da hörte ich deutlich die eiserne Gittertüre gehen, die von oben, von der Villa her, in den Garten führte. Argwöhnisch blieb ich stehen und spähte nach oben.
Wirklich: da schlich durch die Taxusbüsche, vorsichtig, tastend und lautlos auf den Zehen gleitend, ein Mann in Kriegertracht. Lykos war es—: deutlich erkannte ich im Mondlicht seinen silbernen Wolf auf dem visiergeschlossenen Helm, und den gelben Mantel, in der Rechten den Speer.
Lauernd, lauschend kam er näher,—sah sich um, ob ihm niemand folge, und schritt dann wieder gerade auf unsere Werkstätte zu, in deren Schatten ich versteckt stand.
Kein Zweifel: er hatte Verdacht geschöpft. Er wollte mich überwachen die Nacht: der Fluchtplan war verraten. Grimmig sprang ich ihm entgegen und stieß ihm das Schwert in die Brust.
Da tönte ein Aufschrei—mein Name—: das war nicht Lykos! Ich öffnete entsetzt das Helmvisier—Myrtia lag sterbend vor mir.»
Er schwieg und verhüllte das Haupt im Mantel.
«Armer, unseliger Freund», sprach Totila, nach seiner Rechten langend. Julius aber sprach leise, unhörbar für beide:
« Mein ist die Rache, ich will dir vergelten: spricht der Herr.»
Teja erhob das Haupt und fuhr fort: «Ich fiel sinnlos, bewußtlos neben ihr nieder. Als ich zu mir kam, fühlte ich den frischen Hauch der Seeluft um mich wehen. Die Genossen, Aligern voran, waren besorgt über unser langes Ausbleiben, in den Garten nach der Werkstätte zurückgekehrt: dort fanden sie uns beide.
Bevor sie starb, erzählte die Geliebte kurz, wie Dresos und Lykos, beide berauscht, im Taumel des Festgelages plötzlich beschlossen, noch in dieser Nacht die Hochzeit zu vollziehen. Kurz vor Mitternacht hatte man die Widerstrebende aus dem Frauengemach geholt und in die Villa, in das wilde Zechgelage, geschleppt. Sogleich sollte die Hochzeitsfeier gehalten werden. Dresos legte ihre zitternde Hand in die des Lykos. Nur so viel Zeit sollte gelassen werden, daß dieser sich zu der auf seinem Schiff zu haltenden Feier umkleiden, Befehle dorthin entsenden konnte, das Brautgemach zu schmücken.
So ließ man die Vermählte—für kurze Zeit—allein.
Diese Zeit benutze sie, eilte in die Vorhalle, wo sie des Lykos Helm und Mantel hatte liegen sehen. Sie hüllte sich rasch in diese Verkleidung, schloß das Visier, barg ihr Frauengewand in dem langen, gelben Mantel und eilte an einigen der berauschten Gäste, unerkannt, vorüber, geradewegs zu mir in die Werkstätte,—denn im Frauenhause waren nun alle Sklaven und Sklavinnen wach—von dort aus mit uns zu fliehen. Und ihr letztes Wort war ein Segenswunsch für mich gewesen.
Sie mußten mich halten—, ich wollte mich ins Meer werfen. Ich verfiel in ein hitziges, schweres Fieber. Ich erwachte erst an Bord eines gotischen Kriegsschiffes, unter Herzog Thulun, das uns bei Kreta aufnahm.
Da entdeckte Aligern plötzlich, daß uns die Triere des Lykos, die entflohenen Sklaven verfolgend, nachgesetzt war und eben um die Spitze von Kydonia bog, als wir an Bord des Kriegsschiffes waren. Sofort setzte der Grieche alle Leinwand auf, zu entkommen, als er die gotische Kriegsflagge erkannte: aber Herzog Thulun und Aligern jagten nach, holten den Griechen ein, enterten und erschlugen Lykos, Dresos und die dreißig Mann des Schiffsvolks.
Ich aber war, da ich erwachte, der Teja, der ich bin.
Und glaubte nicht mehr an den Gott der Gnade und Liebe: und wie ein Hohn auf Myrtia klingt jedes Wort, das davon faselt. Was hatte sie, was hatte ich verschuldet? Weshalb ließ Gott, wenn er lebt, dies Grauenhafte zu?»
«Und weil diese eine Rose geknickt, leugnest du den Sommer und den Sonnenschein?» fragte Totila, «und glaubst, ein blindes Ungefähr beherrscht die Welt?»
«Das glaub' ich nicht. Ewige Notwendigkeit seh' ich im Gang der Sterne da oben; und das gleiche, ewige Gesetz lenkt unsre Erde und die Geschicke des Menschen.»
«Aber dies Gesetz ist ohne Sinn?» fragte Julius.
«Nicht ohne Sinn, nur hat es nicht den Sinn und Zweck unsres Glückes. Sich selbst zu erfüllen ist sein einziger, hoher, geheimnisvoller Zweck. Und wehe den Toren, die da wähnen, ihre Tränen werden gezählt jenseits der Wolken. Oder auch vielleicht wohl ihnen—: ihr Wahn beglückt sie!»
«Und dein Denken», sprach Julius, «beglückt nicht. Ich sehe nicht ein, wofür, wozu du lebst, bei solcher Anschauung.»
«Das will ich dir sagen, Christ. Das Rechte tun, was Pflicht und Ehre heischen, ohne dabei auf tausendfache Verzinsung jeder Edeltat im Jenseits hinüber zu schielen: Volk und Vaterland, die Freunde männlich lieben und solche Liebe mit dem Blut besiegeln. Das Schlechte in den Staub treten, wo du es findest:—denn daß es schlecht sein muß, macht es nicht minder häßlich. Du tilgst auch Natter und Nessel, obwohl sie nicht dafür können, daß sie nicht Nachtigall und Rose—und dabei allem Glück entsagen, nur jenen tiefen Frieden suchen, der da unendlich ernst und hoch ist wie der prächtige Himmel, und wie leuchtende Sterne gehen darin auf und nieder traurige, stolze Gedanken—, und dem Pulsschlag des Weltgesetzes lauschen, der in der eignen Brust wie in dem Sterngetriebe geht,—auch das, Christ, ist ein Leben—des Lebens wert.»
«Aber schwer», seufzte Totila, «unendlich schwer; zu schwer für Menschenkraft. Nein, Teja, und kann ich nicht mit meinem frommen Freund in allen Stücken des Glaubens teilen, der die Zeit beherrscht, das ist doch ewig wahr, weil es meine Seele nicht entbehren kann; es lebt ein güt'ger Gott, der das Gute beschirmt und das Böse bestraft. In dieses gerechten Gottes Hand befehl' ich auch mich und unsres Volkes gerechte Sache. Und in diesem Glauben seh' ich morgen unsrem Sieg getrost entgegen. Das Recht ist mit mir—, das Recht kann nicht erliegen.»
«Das Recht erliegt oft vor dem Unrecht: Witichis vor Cethegus!»
«Ja, auf Erden», fiel Julius ein: «denn nicht hier ist unsre Heimat. Es gibt ein Jenseits, in welchem alles sich gerecht erfüllt.»
«Das müßte sein, und klug ist die Vertröstung», sprach Teja, sich erhebend, einen bittern Zug um den schön und edel geschnittenen Mund. «Nur kann man das nicht denken—nur träumen. Und ich für mein Teil, ich habe genug. Ich wünsche nicht zu erwachen zu neuem Leben, wann mir dereinst der Speer im Herzen steckt.»
Da trat Graf Thorismut, von seinem Ritt zurückgekehrt, ins Gemach und sprach: «Getrost, Herr König, ich habe selbst noch einmal nachgesehen. Die Reiter des Korsen stehen auf dem rechten Fleck bereit. Schon sind auch die ersten seiner nachrückenden Hunderte eingetroffen. Aber dreihundert der Tapfersten erwartet er noch; du mögest morgen den Angriff der Langobarden hinhalten, bis er ihr Eintreffen dir melden lasse: ‹Sie sind die grimmigsten›, sprach Furius, ‹sie dürfen mir nicht fehlen›.»
«Wohlan», rief heiter lächelnd Totila, den Goldpokal erhebend, «das will ich wohl durch Reiterkunst erreichen; und nun den letzten Becher! Suchen wir das Lager. Willst du, Teja? Die Schlacht von Taginä morgen entscheide unsern Streit. Ein wahres Gottesurteil! Ein Urteil Gottes selber, ob er lebt! Ich sage: es lebt ein Gott—drum siegt die gute Sache.»
«Haltet ein», rief Julius bewegt, «ihr sollt nicht Gott versuchen!»
«Siehst du», sagte Teja aufstehend und den Schild auf den Rücken werfend—«ihm bangt für seinen Gott.»
Leuchtend stieg am andern Morgen die Sonne am Himmel empor, und ihre ersten Strahlen fanden das Lager der Goten schon in kriegerischer Bewegung.
Als der König aus seinem Hause auf den Marktplatz von Taginä trat, eilten ihm Herzog Adalgoth, Graf Thorismut und Phaza, der Arsakide, der treu ergebene Gefangene von Neapolis, entgegen: «Heil, Herr, und Sieg. Hier sendet dir deine Braut dein milchweißes Schlachtroß und deine Waffen, reich geschmückt zum Siege.»
Und der König setzte auf das lang wallende Goldhaar den blitzenden, offenen, visierlosen Helm mit dem hoch ragenden Silberschwan, um dessen Hals und gewölbte Flügel Valeria ein Geflecht von roten Rosen gewunden. Und er streichelte Hveit-fulas glänzenden Bug, dem Valeria Mähne und Schweif mit hochroten Bändern und goldenen Borten durchflochten hatte.
Klirrend schwang er sich in den Sattel.
Ein Mariskalk führte noch zwei Ersatzpferde für den König: darunter Pluto, des Präfekten unwillig schnaubenden Rappen.
Von seinen Schultern floß der weit wehende weiße Mantel, von einer breiten, schweren, mit Edelsteinen besetzten Riegelspange unter der Kehle zusammengehalten. Sein Panzer war von glänzendem Silber, reich mit Gold eingelegt, den fliegenden Schwan darstellend; die Enden des Harnisches, an den Armen, dem Halse und um den Gürtel, waren mit Purpurseide eingefaßt. Die Arme und Beine zeigten den Wappenrock von silberweißer Seide, der auch die Hüften bedeckte. Breite, goldne Ringe und Kampfhandschuhe schützten die Arme, Beinschienen die Knie und die Vorderseite der Füße. Der schmale, zierlich geschweifte, längliche Schild zeigte in drei Feldern Silber, Gold, Purpur und den fliegenden Schwan von weißer Lasur in dem Goldfeld. Purpurfarben und mit Silber besetzt waren Behäng und Riemenzeug des Rosses. In der Rechten schwang er den Speer, an dessen Spitze Valeria vier langflatternde Wimpel von purpurnen und weißen Bändern angebracht hatte,—fröhlich flatterten sie im Morgenwind.
So geschmückt und schimmerstrahlend ritt der König durch die Straßen von Taginä an der Spitze seiner Reiter: Graf Thorismut, Phaza, der Armenier, und Herzog Adalgoth, auch Julius beritten in seinem Gefolge; dieser ohne Trutzwaffen, aber mit dem Schilde von Tejas Waffengeschenk.
Niemals hatte er so herrlich in Schönheit geleuchtet.
Und alles Volk begrüßte ihn auf seinem Ritt mit jubelndem Zuruf. An dem Nordtor von Taginä ritt ihm Aligern entgegen.
«Du solltest ja auf dem rechten Flügel fechten», fragte der König. «Was führt dich zu mir?»
«Mein Vetter Teja hat befohlen», sprach Aligern, «ich sollte in deiner Nähe bleiben und dein Leben hüten.»
«Der unermüdlich Treubesorgte!» rief der König.
Aligern schloß sich an sein Gefolge.
Graf Thorismut übernahm nun in dem Städtlein den Befehl über das in den Häusern verborgene Fußvolk.
Vor dem Nordtor von Taginä ritt der König die Stirn seiner nicht starken Reiterschar ab und enthüllte jetzt den Reiterführern seinen Plan. «Ich mute euch das Schwerste zu, Waffenbrüder: Flucht. Aber die Flucht ist nur Schein, die Wahrheit ist euer Mut:—und der Feinde Verderben.»
Und nun ritt das kleine Geschwader auf der flaminischen Straße über die Stelle des Hinterhalts zwischen den beiden Hügeln vorbei. Der König überzeugte sich, daß des Korsen Perserreiter wachsam in beiden Hügelwäldern lauerten; zur Rechten von Furius selbst, zur Linken von ihrem Häuptling Isdigerd geführt.
In Caprä durchs Südtor eingeritten, schärfte Totila dem hier verteilten Fußvolk der Bogenschützen unter Graf Wisand, dem Bandalarius, nochmal ein, erst wann die persischen Reiter ihren Angriff auf die Langobarden gemacht, aus den Häusern, wo sie bis dahin verborgen lagen, wie aus dem Südtor vorzubrechen und Alboin im Rücken zu fassen, indes aus Taginäs Nordtor das speertragende Fußvolk entgegenstürme.
«So werden die Langobarden und was etwa von des Narses Fußvolk nachdringt, zwischen Caprä und Taginä von allen vier Seiten zugleich umfaßt und erdrückt, von mir und Thorismut von vorn, von Furius und Isdigerd aus den Flanken, von Wisand im Rücken. Sie sind verloren.»
«Sieht er nicht aus wie der Sonnengott?» fragte Adalgoth entzückt den Mönch.
«Still! keinen Götzendienst mit Sonne oder Menschen. Und heut' ist Sonnenwende!» antwortete dieser.
Nun erreichte der König das Nordtor von Caprä, ließ es öffnen und sprengte mit seiner dünnen Schar auf das weite Blachfeld vor Caprä gegenüber Helvillum.
Hier hielt das Mitteltreffen des Narses gerade gegenüber. In erster Reihe Alboin mit seinen langobardischen Reitern: hinter diesen, in weitem Zwischenraum, Narses in seiner Sänfte, umgeben von Cethegus, Liberius, Anzalas und andern Führern.
Narses hatte eine böse Nacht, mit leichten Krampfanfällen, hinter sich: er war schwach und konnte sich nicht lange stehend erhalten in seiner zu Boden gestellten, offenen Sänfte. Er hatte Alboin noch einmal eingeschärft, nicht anzugreifen ohne ausdrücklichen Befehl.
König Totila gab nun seinen Reitern das Zeichen: und im Trabe ging die schmale Reihe gegen die gewaltige Übermacht der Langobarden vor. «Sie werden uns doch nicht den Schimpf antun, mit den paar Lanzen uns anzugreifen!» rief Alboin.
Angriff schien zunächst nicht des Königs Zweck.
Er war den Seinen, die plötzlich halt gemacht, weit vorangeritten und zog nun aller Augen durch seine Reiter- und Fechterkunst auf sich. Den Byzantinern war das Schauspiel, das er gewährte, so wundersam, daß die Augenzeugen es mit Staunen Prokop berichteten, der, selber staunend, uns davon erzählt. «An diesem Tage», schreibt er, «wollte König Totila seinen Feinden zeigen, welch ein Mann er sei. Seine Waffen, sein Roß schimmerten von Gold. Von der Spitze seines Speers flatterten der schimmernden Purpurwimpel so viele, daß schon dieser Schmuck von fern den König verkündete. So pflog er, auf herrlichem Roß, in der Mitte zwischen beiden Schlachtreihen, kunstvollen Waffenspiels. Er ritt bald Kreise, bald zierliche Halbkreise zur Rechten und Linken, warf im Galopp den bänderreichen Speer hoch über sein Haupt in die Luft und fing ihn, ehe der zitternde niederfiel, geschickt in der Mitte des Schaftes, bald mit der Rechten, bald mit der Linken: und er zeigte so vor den staunenden Heeren seine Reit- und Waffenkunst.» Nach der Schlacht erfuhren übrigens auch die Byzantiner, daß die Absicht, Zeit zu gewinnen, bis eine erwartete Schar Reiter einträfe, der ernste Grund des heitern Spiels gewesen.
Eine Weile sah sich Alboin dies mit an. Dann rief er dem neben ihm haltenden Langobardenführer zu: «Der reitet in die Schlacht, wie zur Hochzeit geschmückt. Welch kostbares Rüstzeug! Das sieht man nicht bei uns daheim, o Vetter Gisulf! Und noch immer nicht angreifen dürfen! Schläft denn Narses wieder?»
Endlich sprengte ein persischer Reiter, durch die Reihe der Goten sich Bahn brechend, an den König heran: er brachte eine Meldung und jagte spornstreichs zurück.
«Nun endlich!» sprach Totila, «jetzt ist's genug des Spiels!—Tapfrer Alboin, Audoins Sohn», rief er laut hinüber, «so willst du wirklich für die Griechen fechten, gegen uns? Wohlan, so komm, Königssohn—: dich ruft ein König!»
Da hielt sich Alboin nicht länger: «Mein muß er werden mit Panzer und Roß», schrie er und sprengte mit eingelegter Lanze wütend heran.
Totila brachte, mit leisestem Schenkeldruck, sein tänzelndes Pferd plötzlich zum Stehen: er schien den Stoß erwarten zu wollen. Schon war Alboin heran. Da:—abermals ein leiser Schenkeldruck und ein feiner Seitensprung des Pferdes:—und an Totila vorbei sauste der Langobarde. Im Augenblick aber war Totila in seinem Rücken—und ohne Mühe hätte er ihn mit dem gezückten Schwert von hinten durchbohrt.
Laut auf schrien die Langobarden und eilten ihrem Königssohn zu Hilfe.
Aber Totila schwenkte die Lanze in seiner Hand herum und begnügte sich, mit dem stumpfen Schaftende dem Gegner einen solchen Stoß in die linke Seite zu geben, daß er auf der rechten Seite aus dem Sattel zur Erde flog.
Ruhig ritt darauf Totila zu seiner Reihe zurück, den Speer über dem Haupte schwenkend.
Alboin war wieder zu Pferd gestiegen und führte nun den Angriff seiner Geschwader auf die schwache gotische Reihe.
Aber bevor der Anprall erfolgte, rief der König: «Flieht! Flieht in die Stadt!» warf sein Roß herum und jagte davon, auf Caprä zu. Eilfertig folgten ihm seine Reiter.
Einen Augenblick stutzte Alboin verblüfft. Aber gleich darauf rief er: «Es ist nicht anders. Es ist eitel Flucht! Da rennen sie schon in das Tor. Ja, Reiterkunststücke und Kampf sind zweierlei. Nach, meine Wölflein! Hinein in die Stadt.»
Und sie sprengten auf Caprä los, rissen das von den Fliehenden nur zugeworfene, nicht verriegelte Nordtor auf und jagten durch die lange Hauptstraße auf das Südtor zu, durch welches eben die letzten Goten verschwanden.
Narses hatte sich in seiner Sänfte mühsam aufrecht erhalten bis jetzt und alles mit angesehen. «Halt», rief er nun heftig. «Halt! Blast die Tuba! Blast zum Halten! Zum Rückzug! Es ist die plumpste Falle der Welt! Aber dieser Alboin meint, es muß Ernst sein, wenn einer vor ihm läuft.»
Aber die Trompeter hatten gut blasen. Das Siegesgeschrei der verfolgenden Langobarden übertönte das Signal: oder die es hörten, verachteten es.
Stöhnend sah Narses die letzten Reihen der Langobarden in dem Tore von Caprä verschwinden.
«Ach», seufzte er, «so muß ich sehenden Auges eine Torheit begehen. Ich kann sie nicht untergehen lassen für ihre Dummheit, wie sie es verdienten. Ich brauche sie noch. Also vorwärts, im Namen des Unsinns! Bis wir sie einholen, können sie schon halb zerhauen sein. Vorwärts, Cethegus, Anzalas und Liberius, mit den Isauriern, Armeniern und Illyriern. Hinein nach Caprä. Aber bedenkt, die Stadt kann nicht leer sein! Es ist eine Falle, in die wir jenen Stieren nachspringen, mit sehenden Augen. Meine Sänfte folgt euch. Aber ich kann nicht mehr stehen.» Und er lehnte sich müde zurück: ein leiser Schauer, wie er ihn oft in der Aufregung ergriff, schüttelte ihn.
Im Sturmschritt eilte des Cethegus und Liberius Fußvolk gegen die Stadt: beide Führer ritten voraus.
Inzwischen hatten Fliehende und Verfolger das schmale Städtlein durchflogen, auch die letzten Langobarden Caprä durcheilt und die ersten derselben mit Alboin die Stelle der flaminischen Straße halbwegs vor Taginä erreicht, wo die beiden Waldhügel links und rechts die Straße einengten.
Noch eine Pferdelänge floh der König : dann hielt er, wandte sich und winkte. Adalgoth an seiner Seite stieß ins Horn—: da brach aus dem Nordtor von Taginä Thorismut mit den Speerträgern: und aus dem Doppelhinterhalt stürzten von links und rechts, mit gellendem Zinkengeschmetter, die persischen Reiter des Korsen.
«Jetzt kehrt, meine Goten, vorwärts zum Angriff! Jetzt wehe den Getäuschten.»
Ratlos blickte Alboin nach allen drei Seiten. «So übel sind wir noch nirgends reingetrabt, meine Wölflein!» sagte er. Er wollte zurück. Aber aus dem Südtor von Caprä, den Rückweg sperrend, brach nun gotisches Fußvolk.
«Jetzt heißt's nur noch lustig sterben, Gisulf. Grüße mir Rosimunda, wenn du davonkommen solltest.» Und so wandte er sich gegen einen der Reiterführer mit reichem, offnem Goldhelm, der nun die Straße erreicht hatte und gerade auf ihn einsprengte.
Schon waren sie ganz nahe aneinander: da rief der mit dem Goldhelm: «Wende, Langobarde! Dort stehen unsre gemeinsamen Feinde. Nieder mit den Goten.»
Und schon durchrannte er einen gotischen Reiter, der Alboin bedrohte.
Und schon hieben auf beiden Seiten die persischen Reiter, an den Langobarden vorüberjagend, auf die entsetzten Goten ein.
Einen Augenblick noch hielten diese, überrascht, inne.
Aber als sie sahen, daß es kein Mißverständnis war—daß der Hinterhalt ihnen, nicht den Langobarden galt—, da riefen sie: «Verrat! Verloren!» und stoben, diesmal in unverstellter Flucht, zurück gegen Taginä, alles mit sich fortreißend, ihr eigenes, eben aus dem Tore rückendes Fußvolk niederreitend.
Auch aus des Königs Antlitz wich die Farbe, als er den Korsen an der Seite Alboins auf die Goten einhauen sah.
«Ja, das ist Verrat!» rief er. «Ah, der Tiger! Nieder mit ihm!» Und er sprengte auf den Korsen los. Aber bevor er ihn erreichen konnte, war von der linken Seite her Isdigerd, der Perser, mit seiner Schar, zwischen dem König und dem Korsen, auf die Straße gestürmt. «Auf den König!» rief er den Seinigen zu. «Alle Wurfspeere auf den König! Der dort, der Weiße! mit dem Schwanenhelm! Alle auf den.»
Ein Hagel von Wurfspeeren sauste durch die Luft.
Im Nu starrte des Königs Schild von Geschossen.
Da erkannte auch der Korse von weitem die hohe, die leuchtende Gestalt. «Er ist's! Mein muß sein Herzblut werden.» Und er bahnte sich einen Weg durch seine und Isdigerds Reiter. Nur einige Pferdelängen trennten noch die ergrimmten Feinde. Vorher traf noch Totila auf Isdigerd. Augenblicks flog dieser, vom König durch Hals und Genick gestoßen, tot vom Pferd.
Alsbald mußten nun Totila und Furius sich begegnen.
Schon hob der Korse zielend den Wurfspeer: er zielte auf das offene, ungedeckte Antlitz des Königs.
Aber plötzlich war der leuchtende Schwanhelm verschwunden und der helle Mantel.
Zwei Wurfspeere hatten des Königs weißes Roß niedergestreckt und gleichzeitig ein dritter seinen Schild durchbohrt und seinen Schildarm schwer getroffen. Roß und Reiter stürzten.
Wild jauchzten die Perser Isdigerds und drangen ein: auch Furius und Alboin spornten ihre Rosse vor.
«Schont des Königs Leben! Nehmt ihn gefangen! Er hat auch mich verschont!» rief Alboin.
Denn tief gerührt hatte ihn, was ihm Gisulf erzählt, der Totila deutlich die Lanzenspitze mit dem Schaftende vertauschen gesehn.
«Nein! Nieder mit dem König!» rief Furius.
Und schon war er heran und warf den Speer auf den Verwundeten, den eben Aligern auf des Präfekten Rappe hob und aus dem Gefecht führen wollte. Jenen ersten Wurfspeer des Korsen fing Julius mit dem trefflichen Schilde Tejas auf. Furius ließ sich einen zweiten Wurfspeer reichen und zielte auf das Gedränge um den König: Phaza, der Arsakide, wollte den Speer mit dem Schilde fangen, aber durch Schild und Panzer flog er, der wutbeflügelte, ihm ins Herz.
Da schwang Furius, der sein Roß nun ganz nahe herangespornt hatte, den langen, krummen Säbel gegen den König. Jedoch ehe der Streich fiel, flog der Korse rücklings aus dem Sattel. Der junge Herzog von Apulien hatte ihm den Fahnenspeer mit aller Kraft gegen die Brust gerammt, daß der Schaft brach.
Allein nun geriet Totilas Banner—das kunstvolle und kostbare Werk Valerias und ihrer frommen Schar—in äußerste Gefahr in Adalgoths Hand. Denn alle Reiter drängten jetzt auf den kühnen, jungen Fahnenträger ein:—der Beilhieb des Langobarden Gisulf traf den Schaft, der nochmal splitterte. Rasch entschlossen riß Adalgoth das Seidentuch von der gebrochenen Fahnenstange und barg es fest im Schwertgurt.
Nun war Alboin heran und rief dem König zu:
«Gib dich gefangen, Gotenkönig: mir, dem Königssohn.»
Da war Aligern mit seiner Arbeit, den König auf des Präfekten Rappen zu heben, fertig: er wandte sich gegen den Langobarden. Dieser wollte des Königs Flucht hemmen und doch den König nicht töten; er führte, sich tief vorbeugend, einen Speerstoß gegen den Rappen, der dessen Hinterbug traf. Aber im gleichen Moment schlug ihn Aligern durch den geiergeflügelten Helm: betäubt wankte er im Sattel.
So gewannen, nachdem die Führer der Verfolgung für den Augenblick gelähmt, Adalgoth, Aligern und Julius Zeit, den König aus dem Getümmel zu führen bis an das Nordtor von Taginä.
Hier hatte Graf Thorismut seine Speerträger wieder geordnet.
Der König wollte daselbst den Kampf leiten, aber er vermochte kaum, sich im Sattel zu halten. «Thorismut», befahl er, «du hältst Taginä; Caprä wird einstweilen verloren sein. Ein Eilbote holt Hildebrands ganzen Flügel zurück hierher: es muß die Straße nach Rom um jeden Preis gehalten werden. Teja ist, wie ich erfahren, schon mit seinem Flügel im Gefecht—: Deckung des Abzugs nach Süden—: das ist die letzte Hoffnung.» Und das Bewußtsein verging ihm.
Graf Thorismut aber sprach: «Ich halte Taginä mit meinen Speerträgern bis auf den letzten Mann. Reiter kommen mir nicht herein: die Perser nicht und die Langobarden nicht: ich decke dem König Leben und Rücken, solang ich eine Hand heben mag. Schafft ihn weiter zurück—: auf die Berge dort, ins Kloster—aber rasch!—: Denn schon naht dort, aus dem Südtor von Caprä, die Entscheidung—: des Narses Fußvolk, und seht dort—: Cethegus der Präfekt mit den Isauriern. Caprä und unsere Schützen sind verloren.»
Und so war es.
Wisand hatte, dem Befehle gemäß, Caprä nicht verteidigt, sondern Cethegus und Liberius eindringen lassen: erst als sie darin waren, begann der Straßenkampf und bedrohte zugleich die Langobarden-Reiter auf der Straße, indem er eine Tausendschaft gegen sie aus dem Südtore schickte.
Aber da der Angriff der Perser auf dem Hinterhalt die Goten traf, nicht die Langobarden, da jene, Alboin und Furius vereint, die wenigen Gotenreiter vernichteten oder zerstreuten und der Angriff der Speerträger von Taginä her ausblieb, wurden die gotischen Schützen zuerst in Caprä selbst, dann auf der flaminischen Straße zwischen Caprä und Taginä von der furchtbaren Übermacht rasch erdrückt.
Verwundet entkam, wie durch ein Wunder, Wisand nach Taginä und meldete dort die Vernichtung der Seinen. Des Narses Sänfte wurde nach Caprä eingetragen: und der Sturm der Illyrier auf Taginä begann. Graf Thorismut widerstand heldenhaft: er focht, den Goten den letzten Ausweg zu decken.
Bald wurde er durch Tausendschaften von Hildebrands in Eile herangezogenem Flügel verstärkt, während den größten Teil seiner Truppen der alte Waffenmeister südlich hinter Taginä herum auf die Straße nach Rom führte.
Eben als der Sturm auf Taginä beginnen sollte, traf Cethegus auf Furius und Alboin, die sich von ihren Stößen erholt hatten. Cethegus hatte das allentscheidende Eingreifen des Korsen erfahren. Er schüttelte ihm die Hand.
«Siehe da, Freund Furius: endlich doch auf der rechten Seite—gegen den Barbarenkönig.»
«Er darf nicht lebend entkommen», knirschte der Korse.
«Was? Wie? Er lebt noch? Ich denke—er fiel?» forschte Cethegus hastig.
«Nein, sie haben ihn noch herausgehauen, den Wunden.»
«Er darf nicht leben», rief Cethegus, «du hast recht! Das ist wichtiger, als Taginä erobern. Diese Heldentat kann Narses von der Sänfte aus vollbringen. Sie sind siebzig gegen sieben. Auf, Furius: wozu stehen deine Reiter hier müßig?»
«Die Gäule können nicht die Mauern hinaufreiten.»
«Nein, aber schwimmen können sie. Auf, nimm du dreihundert, gib mir dreihundert. Zwei Wege führen links und rechts vom Städtlein über—nein! die Brücken haben sie abgebrochen—also: durch den Clasius und durch die Sibola—laß ihn uns verfolgen.—Gewiß ist der wunde König...—kann er noch kämpfen?»
«Schwerlich.»
«Dann ist er über Taginä geflüchtet worden—nach Rom oder—»
«Nein, zu seiner Braut!» rief Furius: «Gewiß zu Valeria ins Kloster. Ha, in ihren Armen will ich ihn erdolchen! Auf, ihr Perser, folgt mir. Dank, Präfekt! Nimm Reiter, soviel du willst. Und reite du rechts. Ich reite links um die Stadt: denn zwei Wege führen nach dem Kloster.» Und schon war er, links abschwenkend, verschwunden.
Cethegus redete den Rest der Reiter persisch an und befahl ihnen, ihm zu folgen. Dann ritt er zu Liberius heran und sprach: «Ich fange den Gotenkönig.»—«Wie? Er lebt noch? Dann eile.»
«Nimm du einstweilen dies Taginä», fuhr Cethegus fort: «ich lasse dir meine Isaurier.» Und er sprengte mit Syphax und dreihundert Persern, rechts umschwenkend, davon.
Einstweilen hatten den wunden König die Freunde durch Taginä hinaus in ein kleines Piniengehölz an der Straße gebracht, wo er aus einer Quelle trank und sich etwas erholte. «Julius», mahnte er, «reite hinauf zu Valeria. Sag' ihr, diese Schlacht sei verloren: aber nicht das Reich, nicht ich, nicht die Hoffnung. Ich reite, sowie ich mich gekräftigt, hinauf nach der Spes bonorum: in jene feste hohe Stellung habe ich Teja und Hildebrand beschieden nach Lösung ihrer Aufgaben. Geh, ich bitte, tröste die Geliebte und bringe sie selbst aus dem Kloster dorthin. Du willst nicht? Dann reit' ich selbst den steilen Weg ins Kloster: nimm mir das doch ab.»
Nicht gern schied Julius von dem Wunden.
«O hebe mir Helm und Mantel ab: sie sind so schwer», bat dieser, Julius löste ihm beide.
Da durchzuckte den Mönch ein Gedanke: hatten sie nicht schon einmal die Gewande getauscht, die Dioskuren? Und hatte er nicht schon einmal den Mordstahl dadurch von Totila auf sich gezogen? Und nun kam ihm blitzschnell:—wenn sie verfolgt wurden?—denn ihm war, als höre er Rosse eilend nahen, und Aligern—Adalgoth hielt des Königs Haupt in seinem Schoß—war an den Waldeingang geeilt, zu spähen. «Ja: sie sind's», rief dieser jetzt zurück: «persische Reiter nahen von zwei Seiten dem Wald.»
«Dann eile, Julius», bat Totila, «rette Valeria auf das feste Grab zu Teja.»
«Ja, ich eile, mein Freund! Auf Wiedersehn!» Und er drückte ihm nochmal die Hand. Dann bestieg er den Rappen Pluto:—er wählte das verwundete Roß, dem Freund das eigne, noch unversehrte überlassend. Rasch setzte er, ungesehen von Totila, den Schwanenhelm aufs Haupt, warf den weißen, blutbespritzten Mantel um und sprengte aus dem Walde gegen die Klosterhöhe. «Dieser Weg», sagte er sich, «ist ganz offen und ungedeckt, dagegen der des Königs nach dem Grab geht durch Wald und Weinberge. Vielleicht gelingt es, die Verfolgung auf mich und von ihm abzuziehen.»
Und in der Tat, kaum war er aus dem Gehölz ins Freie gelangt und begann, bergan zu reiten, als er sah, wie die Reiter, die um Taginä herumgeschwenkt waren, ihm eifrig folgten. Um so lang als möglich die Verfolger von dem König abzulenken, so spät als möglich erst die Erkennung des Irrtums herbeizuführen, trieb er sein Roß zu höchster Eile. Aber der Rappe war wund: und es ging sehr steil einen steinigen Hang hinan. Näher und näher brausten die Verfolger.
«Ist er's?»—«Ja, er ist's.»—«Nein, er ist's nicht. Er ist zu klein», sagte der Führer, der als der vorderste ritt. «Und sollte er ganz allein fliehen?»—«Das wäre freilich das klügste, was er tun könnte, zu entkommen», meinte der Führer. «Freilich ist er's, der Schwanenhelm»—«Der weiße Mantel!»—«Aber er ritt ein weißes Roß?» fragte der Führer.—
«Ja, zuerst», antwortete einer der Reiter. «Aber als das fiel von meinem Speer—da hoben sie ihn—ich stand ja dabei—auf diesen Rappen.»
«Gut», rief der Führer, «genug, dann hast du freilich recht. Und ich kenne den Rappen.»
«Ein edles Tier! Wie es aushält, bergan, obwohl es blutet.»
«Ja, er ist edel! Und er soll stehen, der Rappe, gebt acht: Halt, Pluto! auf die Knie.» Und zitternd, schnaubend hielt das kluge, treue Roß, trotz Sporn und Schlag, und senkte langsam die Vorderfüße in den Sand.
«Verderben bringt's, Barbar, des Präfekten Roß zu reiten! Da! Nimm das für's Forum! und das für's Kapitol! und das für Julius!»
Und wütend schleuderte der Führer drei Wurfspeere nacheinander, den eigenen und zwei von Syphax, die er diesem entriß, in den Rücken, daß sie vorn herausdrangen, sprang vom Roß, zog das Schwert heraus und riß des zur Erde Gestürzten Haupt an dem Helm empor.
«Julius!» schrie er entsetzt.
«Du, o Cethegus?»
«Julius! Du darfst nicht sterben.» Und leidenschaftlich suchte er das Blut zu hemmen, das dem aus drei Wunden floß.
«Wenn du mich liebst», sprach der Sterbende—«rette ihn:—rette Totila!» Und die sanften Augen schlossen sich für immer.
Cethegus tastete nach dem Herzen: er legte ihm das Ohr auf die entblößte Brust.
«Es ist aus», sagte er dann tonlos. «O Manilia! Julius—dich hab' ich geliebt. Und er starb, seinen Namen auf den Lippen! Es ist vorbei», sprach er dann grimmig. «Das letzte Band, das mich an Menschenliebe fesselte,—ich mußt' es selbst zerhaun, durch höhnisch äffenden Zufall. Es war die letzte Schwäche. Jetzt, Menschheit, bist du mir tot. Hebet ihn auf das edle Pferd: das, mein Pluto, sei dein letzter Dienst im Leben: und bringt ihn...—dort oben ragt eine Kapelle: dorthin bringt ihn: und laßt ihn durch Priester feierlich bestatten. Sagt da oben nur: er hat als Mönch geendet—er starb für seinen Freund. Er verdient ein christlich Begräbnis. Ich aber», schloß er furchtbar, «ich gehe, nochmal seinen Freund zu suchen: ich will sie rasch vereinigen—auf ewig.» Und er stieg wieder zu Pferd.
«Wohin?» fragte Syphax, «zurück nach Taginä?»
«Nein! Dort hinab in jenen Wald. Da wird er geborgen sein. Denn daher kam Julius.»
Während dieser Vorfälle hatte sich der König erholt und erkräftigt und ritt auf dem Pferde des Julius mit Adalgoth, Aligern und einigen Reitern geradeaus durch den Wald, an dessen östlichem Saum der Weg zu dem Kapellenhügel emporstieg: schon sahen sie die weißen Mauern deutlich schimmern, als sie aus dem Waldweg bogen.
Aber da erscholl vom Süden, von ihrer rechten Seite her, gellendes Geschrei: und über das offene Blachfeld sprengte, von dem Calsius her, eine starke Schar von Reiten gegen sie an.
Der König erkannte den Führer. Und ehe seine Begleiter ihm zuvorkommen konnten, spornte er sein Roß, fällte den Speer und schoß dem Feind entgegen. Wie zwei Blitze, aus sich entgegengrollenden Gewittern, trafen die beiden Reiter zusammen.
«Übermütiger Barbar!»
«Elender Verräter!»
Und beide sanken vom Roß. Mit solcher Wucht waren sie aufeinandergeprallt, daß keiner der Deckung, jeder nur des Stoßes gedacht hatte.
Furius Ahalla war tot vom Roß gestürzt, denn der König hatte ihm den Speer mit solcher Kraft durch den Goldschild und den Panzer in das Herz gestoßen, daß der Schaft in der Wunde brach.
Aber auch der König sank sterbend in Adalgoths Arme: der Lanzenstoß hatte ihn gerade unter der Kehlgrube in Hals und Brust getroffen.
Adalgoth riß Valerias blaues Bannertuch hervor aus dem Gürtel und suchte das strömende Blut zu hemmen—, umsonst—: das helle Blau war sofort tief gesättigt vom Rot.
«Gotia!» hauchte er noch, «Italia—Valeria!»
In diesem Augenblick, ehe das ungleiche Gefecht beginnen konnte, erreichte Alboin mit seinen Langobarden-Reitern die Stelle: er war dem Korsen gefolgt, ungewillt, müßig zu bleiben, während des Mauerkampfes um Taginä.
Schweigend, ernst, gerührt sah der Langobardenfürst auf die Leiche des Königs. «Er hat mir das Leben geschenkt—ich konnte seins nicht retten», sprach er ernst.
Einer seiner Reiter wies auf die reiche Rüstung des Toten.
«Nein», sprach Alboin: «dieser königliche Held muß bestattet werden in allen Ehren königlicher Waffen.»
«Dort oben, auf der Felshöhe, Alboin», sprach Adalgoth traurig, «harret seiner längst die Braut und—selbstgewählt, das Grab.»
«Bringt ihn hinauf: ich gebe frei Geleit der edeln Leiche und den edeln Trägern. Ihr Reiter, folgt mir zurück in die Schlacht.»
Aber die Schlacht war aus: wie Alboin und auch der Präfekt zu ihrem größten Staunen und Verdruß erfuhren, als sie wieder bei Taginä eintrafen.
Den Präfekten hatte, als er eben in den Pinienwald von Norden her eingebogen war und hier des Königs Spur verfolgen wollte, ein Eilbote des Liberius erreicht, der ihm gebot, augenblicklich zurückzukehren: Narses sei bewußtlos: und höchste Gefahr verlange augenblicklich Entscheidung.
Narses bewußtlos,—Liberius ratlos,—der schon sicher geglaubte Sieg gefährdet:—das wog doch schwerer als die zweifelhafte Aussicht, dem halbtoten König den Todesstoß zu geben. Eilig sprengte Cethegus zurück des Weges, den er gekommen, nach Taginä.
Hier rief ihm Liberius entgegen: «Zu spät: ich habe alles schon abgeschlossen und bewilligt. Waffenstillstand. Der Rest der Goten zieht ab.»
«Was?» donnerte Cethegus,—er hätte gern alles gotische Blut als Grabopfer auf seines Lieblings Grab geschüttet «Abzug? Waffenstillstand? Wo ist Narses?»
«Bewußtlos liegt er in seiner Sänfte: in argen Krämpfen. Der Schreck, die Überraschung—es warf ihn nieder—und kein Wunder!»
«Welche Überraschung? Rede, Mensch!»
Und kurz erzählte Liberius, daß sie unter furchtbarem Blutvergießen, «denn diese Speer-Goten standen wie die Mauern»—in Taginä eingedrungen waren und im Straßenkampf Haus für Haus, ja Gemach für Gemach, erstürmen mußten—«Zoll für Zoll mußte man zerhacken einen Führer, der, den einstürmenden Anzalas durchrennend, in die Mauerbresche gesprungen war, bis man, über ihn hinweg, in die Stadt drang.»
«Wie hieß er?» forschte Cethegus eifrig, «hoffentlich Graf Teja?»
«Nein, Graf Thorismut.—Als wir halbwegs fertig waren mit der Blutarbeit und Narses sich in die Stadt tragen lassen wollte, da traf ihn, im Tore von Taginä, als Bote von unserem linken Flügel—der nicht mehr besteht!—gotische Herolde ritten mit ihm—der verwundete Zeuxippos.»
«Wer hat—?»
«Er, den du vorhin nanntest:—Graf Teja! Er übersah oder erfuhr, daß der Seinen Mitteltreffen schwer bedroht, der König verwundet sei: da, erkennend wohl, daß er viel zu spät kommen würde, die Entscheidung bei Taginä zu wenden, faßte er einen kühnen, einen verzweifelten Entschluß. Er warf sich plötzlich aus seiner abwartenden Ruhe von den Bergen auf unsern linken, ihm entgegenstehenden Flügel, der langsam gegen ihn bergan rückte, schlug ihn im ersten Anlauf, verfolgte die Fliehenden ins Lager und nahm dort Zehntausend der Unsern, darunter meinen Orestes, Zeuxippos und alle Führer gefangen. Er schickte Zeuxippos, gebunden, mit gotischen Herolden, die Wahrheit zu bestätigen, und forderte sofortigen Waffenstillstand auf vierundzwanzig Stunden.»
«Unmöglich!» rief Cethegus.
«Sonst habe er geschworen, alle zehntausend Gefangenen,—samt den Feldherren!—zu töten.»
«Gleichviel», meinte der Präfekt.
«Dir mag es gleichviel sein, Römer: was liegt dir an einer Myriade unserer Truppen? Aber nicht so Narses. Die furchtbare Überraschung, die schrecklichere Notwendigkeit der Wahl erschütterte ihn bis ins Mark: ein arger Anfall seiner Krankheit warf ihn nieder, mir reichte er sinkend noch den Feldherrnstab, und ich, natürlich, nahm den Vorschlag an»
«Natürlich: Pylades muß den Orestes retten», zürnte Cethegus.
«Und zehntausend Mann des kaiserlichen Heeres.»
«Mich bindet der Vertrag nicht», rief Cethegus, «ich greife wieder an».—«Das darfst du nicht! Teja hat seine Gefangenen größtenteils und alle Feldherren als Geiseln mitgeführt:—er schlachtet sie, fliegt noch ein Pfeil.»
«Er schlachte sie! Ich greife an.»
«Sieh zu, ob dir die Byzantiner folgen. Sofort habe ich deinen Scharen des Narses Befehl mitgeteilt. Denn ich bin jetzt Narses.»
«Des Todes bist du, sowie Narses zu sich kommt.»
Aber Cethegus erkannte, daß er mit seinen Söldnern allein den Goten nichts anhaben konnte, die nun (nachdem sich Teja mit seinen Gefangenen auf den Kloster- und den Kapellenhügel und die flaminische Straße zurückgezogen und auch Hildebrands Flügel mit nicht allzu schweren Verlusten diese Straße erreicht:—anfangs hatten die beiden Flüsse, dann der verkündete Waffenstillstand die Verfolgung durch Johannes gehemmt—) die Reste ihrer Truppen, die beiden Flügel, in eine feste Stellung versammelt hatten.
Sehnsüchtig harrte Cethegus auf die Herstellung des Narses, der, so hoffte er, den von seinem Stellvertreter geschlossenen Vertrag nicht anerkennen würde.
Inzwischen hatten Teja und Hildebrand von beiden Flügeln her den Kapellenhügel des Numa erreicht, wohin, wie ihnen gemeldet war, der verwundete König gebracht worden. Nachricht von den späteren Vorgängen hatte sie noch nicht erreicht.
Noch außerhalb der Umwallung des Kapellenbaus hatten sich beide Führer über den Plan geeinigt, den sie dem König vorschlagen wollten: gab es doch keinen andern Ausweg als schleunigen Rückzug gen Süden unter dem Schutz des Waffenstillstands.
Aber als sie nun in das Innere des ummauerten Haines traten—welcher Anblick bot sich ihnen dar!
Laut aufschluchzend eilte Adalgoth Teja entgegen und führte ihn an der Hand an den efeuumgrünten Sarkophag des Numa.
In diesem lag auf seinem Schilde König Totila: die ernste Majestät des Todes verlieh den edeln Zügen eine Weihe, die schöner war, als je der Schimmer der hellen Freude auf diesem herrlichen Antlitz gestrahlt hatte.
Links von ihm ruhte, in der längst von dem Sarkophag gelösten, gewölbten Deckelplatte, Julius:—die Ähnlichkeit der Dioskuren trat nun, unter dem gemeinsamen Schatten des Todes, wieder ergreifend hervor.
In der Mitte aber der beiden Freunde war auf des Königs blutüberströmtem weißen Mantel von Gotho und Liuta eine dritte Gestalt gebettet worden: auf einem sanft erhöhten Hügel, das edle Haupt an der Zisterne Rand gelehnt, lag Valeria, die Römerin.
Entboten von dem nahe gelegenen Kloster, den verwundeten Geliebten in Empfang zu nehmen, hatte sie sich, ohne Seufzer, ohne Wehegeschrei, über den breiten Schild geworfen, auf welchem Adalgoth und Aligern ihn langsam, feierlichen Schrittes, durch die Mauerpforte trugen.
Ehe noch einer der beiden gesprochen, rief sie: «Ich weiß es:—er ist tot.»
Sie hatte noch geholfen, die schöne Leiche in dem Sarkophag des Numa beizusetzen. Dazu hatte sie, ohne Träne, mit leiser Stimme, vor sich hingesprochen: «Siehest du nicht, wie schön von Gestalt, wie schimmernd Achilleus?—Dennoch harret auch seiner der Tod und das dunkle Verhängnis, Wenn auch ihm in des Kampfes Gewühl das Leben entschwindet, Ob ihn ein Pfeil von der Sehne dahinstreckt oder ein Wurfspeer. Doch mir sei dann vergönnt, in die Schatten zu tauchen des Todes.»
Dann zog sie ruhig, langsam, ohne Hast, den Dolch aus seinem Gürtel, und mit den Worten: «Hier, strenger Christengott, nimm meine Seele hin! So lös' ich das Gelübde», stieß sich die Römerin den scharfen Stahl ins Herz.
Cassiodor, ein kleines Kreuz von geweihtem Zedernholz in der Hand, schritt betend, tief erschüttert—Tränen rieselten über das ehrwürdige Antlitz in den weißen Bart—von einer der drei Leichen zu der andern.
Und leise stimmten die frommen Frauen des Klosters, die Valeria begleitet hatten, zu feierlicher, einfacher Weise den Choral an:
Vis ac splendor seculorum,
Belli laus et flos amorum
Labefacta mox marcescunt:——
Dei laus et gratia sine
Aevi termino vel fine
In eternum perflorescunt.
(Bald in Asche muß vergehen,
Was wir stark, was lieblich sehen,
Aller Stolz und Schmuck der Zeit:——
Gottes Gnade sonder Wanken,
Gottes Liebe sonder Schranken
Walten fort in Ewigkeit.)
Allmählich hatte sich der Hain mit Kriegern gefüllt, die den Führern, darunter den Grafen Wisand und Markja, vermöge der Waffenruhe unbehindert, gefolgt waren.
Schweigend hatte Teja des weinenden Adalgoth Bericht mit angehört. Nun trat er an des Königs Leiche dicht heran.
Schweigend, ohne Träne, legte er die gepanzerte Rechte auf des Königs Wunde, beugte sich über ihn und flüsterte dem Toten zu: «Ich will's vollenden.»
Dann trat er zurück unter einen hochragenden Baum, der sich über einem vergessenen Grabhügel erhob, und sprach zu der kleinen Schar, die ehrfurchtsvoll, schicksalergriffen, schweigend, diese Stätte des Todes umgab:
«Gotische Männer: die Schlacht ist verloren. Und das Reich dazu. Wer unter euch zu Narses gehen, sich dem Kaiser unterwerfen will—ich halte keinen. Ich aber bin gewillt, fortzukämpfen bis ans Ende. Nicht um den Sieg: um freien Heldentod. Wer den mit mir teilen will, der bleibe. Ihr alle wollt es? Alle? Gut.»
Da fiel Hildebrand ein: «Der König ist gefallen. Die Goten können nicht, auch um zu sterben nicht, kämpfen ohne König. Athalarich:—Witichis:—Totila:—nur einer kann der vierte sein, der dieser edeln Dreizahl folgen darf—du Teja, unser größter Held.»
«Ja», sprach Teja, «ich will euer König sein. Nicht freudig leben, nur herrlich sterben sollt ihr unter mir. Still! Kein froher Ruf—kein Waffenlärm begrüße mich. Wer mich zum König will—der tue mir nach.»
Und er brach von dem Baum, unter dem er stand, einen schmalen Zweig und wand ihn um den Helm.
Und schweigend folgten alle seinem Beispiel.
Adalgoth, der ihm zunächst stand, flüsterte ihm zu: «O König Teja! Es sind Zypressenzweige—: geweihte Opfer kränzt man so!»
«Ja, mein Adalgoth, du sprichst Weissagung»—und er schwang das Schwert im Kreis über sein Haupt—«dem Tode geweiht».
«Nun hab' ich die denkwürdigste Schlacht zu
schildern und das hohe Heldentum des Mannes
der keinem der Heroen nachsieht:—des Teja.»
Prokop, Gotenkrieg IV. 35
Und rasch vollendeten sich nun des Gotenvolkes Geschicke. Der rollende Stein rollte dem Abgrund zu.—
Als Narses die Besinnung wiedergefunden und das inzwischen Beschlossene und Geschehene erfahren, befahl er sofort, Liberius zu verhaften und zur Verantwortung nach Byzanz zu schicken.
«Ich will nicht sagen», sprach er zu seinem Vertrauten, Basiliskos, «daß er die falsche Entscheidung getroffen.
Ich selbst hätte sie nicht anders getroffen. Aber aus andern Gründen. Er hat vor allem seinen Freund und dann auch jene Zehntausend retten wollen. Das war ein Fehler: man mußte sie opfern, wenn man Liberius war. Denn Liberius übersah nicht die Lage des Kriegs.
Liberius wußte nicht, wie Narses es weiß, daß, nach dieser Schlacht, das Gotenreich verloren ist—ob es schon hier bei Taginä oder etwa erst bei Neapolis vollends vernichtet wird, ist gleich: und nur deshalb konnte, mußte man jene Zehntausend retten.»
«Bei Neapolis? Aber warum nicht bei Rom? Gedenkst du der furchtbaren Wälle des Präfekten nicht? Warum werden sich die Goten nicht nach Rom werfen zu mondenlangem Widerstand?»
«Warum? Weil... weil es mit Rom eine eigene Bewandtnis hat—aber das wissen sowenig die Goten wie Liberius.
Und das darf noch lange nicht wissen—Cethegus. Also schweige. Wo ist der Stadtpräfekt von Rom?»
«Vorausgeeilt, um sofort, nach Ablauf des Waffenstillstandes, als der erste, die Verfolgung zu leiten.»
«Du hast doch gesorgt—?»
«Zweifle nicht! Er wollte mit seinen Isauriern allein aufbrechen: ich—d. h. Liberius auf meinen Rat—hab' ihm Alboin und die Langobarden beigegeben, und du weißt...»
«Ja», lächelte Narses, «meine Wölfe lassen ihn nicht aus den Augen.»
«Aber wie lange noch soll er—?»
«Solang ich ihn brauche. Nicht eine Stunde länger.
Also der junge königliche Wundertäter liegt auf seinem Schild? Nun mag Justinianus sich mit Recht ‹Goticus› nennen und wieder ruhig schlafen. Aber freilich, der schläft wohl nie mehr ruhig—der enttäuschte Witwer Theodoras.»
Die beiden Führer Teja und Narses hatten also das gleiche Urteil über das Gotenreich.
Es war verloren.
Bei Caprä und Taginä war die Blüte des Fußvolks gefallen, fünfundzwanzig Tausendschaften hatte Totila hier aufgestellt: nicht eine volle derselben ward gerettet, auch die beiden Flügel hatten Verluste gehabt, so waren es kaum zwanzig Tausendschaften, mit welchen König Teja eilig, zunächst auf der flaminischen Straße, nach Süden abzog.
Ihn mahnte zum Aufbruch auch der Hilferuf des kleinen Heeres von Herzog Guntharis und Graf Grippa, das von der zwiefachen Übermacht der zwischen Rom und Neapolis unter Armatus und Dorotheos gelandeten Byzantiner bedrängt war.
Und ihn zwang zur Eile die furchtbare Verfolgung, mit welcher Narses, nach Ablauf des Waffenstillstandes, gemäß seinem schrecklichen System der «wandelnden Mauer» drängte. Während die Langobarden und Cethegus rastlos nachsetzten, langsam gefolgt von Narses, breitete dieser nach links und rechts zwei furchtbare Flügel aus, die im Südwesten über das suburbicarische Tuscien hinaus bis an das tyrrhenische Meer, im Nordosten durch das Picenum bis an den jonischen Meerbusen langten und, wie sie von Norden nach Süden und von Westen nach Osten vordrangen, alles gotische Leben hinter sich ausgelöscht zurückließen.
Wesentlich erleichtert wurde dies Verfahren durch den nun ganz allgemeinen Abfall der Italier von der verlorenen gotischen Sache: der milde König, der sie dereinst gewonnen, war ersetzt worden durch einen düsteren Helden gefürchteten Namens; nicht Neigung zu dem Regiment von Byzanz, aber Furcht vor des Narses und des Kaisers Strenge, die jeden Italier, der es noch mit den Barbaren hielt, mit dem Tode bedrohten, zog rasch die Schwankenden herüber. Die Italier, die noch in König Tejas Heere dienten, verließen ihn und eilten zu Narses.
Noch viel häufiger als vor der Schlacht von Taginä wurden jetzt die Fälle, in welchen gotische Siedlungen von ihren italischen Nachbarn, oft von dem Hospes, der ein Drittel seines Gutes dem Goten hatte abtreten müssen, den «Romäern» verraten oder, wo die Italier in großer Überzahl waren, von diesen selbst ausgemordet, gefangen an die beiden Flotten des Narses, die «tyrrhenische» und die «jonische», abgeliefert wurden, die langsam im tyrrhenischen und im jonischen Meer an der Küste hinfuhren, den Vormarsch der Landheere begleitend und alle gefangenen Goten, Männer, Weiber und Kinder, mit sich schleppend.
Die Burgen und Städte, schwach besetzt, denn Totila hatte sein kleines Heer durch deren herangezogene Mannschaften verstärken müssen, fielen meist durch die Bevölkerung, die, wie nach Totilas Erhebung die kaiserlichen, so nun die gotischen Besatzungen überwältigten; so im späteren Verlauf des Krieges Naria, Spoletium, Perusium;—die wenigen, die widerstanden, wurden eingeschlossen.
So glich Narses einem gewaltigen Manne, der mit ausgebreiteten Armen durch einen engen Gang schreitet und alles, was sich hier bergen wollte, vor sich her schiebt; oder einem Fischer, der mit dem sperrenden Sacknetz bachaufwärts watet, hinter ihm bleibt kein Leben mehr.
Geängstet flüchteten alle Goten, die sich noch retten konnten, mit Weib und Kind vor der «eisernen Walze» des Narses, wenn sie heranrollte, von allen Seiten nach dem Heere des Königs, das bald eine größere Zahl von Unwehrfähigen als von Kriegern in seinem wandernden Lager barg.
Wieder waren die Ostgoten auf der «Völkerwanderung» begriffen, wie vor hundert Jahren; aber hinter ihnen nahte jetzt das eherne Netz des Narses, vor ihnen und der immer schmaler zulaufenden Halbinsel lag das Meer—und keine Schiffe zu rettender Flucht.
Und noch dazu verringerte eine unabweisbare Notwendigkeit die Zahl der wehrfähigen Goten in König Tejas Heer auf das furchtbarste.
Seit dem ersten Augenblick der begonnenen Verfolgung hatte sich Cethegus mit den Isauriern, mit seinen byzantinischen Truppen—sarazenischen und herulischen Reitern—und Alboin mit seinen Lanzenreitern an die Fersen der Abziehenden geheftet, sollte nicht die ohnehin langsame Bewegung des durch so viele Frauen, Kinder, Greise gehemmten Rückzugs völlig gehemmt werden, so mußte fast jede Nacht eine kleine Heldenschar geopfert werden, die an günstig gelegener Stelle halt machte und hier durch zähen, todeskühnen, hoffnungslosen Widerstand die Verfolger so lange hinhielt, bis das Hauptheer wieder großen Vorsprung gewonnen.
Dieses grausame, aber einzig ergreifbare Mittel mußte bald mit Aufopferung einer halben Tausendschaft, bald, wo die Verteidigungsstellung breitere Stirn hatte, mit noch größeren Opfern angewendet werden.
König Teja hatte es vor dem Aufbruch von «Spes bonorum» laut dem ganzen Heer verkündet: schweigend hatten die Männer das furchtbare Mittel gebilligt.
Und so ungestüm bewarben sich die «Todgeweihten» jeden Abend um diesen Ehrenposten, daß König Teja—feuchten Auges—das Los entscheiden ließ; er wollte keinen kränken durch Bevorzugung anderer. Denn die Goten, den sichern Untergang von Volk und Reich vor Augen, sehr viele Weib und Kind dem Narses verfallen wissend, drängten sich um die Wette zum Tode. So wurde dieser Rückzug eine Ehrenstraße gotischen Heldentums; jede Haltstelle fast ein Markstein todesmutiger Aufopferung.
So fielen als Führer dieser «Nachhut des Untergangs» der alte Haduswinth bei Nuceria Camellaria, der junge, pfeilkundige Gunthamund bei ad Fontes, der rasche Reiter Gudila bei ad Martis.
Aber es sollte diese Aufopferung und des Königs Feldherrnschaft nicht ohne Frucht bleiben für die Geschicke des Volkes.
Bei Fossatum, zwischen Tudera und Narnia, kam es zu einem Nachtgefecht mit der Nachhut unter dem tapfern Grafen Markja, das vom Nachmittag, da sie die Reiter des Cethegus erreicht hatten, angefangen bis zum Sonnenaufgang währte. Als endlich das wiederkehrende Licht die rasch aufgeworfenen Erdschanzen der Goten beleuchtete, war es auf diesen grabesstill. Die Verfolger rückten mit äußerster Vorsicht an: endlich sprang Cethegus vom Pferd und auf die Brüstung der Schanze, hinter ihm Syphax.
Da winkte Cethegus hinab. «Kommt nach, es hat keine Gefahr! Ihr habt nur hinwegzuschreiten über die Feinde; denn hier liegen sie tot: alle tausend, dort auch Graf Markja, ich kenne ihn.»
Als aber nun die Reiter, nachdem die Schanzen hinweggeräumt waren, dem abgezogenen Hauptheer, das sehr großen, weiteren Vorsprung gewonnen, nachjagten—Cethegus führte sie—, erfuhren sie alsbald von den Bauern, daß das gotische Hauptheer hier, auf der flaminischen Straße, nicht vorübergezogen war.
Durch das edelste Opfer war es erkauft, daß König Teja seines Rückzugs weitere Richtung von hier ab auf geraume Zeit verschleiert hatte: die Verfolger hatten alle Fühlung mit ihm verloren. Cethegus riet Johannes, einen Teil der Seinen zur Rechten nach Südosten, Alboin dagegen zur Linken der flaminischen Straße nach Nordosten verfolgen zu lassen, um die Spur wieder aufzufinden.
Ihn selbst aber zog es gewaltig nach Rom: er hoffte die Stadt vor Narses, ohne Narses zu erreichen, zu gewinnen und dann, vom Kapitol herab, ihm wie Belisar Schach zu bieten. Nach der Entdeckung, daß sich König Teja der Verfolgung entzogen habe, berief Cethegus seine vertrauten Tribunen und eröffnete ihnen, er sei entschlossen, nun, nötigenfalls mit Gewalt, der steten Beaufsichtigung durch Alboin und Johannes sich zu entziehen, die er durch die angeratenen Entsendungen geschwächt wußte, und mit seinen Isauriern allein nach Rom zu eilen, geradewegs auf der Flaminia, die ja nun von den Goten nicht gesperrt war.
Aber während er sprach, führte Syphax eilfertig einen römischen Bürger ins Zelt, den er mit Mühe aus den Händen der Langobarden gelöst: jener hatte nach dem Präfekten gefragt, und sie hatten ihn «behandeln wollen wie gewöhnlich», hatten sie gelacht. «Vom Rücken her aber», fügte Syphax bei, «naht ein großer Zug—ich spähe danach und berichte dir wieder.»
«Ich kenne dich, Tullus Faber», sprach der Präfekt, «du warst immer Rom und mir getreu. Was bringst du?»
«O Präfekt», klagte der Mann, «weil du nur noch lebst! Wir alle glaubten, du seiest tot, da du auf acht Botschaften uns keinen Bescheid gabst.»
«Ich habe nicht eine erhalten.»
«So weißt du nicht, was in Rom geschehen? Papst Silverius ist auf Sizilien in Verbannung gestorben. Der neue Papst ist Pelagius, dein Feind.»
«Nichts weiß ich. Rede!»
«O so wirst auch du nicht raten noch helfen können. Rom hat...»
Da trat Syphax ein, aber ehe er noch sprechen konnte, erschien im Zelt des Präfekten Narses, gestützt auf des Basiliskos Arm. «Ihr habt euch ja so lange hier aufhalten lassen von tausend gotischen Speeren», zürnte der Feldherr, «bis euch die Gesunden entkommen sind und die Kranken euch einholen konnten. Dieser König Teja kann mehr als Schilde brechen: er kann Schleier weben vor des Präfekten scharfen Augen.
Aber ich sehe durch viele Schleier, auch durch diesen.
Johannes, rufe deine Leute zurück: er kann nicht nach Süden, er muß nach Norden ausgewichen sein. Denn er weißt jetzt wohl schon lang, was den Präfekten von Rom zumeist angeht: Rom ist den Goten entrissen.»
Des Cethegus Auge leuchtete.
«Ich habe einige kluge Leute hineingeschmuggelt gehabt.
Sie trieben die Bewohner zu rascher, mächtiger Erhebung: alle Goten in der Stadt wurden erschlagen: nur fünfhundert Mann entkamen in das Grabmal Hadrians und halten es besetzt.»
«Wir haben acht Boten an dich gesandt, Präfekt», fand Faber Mut, einzuwerfen.
«Hinaus mit diesem Menschen», winkte Narses. «Ja, die Bürger Roms erinnerten sich in Liebe wieder des Präfekten, dem sie so viel verdanken: zwei Belagerungen, Hunger, Pest und Brand des Kapitols! Aber die an dich gesendeten Boten verirrten sich immer zu meinen Wölflein, und diese haben sie wohl zerrissen. An mich jedoch gelangte die Gesandtschaft, die der heilige Vater Pelagius abgeordnet hat; und ich habe mit ihm einen Vertrag geschlossen, den du, o Stadtpräfekt von Rom, gewiß gutheißen wirst.»
«Ich werde ihn nicht auflösen können.»
«Die guten Bürger Roms scheuen nichts so sehr als eine dritte Belagerung; sie haben sich erbeten, wir möchten nichts unternehmen, was zu einem neuen Kampf um ihre Stadt führen könnte, die Goten im Grabmal Hadrians müßten, schreiben sie, bald dem Hunger erliegen, und ihre Wälle wollten sie selbst decken, und sie haben geschworen, nach jener Gotenschar Untergang die Stadt nur zu übergeben ihrem natürlichen Beschützer und Haupt: dem Stadtpräfekten von Rom. Bist du damit zufrieden, Cethegus? Lies den Vertrag—gib ihn ihm, Basiliskos.»
Cethegus las in tiefer, freudiger Erregung; so hatten sie ihn doch nicht vergessen, seine Römer! So riefen sie doch nun, da alles zur Entscheidung drängte, nicht die gehaßten Byzantiner, sondern ihn, ihren Schirmherrn, zurück aufs Kapitol. Schon sah er sich wieder auf dem Gipfel der Macht.
«Ich bin's zufrieden», sagte er, die Rolle zurückgebend.
«Ich habe gelobt», sprach Narses, «keinen Versuch zu machen, die Stadt mit Gewalt in meine Hand zu bringen: erst muß König Teja dem König Totila nachgefolgt sein.
Dann Rom und—manches andre. Folge mir, Präfekt, in den Kriegsrat.»
Als Cethegus die Beratung in dem Zelt des Narses verließ und nach Tullus Faber forschte, war jede Spur von diesem verschwunden.
Scharf hatte der große Feldherr Narses die Wegrichtung erkannt, auf welcher König Teja von der flaminischen Straße abgebogen war.
Nach Norden zunächst, nach der Küste des jonischen Busens, war er ausgewichen und führte hier, mit seltner Wegeskunde, auf vielfach gewundenen Pfaden, sein flüchtendes Volk und Heer unbehelligt, unerreicht von den Verfolgern, über Hadria, Aternum, Ortona nach Samnium: daß Rom für ihn verloren, erfuhr er durch einzelne aus der Stadt geflohene Goten schon hinter Nuceria Camellaria.
Nicht unerwünscht kam des Königs rasch zum Ende drängendem und schonungslosem Sinn die Nötigung, sich seiner Gefangenen zu entledigen: diese, an Zahl fast halb so stark als ihre Besieger, hatten die Überwachung so schwierig gemacht, daß Teja jeden Befreiungsversuch mit dem Tode bedrohen mußte. Hinter Fossatum bei der Nordschwenkung machten sie trotzdem einen Versuch, massenhaft mit Gewalt loszubrechen.
Sehr viele wurden bei dem Unternehmen getötet: alle, die übriggeblieben waren, mit Orestes und sämtlichen Führern, ließ der König bei dem Übergang über den Aternus mit gebundenen Händen in den Fluß werfen und ertränken.
Auf Adalgoths Fürbitte hatte er finster erwidert: «Zu vielen Tausenden haben sie wehrlose Goten-Weiber und -Kinder an ihren Herdfeuern überfallen und geschlachtet: das ist kein Krieg der Krieger mehr: das ist ein Mordkampf der Völker. Laß uns darin—halbwegs—auch das unsre tun.»
Aus Samnium eilte der König, das unwehrhafte Volk langsam unter schwacher Bedeckung nach sich führend—denn hier drohte keine Verfolgung—mit den besten Truppen rasch nach Campanien. So unerwartet traf er hier ein, daß er das kleine, durch die bisherigen Gefechte mit der Überzahl zusammengeschmolzene Heer von Herzog Guntharis und Graf Grippa—er traf sie in fester Stellung zwischen Neapolis und Beneventum—fast ebenso überraschte, wie bald darauf die siegessichern Gegner.
Er erfuhr, daß die «Romäer», von Capua aus, Cumä bedrohten. «Nein», rief er, «diese Burg sollen sie nicht vor mir erreichen. Dort hab' ich noch ein wichtig Werk zu vollenden.»
Und verstärkt durch die Besatzung aus seiner eignen Grafenstadt Tarentum, unter dem tapfern Ragnaris, griff er die Übermacht der Byzantiner, die auf geheimem Marsche von Capua aus Cumä überrumpeln wollten, sie selbst aufs höchste überraschend, an und schlug sie unter blutigen Verlusten grimmig aufs Haupt; er spaltete mit der Streitaxt dem Archonten Armatus die Stirn; an seiner Seite durchrannte der junge Herzog von Apulien den Dorotheos mit dem Speer. Entsetzt flohen die Byzantiner gen Norden bis nach Terracina.
Es war der letzte Sonnenkuß, den der Siegesgott auf die blaue Gotenfahne legte. Tags darauf zog König Teja in Cumä ein.
Totila hatte, auf sein ernstes Andringen, sich entschlossen, bei dem diesmaligen allentscheidenden Auszug von Rom, gegen seine Gewohnheit, für die Treue der Stadt Rom Geiseln zu nehmen. Niemand wußte, wohin diese gebracht worden.
Am Abend seines Einzugs ließ König Teja den zugemauerten Garten des Kastells zu Cumä aufbrechen; hier waren, hinter turmhohen Wällen, die Geiseln Roms geborgen: Patrizier, Senatoren—darunter Maximus, Cyprianus, Opilio, Rusticus, Fidelius: die angesehensten Männer des Senats—im ganzen dreihundert an der Zahl. Sie waren alle Glieder des alten Bundes der Katakomben wider die Goten.
Teja ließ ihnen von den aus Rom entwichenen Goten berichten, wie die Römer, verführt von Sendlingen des Narses, sich in einer Nacht plötzlich erhoben, alle Goten, auch Weiber und Kinder, deren sie habhaft werden konnten, ermordet und den Rest in die Moles Hadriani zusammengedrängt hatten.
So furchtbar war der Blick des Königs, den er auf den zitternden Geiseln während dieser Erzählung ruhen ließ, daß zwei derselben das Ende abzuwarten nicht ertrugen, sondern sich sofort an den harten Felswällen die Köpfe einrannten.
Nachdem die Boten eidlich ihre Erzählung bekräftigt hatten, wandte sich der König schweigend und schritt aus dem Garten. Eine Stunde darauf starrten die Köpfe der dreihundert Geiseln gräßlich von den Mauerzinnen herab.
«Aber nicht bloß dies furchtbare Richteramt zog mich nach Cumä», sprach Teja zu Adalgoth. «Es gilt, hier noch ein heiliges Geheimnis zu erheben.»
Und er lud ihn, sowie die anderen Führer des Heeres, zum fest- und freudelosen Nachtmal. Als das traurige Gelage zu Ende, winkte der König dem alten Hildebrand. Dieser nickte, hob eine düster brennende Pechfackel aus dem Eisenring der Mittelsäule der gewölbten Halle und sprach:
«Folgt mir nach, ihr Kinder junger Tage, nehmt eure Schilde und eure Schwerter mit.»
Es war die dritte Stunde der Julinacht, die Sterne standen in der Mitternacht.
Da schritten aus der Halle, schweigend dem König und dem urgrauen Waffenmeister folgend, Guntharis und Adalgoth, Aligern, Grippa, Ragnaris und Wisand, der Bandalarius: Wachis, des Königs Schildträger, schloß den Zug mit einer zweiten Fackel.
Gegenüber dem Schloßgarten erhob sich ein riesiger Rundturm, «der Turm Theoderichs» genannt, weil ihn dieser große König neu verstärkt hatte. In dieses Turmgebäude leuchtete und schritt voran der alte Hildebrand.
Aber anstatt nun von dem Erdgeschoß aus, das nur die leere Turmstube zeigte, die hohe Treppe emporzusteigen, machte der Alte halt. Er kniete nieder, und vorsichtig messend spannte er mit der gewaltigen Hand auf dem Boden von der sorgfältig wieder geschlossenen Türe an nach der Mitte fünfzehn Handspannen—der ganze Boden schien aus drei kolossalen Granitplatten zusammengelegt—. Auf der fünfzehnten Spanne hielt er den linken Daumen an und schlug mit der Steinaxt auf die Platte: da klang es hohl: und in eine schmale, kaum sichtbare Ritze des Gesteins die Spitze der Axt bohrend hieß er alle Mann hinter sich zur Linken treten. Als dies geschehn, schob er die Steinplatte nach rechts vor; schwarz, turmhoch, wie das Gebäude über dem Erdgeschoß sich erhob, senkte es sich hier hügeltief in die Erde.
Nur um einen Mann knapp hindurchzulassen, gewährte die Öffnung Raum; sie führte auf eine schmale, in den Fels gehauene Treppe von mehr als zweihundert Stufen.
Schweigend stiegen die Männer hinab. Unten angelangt fanden sie den entsprechenden Kreisraum durch eine Steinmauer in zwei Halbkreise geteilt. Der von ihnen betretene Halbkreis war leer.
Und nun maß König Teja von der Erde auf zehn Handbreiten an der Mauer. Hier drückte er an einen Stein: eine schmale Pforte tat sich nach innen auf. Der alte Hildebrand atmete tief, trat vorleuchtend ein, und der König und jener entzündeten zwei in die Wand eingesteckte große Fackeln.
Da fuhren die übrigen glanzgeblendet zurück und bedeckten die Augen. Als sie wieder aufblickten, gewahrten sie—sofort erkannten die gotischen Männer das Geheimnis—den ganzen reichen Amalungenhort Dietrichs von Bern.
Da lagen, teils zierlich gehäuft, teils ordnungslos nebeneinander geschüttet, Waffen, Gerät und Schmuck aller Art. Die Sturmhaube von Bronze aus altetruskischer Zeit, in grauen Vorzeittagen durch den Handel den Goten bis an die Ostsee oder an den Pruth und Dniester zugeführt und nun von dem nach Süden ziehenden Wandervolk wieder zurückgebracht, nahe an die Stätte vielleicht, wo sie gehämmert worden; daneben das Fell des Seehunds und der Rachen des Eisbären über einen flachen Kopfschirm von Holz gespannt: keltische Spitzhelme; stolzgeschweifte römische und byzantinische Helmkämme, Halsringe von Bronze und von Eisen, von Silber und von Gold; Schilde, von dem ungefügen, mannshohen Holzschild, der, aufgestellt wie eine Mauer, den Pfeilschützen barg, bis zu dem zierlichen, mit Edelsteinen und Perlen übersäten, runden, kleinen Reiterschild der Parther; neben altertümlichen Kettenringen von erdrückender Schwere, leichte Harnische von purpurfarbenem Linnengewebe, dazu Frameen, Schwerter, Dolche von Stein, von Bronze und von Eisen; Beile und Keulen, zum Teil noch aus dem Knochen des Mammut, roh, mit Bast umwunden und in ein Hirschgeweih gesteckt, bis zu der fränkischen Franziska und dem zierlich durchbrochenen, kleinen, vergoldeten Wurfbeil, mit welchem ein aufgesteckter Apfel von römischen Zirkusreitern im Galopp gespalten werden mußte; Speere, Lanzen, Wurfspieße aller Art: von dem kaum behauenen Stoßzahn des Narwal bis zu dem goldeingelegten Ebenholzschaft der asdingischen Vandalenkönige in Karthago und dem massiv goldnen Wurfpfeil dieser Fürsten mit dem Purpurgefieder des Flamingo am Schaft und der fußlangen Stahlspitze: Kriegsmäntel aus dem Pelz des blauen Fuchses bis zu dem Fell des numidischen Löwen und dem kostbarsten Purpur von Sidon; Schuhe, von den langen, schaufelähnliche Schneeschuhen der Skritofinnen bis zu den Goldsandalen von Byzanz; Wämser von friesischer Wolle und Tuniken von chinesischer Seide, dazu ungezähltes Gerät und Tafelgeschirr: hohe Krüge, flache Schalen, runde Becher, bauchige Urnen, von Bernstein, von Gold, von Silber, von Schildpatt, Armringe und Schulterspangen, Schnüre von Bergkristallen und von Perlen, und noch sonst unerschöpflich mannigfaltiges Geschirr für Speise und Trank, Gerät für Kleidung und Schmuck, für Spiel und Kampf.
«Ja», sprach König Teja, «diese geheime Höhle, nur uns, den Blutsbrüdern bekannt—der Waffenmeister hatte sie in den Fels hauen lassen, als er vor vierzig Jahren Graf von Cumä war—sie war das Schatzgewölbe, das den Hort der Goten barg.
Deshalb fand Belisarius so wenig vor, als er den Schatz zu Ravenna erbeutete. Die edelsten und kostbarsten Stücke der Beute und der Geschenke, die Sammlung der Amalungenehren in Krieg und Frieden, die weit über Theoderich hinauf zu Winithar, Ermanarich, Athal, Ostrogotho, Isarna bis Amala emporsteigen—sie haben wir hier geborgen. Nur das gemünzte Gold hatten wir in Ravenna behalten und solches Gerät, das reicher an Goldwert als an Ehren schien.
Monatelang sind die Feinde über diese Schätze hingeschritten, doch es schwieg die treue Tiefe des Abgrunds.
Nun aber tragen wir sie alle mit uns—in eure breiten Schilde schöpfet sie und reichet sie, die Staffeln herauf, einer dem andern—in das letzte Schlachtfeld, darauf ein ostgotisches Volksheer kämpfen wird—nein, bange nicht, jung Adalgoth, auch wenn ich gefallen bin und alles verloren ist—: nicht sollen die heiligen Schätze der Ehre die Feinde nach Byzanz schleppen.
Denn wunderbar ist das letzte Schlachtfeld, das ich uns erkoren. Es soll die letzten Goten und ihre Schätze und ihren Rum verschlingen und verbergen.»
«Ja, auch ihren höchsten Schatz und Ruhm», sprach der alte Hildebrand, «nicht nur Gold und Silber und edle Steine. Sehet her, meine Goten!»
Und er leuchtete in den von einem Vorhang abgesperrten Schlußraum des Halbkreises und schob den Vorhang zur Seite.
Da fielen alle andern ehrfürchtig auf die Knie.
Denn sie erkannten den großen Toten, der da hoch aufgerichtet auf dem goldnen Throne saß, den Speer noch in der Rechten, vom Purpurmantel umwallt.
Es war der große Theoderich.
Und die von den Ägyptern zu den Römern gewanderte Kunst, die Leichen wundersam zu wahren, hatte den Heldenkönig in schauerlicher Leibhaftigkeit erhalten.
Tiefste Erschütterung band den Männern die Rede.
«Schon seit langer Zeit», hob endlich Hildebrand an, «mißtrauten Teja und ich dem Stern der Goten. Und ich, der ich vor Ausbruch des Krieges die Ehrenwache an dem Marmor-Rundhaus zu Ravenna hatte, in welchem Amalaswintha ihren toten Vater beigesetzt—ich liebte das ganze Gebäude wenig, und weniger noch die weihrauchqualmenden Priester, die dort so oft für des Gewalt'gen große Seele beten wollten.
Und ich dachte: wenn unsere Spur dereinst getilgt wird aus diesem Südland, sollen nicht Welsche und Griechlein ihr Gespött treiben mit den Gebeinen des teuren Helden.
Nein, wie jener erste Bezwinger der Romaburg, wie der Westgote Alarich im heiligen Strombett sein von keinem gekanntes, von keinem zu schändendes Grab gefunden,—so soll auch mein großer König entrückt sein der Nachspürung der Menschen.
Und mit Tejas Hilfe schaffte ich, in dunkler Nacht, die edle Leiche hinweg aus dem Marmorhaus und aus der winselnden Priester Umgebung, und wir brachten sie, als ein Stück des Königsschatzes, in verschlossener Truhe hierher. Hier war er sicher geborgen, und fand ihn nach Jahrhunderten ein Zufall, wer konnte dann noch ihn erkennen, den König mit dem Adlerauge?
Und so ist der Steinsarkophag zu Ravenna leer, und die Mönche singen und beten dort umsonst.
Hier, bei allen seinen Schätzen und Ehren, in Heldenherrlichkeit, aufrecht thronend, sollte er ruhen—: das wird seiner Seele, die von Walhall niederschaut, lieber sein, als ausgestreckt, unter schwerem Stein, unter Weihrauchwolken, sich liegen zu sehen.»
«Nun aber», schloß Teja, «ist auch für ihn, wie für den Amalungenhort die Stunde gekommen, noch einmal aufzusteigen aus der Tiefe; wenn ihr die Schätze gehoben, heben wir sorgsam auch den teuren Heldenleib empor. Und morgen früh brechen wir alle auf aus dieser Stadt,—schon wird des Narses und des Präfekten Anrücken gemeldet—und ziehen mit Königshort und Königsleiche auf jenes letzte Schlachtfeld der Goten, wohin ich auch schon die Weiber und Kinder entboten habe: jenes Schlachtfeld—seit lange habe ich's geschaut in schlummerlosem Traumgesicht—jenes Schlachtfeld, das uns und unser Volk sieht glorreich untergehen; jenes Schlachtfeld, das, auch nachdem der letzte Speer gebrochen, alle Tod-Entschlossenen rettend, bergend aufnehmen kann in seinen glühenden Schoß:—das Schlachtfeld, das Teja sich und euch erkoren.»
«Ich ahne», fiel Adalgoth ein. «Dies, unser Schlachtfeld heißt...»
«Mons Vesuvius!» sprach Teja. «Ans Werk!»
So rasch, als es sein furchtbares Umklafterungssystem verstattete, war Narses nach jenem Kriegsrat bei Fossatum mit seiner ganzen Macht und in breitester Stirnlinie nach Süden hinabgezogen, die Reste gotischen Lebens zu erdrücken oder ins Meer zu werfen.
Nach Tuscien nur entsandte er, um die dort noch widerstrebenden Burgen zu brechen, dann Lucca im annonarischen Tuscien, mit geringer Macht seine Heerführer Vitalianus und den Heruler Wilmuth, und noch weiter hinauf gen Norden wider das immer noch unbezwungene Verona, dessen Ausdauer den Goten das Entkommen durch das Tal der Athesis hinauf bis an die Passara wesentlich erleichtert hatte, Valerianus, welcher einstweilen auch Petra pertusa, das oberhalb Helvillum die flaminische Straße gesperrt, bezwungen hatte.
Mit allen andern Truppen eilte er nach Süden, er selbst auf der flaminischen Straße an Rom vorbei, indes Johannes an dem tyrrhenischen Meere hin, der Heruler Vulkaris an der Küste des jonischen Busens die Goten vor sich her drängen sollten.
Beide fanden aber wenig Arbeit und Aufenthalt mehr; denn im Norden waren die gotischen Familien ohnehin von dem vorauseilenden Heere des Königs aufgenommen worden, das Vulkaris nicht mehr einzuholen vermochte; und aus dem Süden waren ebenfalls die Goten längst aufgescheucht über Rom hinaus gen Neapolis geströmt, wohin sie eilende Sajonen, fliegende Boten des Königs, beschieden.
«Mons Vesuvius!» bildete das ausgegebene Sammelwort für alle diese gotischen Flüchtlinge.
Narses hatte seinen beiden Flügeln Anagnia als Ort der Wiedervereinigung vorgeschrieben.
Gern folge Cethegus der Einladung des Narses, bei ihm und dem Hauptheer zu bleiben; auf beiden Flügeln waren keine großen Ereignisse zu erwarten.
Und der Weg des Narses führte ja über Rom!
Für den Fall, daß Narses, trotz seinem Versprechen, einen Versuch machen sollte, im Vorüberziehen sich Eingang in Rom zu verschaffen, war dann auch Cethegus an Ort und Stelle. Aber fast zu des Präfekten Erstaunen hielt Narses Wort. Er zog mit seinem Heer ruhig an Rom vorüber.
Und er forderte Cethegus auf, Zeuge seiner Unterredung mit dem Papst Pelagius und den übrigen beherrschenden Personen in Rom zu sein, welche Zwiesprache er die Wälle hinan, zwischen dem flaminischen und dem salarischen Tor, an der Porta belisaria (pinciana) hielt.
Noch einmal versicherten der Papst und die Römer unter feierlichen Eiden auf die Gebeine der Heiligen Kosma und Damian (nach der Legende arabische Ärzte, Zwillingsbrüder, die unter Diokletian als Märtyrer gestorben sein sollten), die sie in elfenbeinernen Truhen und Silbersärgen auf die Wälle gebracht hatten, daß sie unweigerlich nach Vernichtung der Goten in der Moles Hadriani, dem Präfekten von Rom allein ihre Tore erschließen, jeden Versuch aber, gewaltsam in die Stadt zu dringen, mit Gewalt abwehren würden; denn sie wollten sich keinem der Kämpfe aussetzen, die etwa noch um Rom entbrennen könnten.
Das Anerbieten des Narses, ihnen jetzt schon ein paar tausend Mann zur rascheren Bewältigung der Moles Hadriani zu überlassen, wiesen die Römer höflich aber bestimmt ab: zur hohen Freude des Präfekten.
«Sie haben doch schon zwei Dinge gelernt in diesen Jahren», sagte er im Abreiten zu Lucius Licinius, «sich die ‹Romäer› fern vom Leibe halten und Cethegus mit dem Heile Roms verknüpfen. Das ist schon viel.»
«Mein Feldherr», warnte Licinius, «ich kann deine Freude, deine Zuversicht nicht teilen»—«Ich auch nicht», stimmte Salvius Julianus bei. «Ich fürchte Narses. Ich mißtraue ihm.»—«Ach, ihr Allklugen», spottete Piso. «Man muß nichts übertreiben, auch die Vorsicht nicht und den Zweifel. Hat sich nicht alles gewendet, wie wir's kaum zu hoffen gewagt, seit jener Nacht, da ein grober Hirtenjunge dem besten Dichter Roms über die unsterbliche Jambenhand schlug? Da der gewaltige Präfekt von Rom in einem Getreidehaufen tiberabwärts schwamm? Da Massurius Sabinus in den coischen Gewändern seiner Hetäre, in denen er entrinnen wollte, von Graf Markja erkannt und gefangen und da der große Rechtskenner Salvius Julianus blutend von dem unsanften Herzog Guntharis aus dem Schlamm des Flusses hervorgefischt wurde? Wer hätte damals gedacht, daß wir noch mal die Tage an den Fingern abzählen würden, da noch ein Gote zwei Beine auf italischen Erdgrund stellt?»
«Du hast recht, Poet», lächelte Cethegus. «Jene beiden leiden an dem Narses-Fieber, wie ihr Heros an der Epilepsie. Seine Feinde überschätzen ist auch ein Fehler. Die Gebeine, auf die jene Priester schworen, sind ihnen wirklich heilig; sie brechen solche Eide nicht.»
«Wenn ich nur», erwiderte Licinius besorgt, «neben den Priestern und Handwerkern noch irgendeinen deiner, unserer Freunde auf den Wällen gesehen hätte! Aber lauter Walker, Fleischer und Zimmerleute! Wo ist der Adel Roms, wo die Männer der Katakomben?»
«Als Geiseln fortgeführt», sprach Cethegus. «Und recht geschah ihnen, sie kehrten ja noch Rom zurück und huldigten dem blonden Goten. Wenn ihnen nun der schwarze Gote die Köpfe abschlägt, müssen sie's haben. Getrost, ihr habt zu düster gesehen, alle! Des Narses erdrückende Übermacht hat euch eingeschüchtert. Er ist ein großer Feldherr, aber, daß er diesen Vertrag mit Rom geschlossen—mich und ja keinen andern einzulassen!—und daß er ihn hält—das zeigt, daß er als Staatsmann ungefährlich ist. Laßt uns nur erst wieder die Luft des Kapitols atmen, Epileptiker vertragen sie nicht.»
Und als am andern Morgen die jungen Tribunen den Präfekten von seinem Zelt abholten zum allgemeinen Aufbruch gegen Teja, empfing sie ihr Führer mit strahlenden Augen.
«Nun», sprach er, «wer kennt nun die Römer, ihr oder der Stadtpräfekt von Rom? Hört—aber schweigt.—Heute Nacht stahl sich aus Rom in mein Zelt ein Centurio der neu errichteten Stadtkohorten, Publius Macer: ihm ist die Porta Latina, seinem Bruder Marcus das Kapitol anvertraut vom Papst. Er zeigte beide Bestallungen, ich kenne des Pelagius Schrift—sie sind echt.
Sie sind längst der Priesterherrschaft müde.
Sie wollen mich und euch und meine Isaurier gern wieder schreiten sehen auf den Mauern Aurelians und des Präfekten. Er ließ mir seinen Neffen Aulus, zugleich als Pfand und als Geisel zurück: dieser wird uns, von ihm in verabredetem, harmlosem Briefwort gemahnt, die Nacht bezeichnen, da jene uns das Tor und das Kapitol erschließen. Narses kann sich nicht beklagen, wenn uns die Römer selbst freiwillig einlassen:—ich versuche ja nicht Gewalt. Nun, Licinius, sprich Julianus, wer kennt nun Rom und die Römer?»
Narses zog jetzt auf Anagnia.
Zwei Tage nach seiner Ankunft trafen, wie ihnen vorgeschrieben war, die beiden Flügelheere daselbst ein.
Nach einigen Tagen der gemeinsamen Erholung, Musterung und Neugliederung seiner ungeheuren Massen zog der Feldherr nach Terracina, wo die Reste der Truppen des Armatus und Dorotheos sich anschlossen, und alsbald wälzte sich nun das vereinigte Heer gegen die Goten, die, südlich von Neapolis, auf dem Vesuvius (bei Nuceria) gegenüberliegenden Mons Lactarius, dem Milchberg, an beiden Ufern des kleinen Flusses Draco (der sich nördlich von Stabiä ins Meer ergießt), eine ausgezeichnet feste Stellung innehatten.
Seit dem Abmarsch von Cumä, an Neapolis vorbei (—die Bürger dieser Stadt schlossen ihre von Totila vortrefflich wieder hergestellten Tore, überwältigten die drei gotischen Hundertschaften der Besatzung und erklärten: sie würden dem Beispiel Roms folgend, ihre Feste vorläufig beiden Parteien verschlossen halten—) und seit der Erreichung des längst gewählten Schlachtfeldes hatte König Teja alles aufgeboten, die von Natur aus so starke Stellung noch mehr zu verstärken. Und überall hatte er Lebensmittel aus der strotzend reichen Landschaft nach dem Berge schaffen lassen, ausreichend, um sein Volk so lang zu nähren, bis der letzte Tag der Goten leuchten sollte.
Es ist ein vergebliches Bemühen gelehrter Untersuchungen geblieben, an dem Mons Lactarius oder an dem Vesuvius eine Örtlichkeit zu finden, die ganz genau der Beschreibung Prokops entspräche. Für keine der zahlreichen aufgestellten Schluchten oder Pässe kann man sich entscheiden. Gleichwohl darf man um deswillen keineswegs den auf die Aussagen der Augenzeugen, der Heerführer und Doryphoren des Narses, gestützten Bericht des byzantinischen Geschichtsschreibers bezweifeln. Vielmehr erklärt sich diese Nichtübereinstimmung sehr einfach aus den plötzlichen großen, gewaltsamen und aus den noch viel zahlreicheren allmählichen, kleineren durch Lavafluß, Felssturz, Zermürbung und Auswaschung bewirkten Veränderungen, die eine Zeit von mehr als dreizehn Jahrhunderten an jenem niemals ruhenden Berge vorgenommen. Lassen sich doch glaubhafte Angaben viel späterer italienischer Schriftsteller über die Örtlichkeiten und Maßverhältnisse viel jüngerer Zeiten am Vesuvius mit der dermaligen Wirklichkeit oft nicht mehr vereinbaren. Der Boden, der Herzblut aufgesogen, ist wohl lange schon von tiefen Lavaschichten befriedend überdeckt.
Selbst Narses bewunderte die Umsicht, mit welcher sein barbarischer Gegner diese Verteidigungsstellung gewählt.
«Er will fallen wie der Bär in der Höhle!» sprach er, als er, von Nuceria aus, vom Norden her, in seiner Sänfte die ganze gotische Umwallung betrachtete. «Und mancher von euch, liebe Wölflein», lächelte er Alboin zu, «wird von dem Schlag seiner Pranke umtaumeln, wann sie in jenen schmalen Höhleneingang eintraben.»
«Ei, es müssen gleich so viele auf einmal hineinrennen, daß er aufs erstemal beide Pranken voll bekommt und nicht nochmal ausholen kann.»
«Nur gemach, ich weiß an jenem Vesuv einen Paß—früher, da ich noch auf diesen elenden Leib mit Heilungshoffnungen Pflege wandte, habe ich 'mal wochenlang auf dem Mons Lactarius die ‹Luftheilung› gebraucht und dabei den Paß mir sehr wohl eingeprägt—wenn sie darinnen stecken—treibt sie nur der Hunger heraus.»
«Das wird langweilig.»
«Geht aber nicht anders. Ich habe nicht Lust, nochmal eine Myriade kaiserlicher Truppen zu opfern, diese letzten Funken auszutreten.»—
Und so geschah's. Sechzig Tage noch standen sich seit dem Eintreffen des Narses beide Heere einander gegenüber. Ganz allmählich, mit blutigen Verlusten jeden Schritt erkämpfend, schnürte Narses sein erwürgendes Netz enger und enger.
Er deckte im Halbkreis alle Punkte im Westen, Norden und Osten der gotischen Stellung; nur den Süden, das Meer, an dessen Strand er selbst lagerte, konnte er, neben seinen Zelten, offen lassen, da die Feinde keine Schiffe hatten, zu fliehen oder sich Vorräte zu schaffen: die «tyrrhenische» Flotte des Narses war schon beschäftigt, die gefangenen Goten nach Byzanz zu tragen. Die «jonische» wurde demnächst erwartet. Einige ihrer Schiffe waren früher schon abgeordnet worden, in der Bucht von Bajä bis Surrentum zu kreuzen; gotische Segel gab es nicht mehr, nachdem die letzten von ihren Führern den Feinden übergeben waren.
So besetzte Narses, mit zäher Geduld, trotz seiner Übermacht, nichts übersehend, allmählich Piscinula, Cimiterium, Nola, Summa, Melane, Nuceria, Stabiä, Cumä, Bajä, Misenum, Puteoli, Nesis.
Alsbald aber erschrak nun auch Neapolis vor der Macht der Narses und öffnete ihm freiwillig die Tore.
Von allen Seiten rückten die Byzantiner gegen die rings Umschlossenen vor.
Nach heftigen Kämpfen gelang es, diese von dem Mons Lactarius hinweg auf die rechte Seite des Flusses Draco zu drängen, wo der Rest des Volkes hinter dem unvergleichlichen, von Narses gepriesenen Engpaß auf einem Hochfeld nahe einem der zahlreichen damaligen Nebenkrater der Mittelhöhe lagerte, nur selten, bei der Windrichtung aus Südost, unter dem Rauch und den Dünsten des Berges leidend.
Hier, in den zahlreichen Klüften, Höhlungen, Einsenkungen des Berges, lagerten in der warmen Luft des August unter freiem Himmel oder luftigen Zelten die Unwehrhaften auf den mitgeführten Wagen.
Den einzigen Zugang aber zu dieser Lagerung bildete ein enger Felsenpaß, an seiner Südöffnung so schmal, daß ihn ein Mann mit dem Schilde bequem ausfüllen konnte.
Diesen Zugang, bewachten, abwechselnd, je eine Stunde, Tag und Nacht, König Teja selbst, Herzog Guntharis, Herzog Adalgoth, Graf Grippa, Graf Wisand, Aligern, Ragnaris und Wachis: hinter ihnen füllte den Engpaß, ebenfalls wechselnd, eine gotische Hundertschaft.
Und so hatte sich denn der ganze furchtbare Krieg, der Kampf um Rom und Italien, dem System des Narses gemäß, mit dramatischer Folgerichtigkeit zugeschärft zu dem Kampf um eine mannesbreite Kluft an der Südspitze der so warm geliebten, so zäh verteidigten Halbinsel.
Auch in der geschichtlichen Darstellung Prokops erscheint die Vollendung der gotischen Geschicke wie der letzte Akt einer großartigen Tragödie der Geschichte.—
Am Strand, vor dem Hügel, von welchem man zu jenem Paß emporstieg, hatte nun Narses mit den Langobarden sein Lager aufgeschlagen, ihm zur Rechten Johannes, ihm zur Linken Cethegus.
Der Präfekt hob es seinen Tribunen hervor, daß Narses durch Überlassung dieses Platzes—Cethegus hatte ihn selbst gewählt—entweder einen Beweis großer Unvorsichtigkeit oder voller Harmlosigkeit gegeben hatte. «Denn», sagte er, «damit ließ er mir den Weg nach Rom, den er mir durch Zuteilung des rechten Flügels oder des Mitteltreffens verlegt hätte. Haltet euch bereit, sowie der Wink aus der Stadt eintrifft, mit allen Isauriern nachts heimlich nach Rom zu eilen.»
«Und du?» fragte Licinius besorgt.
«Ich bleibe hier, bei dem Gefürchteten! Hätte er mich morden wollen, längst hätte er es gekonnt. Er will es offenbar nicht. Er will nicht ohne Rechtsgrund gegen mich handeln. Und folge ich dem Ruf der Römer, so erfülle ich, breche nicht unsere Übereinkunft.»
Oberhalb des Engpasses am Vesuv, den wir die Gotenschlucht nennen mögen, wölbte sich eine schmale Höhlung in den schwarzen Lavafels, in ihren Tiefen hatte König Teja die heiligen Schätze des Volkes—den Königsleichnam und den Königshort—geborgen. Theoderichs Banner war vor der Mündung aufgesteckt. Ein purpurner Königsmantel, an vier Speeren aufgespannt, bildete den dunkelglühenden Vorhang des Felsgemachs, wo der letzte Gotenkönig seine Königshalle errichtet hatte: ein Lavablock, von dem Felle des schwarzen Panthers bedeckt, war sein letzter Thron.
Hier weilte König Teja, wann ihn nicht seine eifersüchtig gewahrte Wachtstunde vornhin an die Südmündung der Gotenschlucht rief, auf die unaufhörlich, bald von fern mit Pfeilen, Schleudern und Wurfspeeren, bald aus der Nähe in kühnem, plötzlichem Anlauf die Vorposten des Narses Angriffe unternahmen.
Keiner der heldenhaften Wächter kehrte abgelöst heim, der nicht an Schild und Harnisch Spuren solcher Angriffe mitbrachte oder sie zurückließ vor dem Eingang in Gestalt erschlagener Feinde.
So häufig begegnete dies, daß die Verwesung der Erschlagenen—denn diese fortzutragen wagte niemand—den Aufenthalt an dem Paßeingang unmöglich zu machen drohte.
Narses schien hierauf gezählt zu haben.
Als Basiliskos diese nutzlosen Opfer beklagte, hatte er entgegnet: «Sie nützen vielleicht nach ihrem Tode mehr als in ihrem Leben.» Aber König Teja befahl, zur Nacht die Leichen über das schroffe Lavageklippe zu werfen, so daß sie, grauenhaft zerrissen, von der Nachfolge hinwegzuschrecken schienen. Da erbat Narses eilfertig die Gunst, die Erschlagenen durch Unbewaffnete abholen lassen zu dürfen, was der König gewährte.
Seit dem Rückzug in diese Schlucht hatten die Goten noch nicht einen Mann im Kampf verloren, denn nur der vorderste im Engpaß war den Feinden erreichbar; und dieser Wächter, unterstützt von den hinter ihm stehenden Genossen, war noch nie erlegt worden.
Eines Abends, nach Sonnenuntergang—es war nun September und die Spuren des Kampfes von Taginä schon fast getilgt; die Blumen, welche Cassiodor und die Religiosä des Klosters neben den drei Sarkophagen seiner Braut und seines Freundes angepflanzt, hatten schon frische Keime getrieben—schritt König Teja, abgelöst von Wisand, dem Bandalarius, den Speer auf der Schulter, nach seiner Lavahalle.
Vor dem Vorhang schon empfing ihn Adalgoth, ihm, wehmütig lächelnd, kniend den hohen Goldpokal kredenzend. «Laß mich immerhin noch meines Mundschenkamtes warten:—wer weiß, wie lang's noch währt.»
«Nicht lange mehr!» sprach Teja ernst, sich niederlassend. «Wir wollen hier außen bleiben, vor dem Vorhang.
Sieh, wie prachtvoll die ganze Bucht von Bajä bis Surrentum im Schimmer der eben versunkenen Sonne glüht:—das blaue Meer ward purpurfarben Blut. Wahrlich, keinen schöneren Rahmen konnte das Südland gewähren, die letzte Schlacht der Goten drein zu fassen. Wohlan, das Bildnis sei des Rahmens wert. Es drängt zum Ende. Wie sich nun alles erfüllt hat, was ich geahnt—geträumt—gedichtet».
Und der König stützt das Haupt auf beide Hände.
Er sah erst wieder auf, als ein silberner Harfenklang ihn weckte. Adalgoth hatte verstohlen des Königs kleine Harfe hinter dem Vorhang herausgelangt.
«Horch, Herr König», sagte er, «wie ich—oder wie sich selbst—dein Lied von der Lavaschlucht vollendet hat. Gedenkst du noch der Nacht zu Rom in der Wildnis von Efeu, Marmor und Lorbeer? Nicht eine vergangene Schlacht, aus Vorzeittagen:—deinen, unsern eignen letzten Heldenkampf hast du, vorschauend, an diesem Ort geahnt.»
»Wo die Lavaklippen ragen
An dem Fuße des Vesuvs,
Durch die Nachtluft hört man klagen
Töne tiefen Weherufs,
Denn ein Fluch von tapfern Toten
Lastet auf dem Felsenring:
Und es ist das Volk der Goten,
Das hier glorreich unterging.»
«Ja, glorreich, mein Liebling. Das soll uns kein Schicksal und kein Narses rauben. Das fürchterliche Gottesurteil, das unser teurer Totila heraufgefordert—es ist grauenvoll ergangen über den Mann, sein Volk und seinen Gott. Kein Gott im Himmel hat, wie jener Edle wähnte, in gerechter Waage unser Schicksal gewogen. Wir fallen durch tausendfachen Verrat der Welschen, der Byzantiner und durch die dumpfe Übermacht der Zahl. Aber wie wir fallen, unerschüttert, stolz noch im Untergang:—das konnte kein Schicksal, nur der eigne Wert entscheiden.
Und nach uns? Wer wird nach uns herrschen in diesen Landen?
Nicht lange dieser Griechen Tücke—, und nicht der Welschen eigne Kraft—: noch hausen viele der Germanenstämme jenseits der Berge—sie setz' ich ein zu unsern Erben und Rächern.»
Und leise nahm er die Harfe auf, die Adalgoth niedergelegt, und sang leise, hinabschauend in das rasch nächtig gewordene Meer.
Und die Sterne standen schon über seinem Haupt.
Und nur manchmal griff er in die Saiten:
«Erloschen ist der helle Stern
Der hohen Amelungen.
O Dietrich teurer Held von Bern,
Dein Heerschild ist gesprungen.
Das Feige siegt—das Edle fällt—
Und Treu und Mut verderben:
Die Schurken sind die Herrn der Welt:—
Auf, Goten, laßt uns sterben!—
O schöner Süd, o schlimmes Rom,
O süße Himmelsbläue—
O blutgetränkter Tiberstrom—
O falsche, welsche Treue.
Noch hegt der Nord manch kühnen Sohn
Als unsers Hasses Erben:
Der Rache Donner grollen schon:——
Auf, Goten, laßt uns sterben!»
«Die Weise gefällt mir», rief Adalgoth—«aber ist sie schon zu Ende, der Schluß?»
«Den Schluß kann man nur zum Takt der Schwerterstreiche singen», sprach Teja, «Du hörst, dünkt mir, bald auch den Schluß.»
Und er stand auf.
«Geh, mein Adalgoth», sagte er, «laß mich allein.
Allzulange schon habe ich dich ferngehalten von»—da lächelte er durch seine Trauer—«von der lieblichsten aller Herzoginnen. Wenige solche Abendstunden habt ihr noch zusammen, arme Kinder. Euch, wenn ich retten könnte, ihr junges, zukunftknospendes Leben...—»
Er strich mit der Hand über die Stirn.
«Torheit», sprach er dann. «Ihr seid auch nur ein Stück von dem todverfallnen Volk:—freilich das holdeste.»
Adalgoths Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, da der König seines jungen Weibes gedacht. Nun trat er dicht an Teja heran und legte ihm fragend die Hand auf die Schulter.
«Ist keine Hoffnung? Sie ist so jung!»
«Keine», sprach Teja: «denn es steigen keine Engel rettend vom Himmel. Noch wenige Tage, bis der Mangel anhebt. Dann mach' ich ein rasches Ende. Die Männer brechen hervor und fallen im Kampf.»
«Und die Weiber, die Kinder—die Tausende?»
«Ich kann ihnen nicht helfen. Ich bin nicht der allmächtige Gott der Christen. Aber in die Byzantiner Sklaverei soll kein gotisch Weib und Mädchen fallen, das nicht die Schande wählt statt freien Todes. Sieh hin—mein Adalgoth—schon zeigt die dunkle Nacht die Bergglut voll.—Siehst du:—dort hundert Schritte rechts von hier—ha, wie herrlich die Flammen aus der dunkeln Mündung steigen!—wann des Passes letzter Wächter fiel—ein Sprung dahinab—: und keines Römers freche Hand rührt an unsere reinen Frauen. Ihrer gedenk'—: noch mehr als unsrer, denn wir können fallen allüberall—. Der Goten Frauen eingedenk, kor ich zur letzten Walstatt:——den Vesuvius!»
Und begeistert, nicht mehr weinend, warf sich Adalgoth an seines Königs Brust.
Wenige Tage, nachdem Cethegus mit seinen Söldnern die von ihm gewählte Stellung eingenommen zur Linken des Narses, kam in das Lager der Byzantiner die Kunde von der Bezwingung der Goten in dem Grabmal Hadrians. So war nun ganz Rom den Römern wiedergegeben: kein Gote und, fügte Cethegus frohlockend in Gedanken bei, kein Byzantiner wartete mehr in seinem Rom.
Gelang es nun, die Isaurier unter Führung der Tribunen in die Stadt zu werfen, so stand der Präfekt Narses noch viel günstiger gegenüber als je Belisar, mit welchem er sich in den Besitz der Stadt hatte teilen müssen.
Einer der Boten, welche die Nachricht aus Rom überbrachten, gab zugleich dem als Geisel behaltenen Aulus einen Brief der beiden Centurionen, der Brüder Macer, der besagte: «die Braut ist der langen Krankheit genesen, sobald der Bräutigam kommen will, steht der Hochzeit nichts mehr entgegen von den nächsten Ide an: komm, Aulus.»
Es waren die verabredeten Worte. Cethegus teilte sie seinen römischen Rittern mit.
«Wohlan», sagte Licinius entschlossen, «so werd' ich denn die Stätte mit einem Denkstein schmücken können, wo mein Bruder für Rom und für Cethegus fiel.»—«Ja, unverjährbar ist der Römer Recht auf Rom», fiel Salvius Julianus ein. «Nur sorge, Präfekt», mahnte Piso, «daß dem größten Krüppel aller Zeiten unser Abmarsch so lang verborgen bleibt, bis er uns nicht mehr einholen kann, wenn wir heimlich, gegen seinen Willen, aufbrechen sollen.»
«Nein», sprach Cethegus, «das sollt ihr nicht. Ich habe mich überzeugt, daß weit über unsere Stellungen auf dem linken Flügel hinaus der vorsichtigste aller Helden noch Vorposten aufgestellt:—seine langobardischen Wölflein, die er überall verteilt hat: was wir für unsere Vorposten hielten, ist umsäumt von seinen Vorposten. Weder mit Gewalt noch mit Täuschung könnt ihr euren Abzug ohne seinen Willen bewirken. Es ist auch weit klüger, offen zu handeln. Wenn er will, kann er es vereiteln, und er erfährt es doch. Aber er wird nichts dagegen haben—ihr werdet es erfahren—. Ich künde ihm meinen Entschluß an, und ihr werdet sehen: er heißt ihn gut.»
«Feldherr, das ist sehr gewagt, sehr groß.»
«Es ist das einzig Mögliche.»
«Ja, du hast recht, wie immer, o Cethegus», stimmte nach einigem Besinnen Salvius Julianus bei. «Gewalt und Täuschung sind unmöglich. Und willigt er ein, dann will ich gern gestehn, daß meine Besorgnisse...»
«Auf Überschätzung des Staatsmannes Narses beruhten. Euch haben die dicken Zahlen eingeschüchtert und die freilich gar nicht zu überschätzende Feldherrngröße des Kranken. Ja, ich gestehe es: vor Taginä sah es gewitterschwül aus—, aber da ich noch lebe, waren jene Annahmen Irrtümer. Ich schicke euch beide selbst sofort mit meiner Anfrage an Narses; ihr seid mißtrauisch; ihr werdet also scharf beobachten. Geht, sagt ihm: die Römer wollten mich, den Stadtpräfekten, jetzt schon, noch vor Vernichtung der Goten Tejas, in ihre Mauern lassen. Ich ließe ihn fragen, ob er gestatten wolle, daß ihr mit meinen Isauriern sofort nach Rom abzöget, oder ob er darin eine Verletzung unseres Übereinkommens erblicke: ohne seinen Willen würden die Isaurier und ich nicht aufbrechen.»
Die beiden Tribunen schieden voneinander und Piso lachte beim Hinausschreiten aus dem Zelt des Präfekten. «Länger hat euren Geist die Krücke des Narses als meine Finger der Knüttel des Hirten unbrauchbar gemacht.»
Als sie draußen waren, eilte Syphax auf seinen Herrn zu: «O Herr», sprach er ängstlich, «mißtraue diesem Kranken mit dem ruhigen, durchdringenden Auge. Ich habe in letzter Nacht wieder das Schlangenorakel gefragt: die abgestreifte Haut meines Gottes, in zwei Hälften geteilt, auf Kohlen gelegt das Stück ‹Narses› überlebte das Stück ‹Cethegus› lange, lange. Soll ich nicht noch einmal versuchen? Du weißt, ein Hautritz mit diesem Dolche, und er ist verloren.—Was liegt daran, wenn sie dann Syphax pfählen, des Hiempsals Sohn.—Mit List geht es nicht:—der Langbärtge Fürst schläft in seinem Zelt, das Feldbett quer vor den Eingang gerückt, und sieben seiner ‹Wölflein› liegen auf der Schwelle. Die Heruler stehen Wache vor der Tür. Ich habe, deinem Wink gemäß, seit Helvillum alle Nachtlager ausgespäht: kaum eine Stechfliege entgeht den Herulern und Langobarden, fliegt sie ins Zelt. Aber offen, bei Tage, einen Sprung in seine Sänfte—eine Hautwunde, und er ist ein toter Mann in einer Viertelstunde.»
«Und noch vorher nicht nur Syphax, des Hiempsals Sohn,—auch Cethegus. Nein. Aber höre: ich habe entdeckt, wo der Feldherr seine Geheimgespräche mit Basiliskos, auch mit Alboin, hält.
Nicht im Zelt—das Lager hat tausend Ohren—: im Bade. Die Ärzte haben ihm ein Morgenbad im Meeresschlamm im Golf von Bajä verordnet: eine Badehütte haben sie ihm ins Meer gebaut, nur auf dem Kahne zu erreichen. Bevor Basiliskos und Alboin ihn dahin begleiten, sind sie nur so gescheit wie—nun, wie Basiliskos und Alboin. Kommen sie aber von daher zurück—sind sie immer von narsetischer Klugheit, wissen, was aus Byzanz für Briefe gekommen und andres mehr. Rings um die Badehütte wogt Schilf—Syphax, wie lange kannst du tauchen?»
«Lange genug», sprach der Maure, nicht ohne Stolz, «bis sich das schwerfällige und mißtrauische Krokodil in unsern Strömen die als Köder ins Schilf geworfene Gazelle genau genug betrachtet und sich endlich entschlossen hat, darauf los zu schwimmen—dann das Messer von unten in den Bauch. Dieser kleinäugige Narses hat etwas vom Krokodil—laß sehen, ob ich nicht auch ihn überdauere in geduldigem Tauchen.»
«Vortrefflich, mein Panther zu Lande, meine Tauchente zu Wasser!»
«Auch ins Feuer spräng' ich für dich, mein Skorpion.»
«Ja, belausche diese Badegespräche des Kranken.»
«Das schließt sich vortrefflich an ein anderes Spiel.
Seit mehreren Tagen winkt und blinzelt mich ein Fischer immer so einfältig klug an, der morgens und abends seine Netze wirft und nie was fängt. Ich glaube: er lauert auf mich, nicht auf die Meeräschen. Aber die langbärtigen Wölflein dieses Alboin sind mir immer auf den Fersen—: vielleicht erwische ich, aus dem Wasser tauchend, was mir dieser Fischer vertrauen will.»
Ernsten Sinnes, aber nicht mehr in tränenweicher Stimmung, hatte Adalgoth seinem jungen Weibe den Entschluß des Königs und den letzten Ausweg aus Knechtschaft und Schmach mitgeteilt. Er erwartete einen Ausbruch des Schmerzes, wie er selbst ihn kaum niedergekämpft.
Aber zu seinem Staunen blieb Gotho unerschüttert.
«Ich habe das längst vorausgesehen, mein Adalgoth.
Das ist kein Unglück—: ein Unglück ist nur, im Leben verlieren, was man liebt. Ich habe höchstes Erdenglück erreicht. Ich ward dein Weib. Ob ich das nun zehn Jahre bleibe oder zwanzig oder ein halbes kaum—das ändert nichts. So sterben wir zusammen, an einem Tag, wohl in einer Stunde. Denn König Teja wird nicht verbieten, wenn du in der letzten Schlacht dein Teil getan und, vielleicht verwundet, nicht weiter kämpfen kannst, daß du hierher zurückkehrst und mich auf den Arm nimmst—wie oft daheim auf dem Iffinger—und mit mir in die Tiefe springst. O mein Adalgoth», rief sie, ihn heftig umarmend, «wie glücklich waren wir! Wir wollen's verdienen durch mutigen Tod, ohne feiges Jammern. Der Baltensproß soll nicht sagen», lächelte sie, «das Hirtenkind habe nicht Schritt halten können mit seiner Seele.
Mir steigt die Großheit unsrer Berge mächtig im Gemüt empor.
Der Ohm Iffa hat mich beim Scheiden gemahnt, der frischen, freien Bergluft zu gedenken, der strengen, hehren Zucht der stolzen Höhen, wann uns das Leben in den niedern, engen Goldgemächern zu klein und dumpf auf den Seelen lasten würde. Das hat uns nicht bedroht. Aber auch nun, da es galt, die Seele emporzureißen zu diesem Todesentschluß aus zagem, weichem Schmerz—der mich auch wohl beschleichen wollte—auch um die stolze Kraft zum stolzen Tod zu finden, hat mich das Bild der Heimatberge stark gemacht: ‹Schäme dich›, sprach ich still zu mir, ‹schäme dich, Tochter der Berge! Was würden die Iffinger und der Wolfshaupt und alle die steinernen Heldenriesen sagen, sähen sie das Hirtenkind verzagen? Sei deiner Berge wert und deines Baltenhelden.›» Und stolz und selig drückte Adalgoth das junge Weib an die Brust.
Hinter dem Zelt des Herzogs erhob sich die niedre Laubhütte, in welcher Wachis und Liuta hausten; diese, die von Gotho den drohenden Ausgang vernommen, hatte ihrem wackern Mann (der kopfschüttelnd an seinem von langobardischen Wurfpfeilen bei der letzten Schluchtwache übel zugerichteten Schilde flickte, stopfte und hämmerte und manchmal zu pfeifen versuchte, um das Ringen mit dem Schluchzen zu verbergen) sehr ernsthaft zureden müssen, ihn zu der gleichen Entsagung zu steigern.
«Ich glaube nicht», sagte der Schlichte, «daß das der liebe Himmelsherr mit ansehen kann. Ich bin von denen, die niemals gern sagen: ‹jetzt ist alles aus.› Die Stolzen, die das Haupt so hoch tragen wie König Teja und Herzog Adalgoth, die rennen freilich immer und überall an die Balken des Schicksals. Aber wir kleinen Leute, die wir uns fügen und ducken können, wir finden leicht noch ein Mausloch oder eine Mauerlücke zu entrinnen. Es ist doch gar zu niederträchtig! elend! grausam! hundsföttisch!»—und jedes Wort begleitete ein stärkerer Hammerschlag.—«Ich will's nicht glauben vom lieben Gott!—daß hier in die Tausende von braven Weibern und hübschen Mädchen und lallenden Kindern und von grauen Greisen in das höllische Feuer! dieses verfluchten! Zauberberges! springen sollen, als wär's ein lustig Sonnwendfeuer, und als kämen sie drüben heil und gesund wieder heraus. Verbrennen hätt' ich dich auch in dem Haus bei Fäsulä schon lassen können. Und nun sollst nicht nur du verbrennen—: auch unser kommend Kind, das ich jetzt schon ‹Witichis› vorbenannt habe.»
«Oder:—‹Rauthgundis›!» fügte errötend Liuta leise bei, sich an ihres Mannes Schulter schmiegend und sein Hämmern hemmend. «Laß dich diesen Namen mahnen, Wachis. Denk' an Rauthgundis, die Herrin! War sie nicht tausendmal herrlicher als Liuta, die Flachsmagd? Und würde sie sich besinnen, sich weigern, zu sterben an einem Tag zusammen mit ihrem Volk?»
«Recht hast du, Weib! rief Wachis, mit einem letzten grimmen Hammerschlag, daß die Funken stoben. «Weißt, ich bin von Bauernart—, wir wollen durchaus nicht gerne sterben! Aber fällt der Himmel ein, schlägt er auch alle Bauern tot. Und vorher—hassa! hau' ich noch manchen Hieb! Das wäre auch Herrn Witichis und Frau Rauthgundis recht! Ihnen zu Ehren—ja, du hast recht, Liuta—wollen wir tapfer leben—, und geht's denn wirklich gar, gar nicht anders—, tapfer sterben.»
Freudig erstaunt kehrten alsbald von Narses die beiden Tribunen Licinius und Julianus zurück in das Zelt des Präfekten. «Abermals hast du gesiegt, o Cethegus!» rief Licinius. «Du hast recht behalten, Präfekt von Rom», sprach Salvius Julianus. «Ich begreife es nicht,—aber Narses überläßt dir wirklich Rom.»—«Ah», frohlockte Piso, der mit eingetreten war, «Cethegus, das ist dein altes, cäsarisches Glück. Neu steigt dein Stern, der sich seit dieses unheimlichen Kranken Auftreten geneigt zu haben schien. Mir ist, auch sein Geist hat manchmal epileptische Anfälle. Denn, bei gesundem Geist dich, ohne Widerstand, nach Rom zu lassen—nein: quem deus vult perdere dementat! Nun wird Quintus Piso wieder auf dem Forum wandeln und an den Läden der Buchhändler nachsehen, ob die Goten fleißig seine ‹epistolas ad amabilissimum, carissimum pastorem Adalgothum et ejus pedum› (Briefe an den höchst liebenswürdigen und geliebten Hirtenknaben Adalogth und seinen Knüttel) gekauft haben.»
«So hast du in der Verbannung gedichtet, wie Ovidius?» lächelte Cethegus.
«Ja», meinte Piso, «die sechsfüßigen Verse kamen leichter, seitdem sie nicht mehr die Goten, die um einen Fuß länger sind, zu scheuen hatten. Unter dem Lärm gotischer Gelage war auch im Frieden schon nicht gut dichten gewesen.»
«Darüber hat er drollige Verse gemacht, mit gotischen Wörtern dazwischen gemengt», warf Salvius Julianus ein. «Wie fingen sie nur noch an: ‹Inter hails gothicum skapja—?›»
«Versündige dich nicht an meinen Worten. Falsch zitieren darf man das Unsterbliche nicht.»
«Nun, wie lauten die Verse?» frug Cethegus.
«Folgendermaßen», sprach Piso.
‹De conviviis barbarorum.
Inter: ‹hails Gothicum! skapja matjan jah drinkan!›
Not audet quisquam dignos educere versus:
Calliope madido trepidat se jungere Baccho,
Ne pedibus non stet ebria Musa suis.›
(Über die Gelage der Barbaren.
Unter dem Gotischen: «Heil! schafft Essen und Trinken den Goten!»
Kann kein vernünftiger Mensch ein erträgliches Verslein ersinnen:
Vor dem Bacchus im Rausch bebt lang die verschüchterte Muse,
Und dem benebelten Vers auch! versagen die taumelnden Füße.)
«Schauderhafte Poesie», meinte Salvius Julianus.
«Wer weiß», lachte Piso, «ob der Durst der Goten nicht unsterblich wird durch diese Verse.»
«Aber meldet nun genauer: was hat Narses geantwortet?»
«Er hörte uns erst sehr ungläubig zu», sprach Licinius.
«‹Freiwillig›, fragte er mißtrauisch, ‹sollten sich die vorsichtigen Römer wieder isaurische Besatzung erbitten und den Präfekten, dem sie so viel Hunger und unfreiwillige Tapferkeit verdanken?›
Ich aber erwiderte: er unterschätze wohl der Römer Römertum. Und es sei deine Sache, ob du dich getäuscht. Ließen uns die Römer nicht freiwillig ein, so seien siebentausend Mann doch gewiß zu schwach, die Stadt zu stürmen. Das schien ihm einzuleuchten. Er verlangte nur das Versprechen, daß wir, wenn nicht freiwillig eingelassen, nicht Gewalt versuchen, sondern dann sofort hierher zurückkehren würden.»
«Das glaubten wir in deinem Namen versprechen zu dürfen», ergänzte Julianus.
«Ihr durftet», lächelte Cethegus.
«‹Gut›, sagte Narses, ‹von mir aus steht nichts im Wege, wenn euch die Römer aufnehmen.› Und—so völlig harmlos ist er», fuhr Licinius fort, «daß er auch deine Person nicht als Geisel behalten zu wollen schien, denn er fragte: ‹wann will der Präfekt aufbrechen?› Er setzte also voraus: du führtest selber deine Isaurier nach Rom! Und auch dawider hat er nichts! Er war sichtlich erstaunt, als ich entgegnete: du zögest vor, hier den Untergang der Goten mit anzusehen.»
«Nun, wo ist er denn, dieser schreckliche Narses, der überlegene Staatsmann? Auch mein Freund Prokop hat ihn arg überschätzt, als er ihn mir einmal ‹den größten Mann der Zeit› nannte.»
«Der größte Mann der Zeit heißt:——anders!» rief Licinius.
«Prokop natürlich muß seines Belisars überlegenem Feinde die Palme zuerkennen vor allen Erdensöhnen. Aber diesen plumpsten Schnitzer des ‹größten Mannes›, mich freiwillig nach Rom zu lassen, sollte man fast benutzen», fuhr Cethegus nachsinnend fort. «Die Götter könnten zürnen, wenn wir solche Mirakel der Verblendung, die sie für uns vollbringen, nicht nützen. Ich ändere meinen Entschluß:—mich zieht es nach dem Kapitol:—ich gehe mit euch nach Rom. Syphax, wir brechen auf, sogleich—sattle mein Roß.»
Da gab Syphax seinem Herrn einen warnenden Wink.
«Verlaßt mich, Tribunen», sprach Cethegus. «Gleich ruf ich euch wieder.»
«O Herr», rief Syphax eifrig, als beide allein waren, «nur heute gehe noch nicht. Sende jene voraus. Morgen früh angle ich zwei große Geheimnisse aus der See. Ich sprach heute schon, unter seinem Boote durchtauchend, jenen Fischer. Er ist kein Fischer. Er ist ein Sklave, ein Briefsklave Prokops.»
«Was sagst du?» rief Cethegus rasch und leise.
«Wir konnten nur wenige Worte flüstern. Die Langbärte standen am Ufer, mich beobachtend. Sieben Briefe Prokops, offen und heimlich geschickt, haben dich nicht erreicht. Drum wählte er diesen klugen Boten. Heute in dieser Nacht fischt er bei Fackellicht auf Thunfische. Dabei wird er mir den Brief Prokops geben. Er hatte ihn heute nicht bei sich. Und morgen früh,—heute hemmte die Krankheit—morgen badet Narses wieder im Meeresschlamm. Ich habe nun einen Versteck im Schilf gefunden, prächtig nahe:—und ich kann pfeifen, wie die Otter, falls sie wirklich Blasen aufsteigen sehen sollten aus dem Wasser. Ich sah die kaiserliche Post mit dicken Felleisen ankommen: Basiliskos nahm sie in Empfang. Warte nur noch bis morgen früh, gewiß verhandelt Narses morgen mit ihm und Alboin die neuesten Geheimnisse aus Byzanz. Oder laß mich allein zurück...—»
«Nein, das würde dich als Späher sofort kennzeichnen. Du bist mehr wert als zehnfach dein Gewicht in Gold, Syphax. Ich bleibe bis morgen noch», rief er den wieder Eintretenden entgegen.
«O Feldherr, komm mit uns», bat Licinius. «Fort aus der erdrückenden Nähe dieses Narses», mahnte Julianus.
Aber Cethegus furchte die hohe Stirn. «Überragt er mich noch immer in euren Augen? Der Tor, der Cethegus aus seinem Langobarden-bewachten Lager nach Rom entläßt, den Hecht aus seinem Netz zurück ins Wasser wirft! Allzusehr doch hat er euch eingeschüchtert! Morgen abend folg' ich euch. Ich habe hier noch ein Geschäft, das nur ich verrichten kann. Rom ohne Widerstand besetzen, das könnt ihr auch ohne mich. Ich hole euch aber gewiß unterwegs schon bei Terracina ein. Wenn nicht, rückt ruhig in Rom ein. Du, Licinius, wahrst mir das Kapitol.»
Mit leuchtenden Augen erwiderte Licinius: «Hoch ehrst du mich, mein Feldherr! Mit meinem Herzblut steh' ich dir dafür ein. Darf ich eine Bitte wagen?»—«Nun?»—«Setze dich nicht wieder so tollkühn dem Speerwurf des Gotenkönigs aus! Vorgestern warf er zwei Speere zugleich gegen dich: mit der Linken und mit der Rechten. Wenn ich nicht mit dem Schilde den aus der linken Hand gefangen...—»
«Dann, mein Licinius, hätte ihn der Jupiter des Kapitols von mir hinweggeblasen. Denn er braucht mich noch! Aber du meinst es treu.»
«Laß Roma», mahnte Licinius, «nicht verwitwen!»
Cethegus blickte ihn mit seinem unwiderstehlich gewinnenden Blick ehrender Liebe an. Und fuhr fort:
«Salvius Julianus, du besetzest das Grabmal Hadrians: du, Piso, den Rest der Stadt am linken Tiberufer, zumal die Porta latina; durch diese folge ich euch. Narses allein öffnet ihr so wenig, wie weiland Belisar allein. Lebt wohl, grüßt mir mein Rom. Sagt ihm: der letzte Kampf um seinen Besitz, der zwischen Narses und Cethegus, habe mit des Cethegus Sieg geendet. Auf Wiedersehn in Rom! Roma eterna!»
«Roma eterna!» wiederholten begeistert die Tribunen und eilten hinaus.
«Oh, warum ist dieser Licinius nicht Manilias Sohn!» sagte Cethegus, dem Jüngling nachblickend, «Torheit des Herzens! Was bist du so zäh! Licinius, du sollst mir als mein Erbe Julius ersetzen! Oh, wärst du doch selber mein Julius!»
Die Abreise des Präfekten nach Rom verzögerte sich um mehrere Tage. Narses zwar, der ihn zur Tafel zog, hielt ihn nicht zurück; er äußerte sogar sein Befremden, daß es den «Beherrscher des Kapitols» nicht mächtiger an den Tiberstrom zurückziehe. «Freilich», lächelte er, «ich kann verstehen: du hast diese Barbaren so lang in deinem Italien herrschen und siegen sehen, daß es dich verlangen mag, sie nun auch in deinem Italien fallen zu sehen. Aber ich kann nicht sagen, wie lange das noch anstehen wird. Zu stürmen ist jene Schlucht nicht, solang sie Männer wie dieser König decken. Schon mehr als tausend meiner Langobarden, Alamannen, Burgunden, Heruler, Franken und Gepiden fielen vor dem Paß.»
«Schick' doch», warf Alboin verdrießlich ein, «auch einmal deine tapfern Romäer gegen die Goten. Die Heruler Vulkaris und Wilmut sind, kaum hier eingetroffen, von König Tejas Beil gefallen: der Gepide Asbad von Adalgoths, des Knaben Speer: mein Vetter Gisulf liegt schwertwund von des Herzogs Guntharis Streich: den Frankengrafen Butilin hat Wisand, der Bandalarius, mit der Bannerspitze erstochen: dem Burgunden Gernot hat der alte Waffenmeister mit seinem Steinbeil das Hirn gesegnet: den Alamannen Liuthari hat Graf Grippa, meinen Schildträger Klaffo ein gemeinfreier Gote erschlagen. Und um jeden dieser unsrer Helden liegen zu Dutzenden ihre Gefolgen. Und wenn gestern um Mitternacht nicht der Lavablock, auf dem ich stand, höchst verständigerweise gerade in dem Augenblick nach unten gerutscht wäre, als König Teja, der im Finstern sieht, seine fürchterliche Lanze warf, so war Rosamunde heute nicht mehr die schönste Frau, sondern die schönste Witwe im Langobardenreich. So kam ich mit häßlichen Schrunden davon, die einst der Heldensang nicht preisen wird, die mir aber viel lieber sind als König Tejas bester Speer im Bauch.—Aber ich meine: nun ist die Reihe an andern Helden: laß doch auch deine Makedonen und Illyrier dran. Wir haben's diesen jetzt oft genug vorgemacht, wie man vor jenem Nadelöhr stirbt.»
«Nein, Wölflein. Diamant schneidet Diamant!» lächelte Narses. «Immer Germanen gegen Germanen: es sind euer allzuviele in der Welt.»
«Auch von den Isauriern—das heißt von den meinen!—scheinst du diese väterliche Meinung zu hegen, Magister militum», sagte Cethegus: «kurz vor ihrem Aufbruch nach Rom hast du meine Isaurier zum Massensturm auf jene Schlucht befohlen—: der erste Massensturm, den du geboten:—siebenhundert von meinen siebentausend sind liegengeblieben auf jenen Felsen, und Sandil, mein durch so viele Kämpfe erprobter Söldnerhäuptling, fand zuletzt doch auch dieses schwarzen Teja Schlachtbeil zu scharf für seine Sturmhaube. Schade! Er war mir wert.»
«Nun, der Rest ist dir ja nun in deinem Rom geborgen. Jene Goten aber treibt nichts aus ihrem letzten Loch als Feuer. Wenn die Erde mir zuliebe doch auch einmal zucken wollte, wie zugunsten Belisars in Ravenna.»
«Noch immer keine Kunde von dem Ausgang des Prozesses Belisars?» forschte lauernd Cethegus. «Neulich kamen Briefe aus Byzanz, nicht?»
«Ich habe sie noch nicht alle gelesen.——Oder, wenn nicht Feuer:—der Hunger. Und wann sie dann zum letzten Kampf ausbrechen, hörte wohl mancher lieber den Ganges als den Draco rauschen.—Nicht du, Präfekt! ich weiß, du kannst dem Tode kühn ins Auge sehn.»
«Ich will die Dinge hier noch etwas abwarten. Es ist schlecht Reisewetter. Es stürmt und regnet ja unablässig. An dem ersten oder zweiten warmen Sonnentag breche ich auf nach Rom.»
Das war es.
Das Wetter war in der Nacht des Abzugs der Isaurier plötzlich umgeschlagen. Der Fischer, der in einem Dorfe bei Stabiä seine Behausung hatte, konnte sich nicht auf das Meer wagen, weniger des Sturmes als der Langobarden wegen, die ihn längst mißtrauisch beobachtet und schon einmal gefangengenommen hatten; erst als sein alter Vater herbeieilte und durch Zeugen dartat, daß Agnellus wirklich sein, des alten Fischers, Sohn sei, ließen sie ihn zögernd wieder los. Aber er konnte nicht wagen, scheinbar zu fischen, wann kein Fischer sonst Netze warf, und nur weit draußen in dem Wasser vermochte Syphax, der ebenfalls stets umspäht war, mit ihm zusammenzukommen.
Die Ausgänge aller Lager, auch des jetzt halbleeren von Cethegus—nur dreitausend Thraker und Perser hatte Narses in der Isaurier verlassene Zelte gelegt—bewachten Tag und Nacht die Langobarden.
Und auch das Meerschlammbad mußte Narses auf sonnigere Tage verschieben. Diese Geheimnisse aber, d. h. Prokops Brief und die Badegespräche des Narses, wollte Cethegus noch abwarten.
Des Präfekten altes Glück schien auch das Wetter nach seinen Wünschen rasch zu ändern.
Prachtvoll leuchtete am Morgen nach der letzten Unterredung mit Narses die Sonne auf den blauschimmernden Golf von Bajä; und Hunderte von Fischerbooten eilten hinaus, die günstige Witterung zu nutzen.
Syphax war mit dem ersten Morgengrauen, nachdem er seinen Platz auf der Schwelle des Zeltes seines Herrn den vier allein zurückgebliebenen Isauriern überwiesen, verschwunden.
Als Cethegus das Morgenbad im Nebenzelt vollendet hatte und zum Frühmahl in sein Hauptzelt zurückkehrte, hörte er Syphax laut lärmend durch die Lagergassen schreien. «Nein!» rief er, «diesen Fisch dem Präfekten! Ich habe ihn bar bezahlt. Der große Narses wird doch nicht andrer Leute Fisch essen wollen.» Und mit diesen Worten riß er sich los von Alboin und einigen Langobarden sowie von einem Sklaven des Narses.
Cethegus blieb stehen. Er erkannte den Sklaven: es war der Koch des meist kranken und immer sehr mäßigen Mannes, der fast nur für des Narses Gäste sich zu mühen hatte.
«Herr», sprach der feingebildete Grieche, sich entschuldigend, in seiner Muttersprache zu dem Präfekten: «nicht mich schilt um diese Ungebühr. Was liegt mir an einer Meeräsche! Aber diese langbärtigen Barbaren zwangen mich, um jeden Preis den Fischkorb für Narses in Anspruch zu nehmen, den dein Sklave aus der See zurückbringen würde.»
Ein zwischen Syphax und Cethegus gewechselter Blick genügte.
Die Langobarden hatten das Griechische nicht verstanden.
Cethegus gab Syphax einen Schlag auf die Wange und rief auf lateinisch:
«Unnützer, frecher Sklave, kannst du denn niemals Sitte lernen? Soll nicht der kranke Feldherr das Beste haben?» Und unsanft entriß er den Korb dem Mauren und reichte ihn dem Sklaven: «Hier der Korb. Mögen die Fische Narses munden.» Der Sklave, der die Gabe deutlich genug abgelehnt zu haben glaubte, nahm den Korb kopfschüttelnd.
«Was bedeutet das?» sagte er im Abgehn lateinisch.
«Das bedeutet», antwortete, ihm folgend, Alboin, «daß der beste Fisch nicht in dem Korbe geborgen ist, sondern anderswo.»
Im Zelte angelangt, griff Syphax eifrig in seinen Gürtel von Krokodilhaut, der, wasserdicht, ein Bündel von Papyrusrollen barg, und reichte sie rasch seinem Herrn.
«Du blutest, Syphax?»
«Nur wenig! Die Langbärte stellten sich, da sie mich im Wasser schwimmen sahen, als hielten sie mich für einen Delphin, und schossen mit ihren Pfeilen um die Wette auf mich.»
«Pflege dich—ein Solidus für jeden Tropfen deines Blutes:—der Brief ist goldes- und bluteswert, wie es scheint. Pflege dich! Und die Isaurier sollen niemand einlassen.»
Und nun allein im Zelt hob der Präfekt an zu lesen. Seine Züge verfinsterten sich: tiefer, immer tiefer ward die Mittelfurche der gewaltigen Stirn, immer fester und herber schlossen sich die Lippen.
«An Cornelius Cethegus Cäsarius, den gewesenen Präfekten und gewesenen Freund zum letztenmal Prokopius von Cäsarea.
Das ist das traurigste Schreibgeschäft, zu welchem ich je meine ehemalige und meine jetzige Schreibhand gebraucht. Und ich gäbe gern auch diese meine Linke, wie für Belisar meine Rechte, dahin, müßte ich diesen Brief nicht schreiben.
Den Absagebrief, den Aufkündungsbrief unserer bald dreißigjährigen Freundschaft!
An zwei Helden hatte ich geglaubt in dieser heldenlosen Zeit: an den Schwerthelden Belisar, an den Geisteshelden Cethegus. Den letzten muß ich fortan hassen, fast verachten...—»
Der Leser warf den Brief auf den Lectus, darauf er lag: dann nahm er ihn mit gefurchten Brauen wieder auf und las weiter: «Nun fehlte nur noch, daß Belisar der Verräter wirklich gewesen wäre, als den du ihn darstellen wolltest.
Aber Belisars Unschuld ist so leuchtend aufgedeckt worden wie deine schwarze Falschheit. Längst ward mir unheimlich bei deinen krummen Pfaden, auf welchen du auch mich ein gut Stück mitgeführt. Aber ich glaubte an dein selbstlos hohes Ziel: Italiens Befreiung. Nun aber durchschaue ich, als deine letzte Triebfeder, die maßlose, schrankenlose, scheulose Herrschsucht. Ein Ziel, eine Leidenschaft, die solche Mittel brauchen, sie sind entweiht für immer. Du hast den tapfersten Mann mit der treuen Kindesseele verderben wollen durch sein eignes, eben gebessertes Weib, deiner schändlichen Freundin Theodora und deiner eignen Herrschgier zum Opfer. Das ist teuflisch: und für immer wend' ich mich von dir.»
Cethegus drückte die Augen zusammen.
«Es darf mich nicht wundern»—sprach er dann vor sich hin. «Auch er hat seinen Abgott: Belisar! Wer dem klugen Manne den antastet, der ist ihm so greulich wie dem Christen, wer in dem Kreuz nur ein Stück Holz erblickt. Es darf mich also nicht wundern—: aber es schmerzt!
Das ist die Macht dreißigjähriger Gewohnheit.
Solang hüpfte etwas wärmer da unterm Harnisch bei dem Klang des Namens: ‹Prokopius›.
Wie schwach doch die Gewohnheit macht! Julius nahm mir der Gote:—Prokop nahm mir Belisar:—wer wird mir den Cethegus nehmen, meinen ältesten, letzten Freund? Niemand: auch Narses nicht: und nicht das Schicksal. Hinweg mir dir, Prokopius, aus meinem Lebenskreise. Du bist tot. Fast zu weinerlich, jedenfalls zu lang, ward die Grabrede, die ich dir gehalten. Was spricht er weiter, der Verstorbene?»
«Ich aber schreibe dir dies, weil ich die lange Freundschaft, die du mit tückischem Angriff auf mein Sternbild Belisar geschlossen, meinerseits schließen will mit einem letzten Liebeszeichen: ich will dich warnen und retten, bist anders du zu warnen und zu retten.
Sieben meiner früheren Briefe haben dich offenbar nicht erreicht—sonst weiltest du nicht mehr in des Narses Lager, wie dessen Kriegsberichte melden.
So vertraue ich diesen achten meinem klugen Agnellus an, einem Fischersohn aus Stabiä, wo ihr ja nun lagert: ich schenke ihm die Freiheit und lege ihm diesen Brief als letzten Auftrag ans Herz. Denn, obwohl ich dich nur hassen sollte—: noch immer lieb' ich dich, Cethegus—. Man kann—weiß nicht warum, aber man kann nicht von dir lassen!—: und gern möcht' ich dich retten.
Als ich, bald nach deiner Abreise, nach Byzanz kam—schon unterwegs hatte mich wie ein Donnerschlag die Kunde von Belisars Verhaftung (in einer Verschwörung wider Justinian!) erreicht—glaubte ich zuerst, du müssest getäuscht worden sein wie der Kaiser.
Vergebens bemühte ich mich um Gehör bei dem Imperator: er wütete gegen alle Namen, die mit Belisar durch Freundschaft verknüpft waren. Vergebens versuchte ich, mit allen Mitteln, zu Antonina zu dringen: vortrefflich wurde sie—dank deinen Weisungen!—bewacht im roten Hause. Vergebens bewies ich Tribonian die Unmöglichkeit einer Verratsschuld Belisars: er zuckte die Achseln und sprach: ‹Begreifen kann ich's nicht! Aber die Überführung ist schlagend: dies unsinnige Ableugnen der Besuche des Anicius! Er ist verloren!›
Und verloren war er.
Gefällt war der Spruch: Belisar zum Tode verurteilt. Antonina zur Verbannung. Des Kaisers Gnade hatte das in Blendung, Verbannung, fern von dem Exil Antoninas, und Vermögenseinzug verwandelt.
Furchtbar lag dieses Wort auf Byzanz.
Niemand glaubte an seine Schuld: ausgenommen der Kaiser und die Richter.—Aber niemand vermochte seine Unschuld zu beweisen, sein Schicksal zu wenden. Ich war entschlossen, mit ihm zu gehen: der Einarmige mit dem Blinden. Da hat ihn—und gesegnet soll er dafür sein!—gerettet:——sein großer Feind Narses, den ich dir schon einmal den größten Mann des Jahrhunderts genannt habe.»
«Natürlich», grollte Cethegus, «nun vollends ist er auch der Edelste.»
«Aus den Bädern von Nikomedia, wo der Kranke weilte, war er, als ihn die Nachricht traf, sofort nach Byzanz geeilt. Er ließ mich rufen und sprach: Du weißt es: meine Wonne war es, Belisar in offner Feldschlacht gründlich zu schlagen. Aber so elend soll nicht, durch Lügen, untergehn, wer des Narses großer Feind gewesen. Komm mit mir, du, sein erster Freund, ich: sein erster Feind—: wir beide zusammen wollen ihn retten, den törichten Mann des Ungestüms.»
«Und er verlangte Audienz beim Kaiser, die der Gegner Belisars sofort erhielt. Da sprach er zu Justinian:
‹Es ist unmöglich, daß Belisar ein Verräter. Seine blinde Treue gegen deinen Undank ist ja sein einziger Fehler.›
Aber Justinian blieb taub.
Narses jedoch legte seinen Feldherrnstab vor den Kaiser nieder und sprach: Wohlan: entweder du vernichtest den Spruch der Richter und bewilligst Neuaufnahme des Verfahrens, oder du verlierst an einem Tage deine beiden Feldherren. Denn an dem gleichen Tage mit Belisar geht Narses in Verbannung. Dann siehe zu, wer deinen Thron behütet vor Goten, Persern und Sarazenen.'
Und der Kaiser schwankte und verlangte drei Tage Bedenkzeit: und inzwischen sollte Narses das Recht haben, mit mir die Akten einzusehen, Antonina und alle Angeschuldigten zu sprechen.
Bald ersah ich aus den Akten, daß der schlimmste Beweis wider Belisar—denn jene Zusage auf der Wachstafel, die man bei Photius gefunden, hoffte ich hinwegdeuten zu können—der geheime nächtliche Verkehr des Anicius in seinem Hause war, den Belisar, Antonina, Anicius selbst wider allen Verstand hartnäckig leugneten.
Als ich Antonina, die Verzweifelte, allein sprach, sagte ich ihr: ‹Dieser Verkehr und dies euer Lügen wird sein Verderben.›—‹Wohlan›, rief sie leuchtenden Auges, ‹dann bin nur ich verloren, und Belisar gerettet. Belisar wußte wirklich nichts von jenen Besuchen, denn Anicius kam nicht zu ihm, er kam zu mir. Alle Welt soll es wissen—: auch Belisar—. Er soll mich töten—: aber gerettet sein.› Und sie gab mir eine Sammlung von Briefen des Anicius, die freilich, wenn dem Kaiser vorgelegt, alles erklären, aber auch—die Kaiserin furchtbar anklagen mußten.
Und wie fest stand Theodora bei Justinian!
Ich eilte mit den Briefen zu Narses. Dieser las und sprach: ‹Wohlan, jetzt gilt es nicht nur Belisars, jetzt gilt es unser aller Untergang:—oder den Fall der schönen Teufelin. Es gilt auf Tod und Leben! Komm erst noch mal zu Antonina.› Und mit Antonina, von Wachen begleitet, eilten wir zu dem im Kerker langsam genesenden Anicius.»—
Cethegus stampfte mit dem Fuß.—
«Und dann wir alle vier zu Justinian. Die hochherzige Sünderin gestand, auf den Knien vor dem Kaiser, den nächtlichen Verkehr mit Anicius, der aber nur bezweckt habe, den Jüngling aus den Schlingen der Kaiserin zu lösen—: sie gab ihm des Anicius Briefe, die von der Verführerin, von ihren namenlosen Künsten, von dem geheimen Gang in ihr Gemach, von der drehbaren Justinianusstatue sprachen.
Furchtbar loderte der arme Gatte empor. Er wollte uns alle wegen Majestätsbeleidigung, wegen maßloser Verleumdung auf dem Fleck verhaften lassen. Narses aber sprach: ‹Tu' das: morgen! Heute aber, wenn die Kaiserin schläft, laß dich von Anicius und mir durch den drehbaren Justinianus in das Gemach deiner Gemahlin führen, ergreife ihre Briefe, stelle sie Anicius und Antonina gegenüber, laß die alte Hexe Galatea foltern:—und gib acht, ob du nicht viel mehr erfährst, als dir lieb sein wird zu hören. Und haben wir uns getäuscht, so strafe uns morgen wie du willst.›
Der drehbare Justinianus!—das war so handgreiflich, die Beteuerung des Anicius, diese Geheimpforte oft durchschritten zu haben, so herausfordernd:—man konnte dergleichen doch kaum lügen. Justinianus nahm unsern Vorschlag an.
In der Nacht führte Anicius den Kaiser und uns drei in die Gärten der Kaiserin. Ein hohler Platanenbaum barg die Mündung des unterirdischen Ganges, der unter dem Mosaik des Vorplatzes von Theodoras Grab endete.
Bis dahin noch hatte Justinian seinen Glauben an die Kaiserin gewahrt. Als aber Anicius wirklich eine Marmorplatte beiseite schob, mit geheimem, aus seinem Hause geholtem Schlüssel ein Geheimschloß öffnete, und nun die Statue sichtbar ward—da sank der Kaiser, halb ohnmächtig, in meine Arme. Endlich raffte er sich auf und drang, an der Statue vorbei, er allein, in das Gemach.
Dämmerlicht erfüllte den Raum. Die matt leuchtende Ampel zeigte das Pfühl Theodoras. Leise, wankenden Schrittes eilte der Betrogene an das Lager.
Da lag Theodora, vollangekleidet, in kaiserlichem Schmuck. Ein greller Aufschrei Justinians rief uns alle an seine Seite. Und aus dem Vorgemach Galatea, deren ich mich sofort bemächtigte.
Justinian wies, starr vor Entsetzen, auf die ruhende Kaiserin.—Wir traten hinzu—sie war tot. Galatea, nicht minder überrascht hiervon als wir, verfiel in Krämpfe.
Wir untersuchten einstweilen das Gemach, und fanden auf goldnem Dreifuß die Asche zahlreicher verbrannter Papyrusrollen. Antonina rief Sklavinnen mit Licht herbei. Da erholte sich Galatea und erzählte, händeringend, die Kaiserin habe gegen Abend—das war die Zeit unserer Audienz gewesen—ohne Gefolge das Gartenviertel verlassen, den Kaiser, wie sie oft pflegte zu dieser Stunde, in seinem Schreibgemach aufzusuchen.
Sehr rasch sei sie zurückgekommen: ruhig, jedoch auffallend bleich. Sie habe den Dreifuß mit glühenden Kohlen füllen lassen und darauf sich eingeschlossen. Auf Galateas Pochen habe sie am Abend geantwortet, sie sei schon zur Ruhe gegangen und bedürfe nichts weiter.
Da warf sich der Kaiser wieder über die geliebte Leiche: und nun, im Glanz der Lichter, entdeckte er, daß an dem Schlangenring, einst Kleopatra eigen, den sie am kleinen Finger trug, die Rubinkapsel mit dem tödlichen Gift geöffnet war—: die Kaiserin hatte sich selbst getötet. Auf dem Citrustisch lag ein Streifen Pergament, darauf stand ihr alter Wahlspruch: ‹Leben ist herrschen durch Schönheit›.
Wir zweifelten noch, ob etwa die Qualen ihrer Krankheit oder die Entdeckung ihres drohenden Sturzes sie zur verzweifelten Tat getrieben. Aber bald ward unser Zweifel gelöst. Als die Kunde von dem Tod der Kaiserin den Palast durchdrang, eilte Theophilos, der Velarius, der Türwächter des Kaisers, halb verzweifelt, in das Sterbegemach, warf sich vor Justinianus nieder und gestand: er ahne den Zusammenhang.
Seit Jahren im geheimen Solde der Kaiserin habe er dieser jedesmal zu wissen getan, wann der Kaiser solche Audienzen erteilte, bei welchen er auch der Kaiserin, falls sie komme, den Zutritt im voraus versagte—. Sie habe dann fast immer aus einem Seitengemach die geheimsten Verhandlungen mit angehört.
So habe er auch gestern getan, als wir, mit so ganz besondrer Einschärfung der Fernhaltung der Kaiserin, Audienz erhielten. Alsbald sei die Kaiserin erschienen, aber kaum habe sie von Anicius und Antonina einige Worte vernommen, als sie, mit leis ersticktem Schrei, in den Vorhängen zusammengesunken sei. Rasch gefaßt habe sie sich dann erhoben und sich, ihm Schweigen zuwinkend, entfernt.——
Narses drang in den Kaiser, Galatea auf der Folter nach weiteren Geheimnissen zu befragen, aber Justinian sprach: ‹Ich will nicht weiter forschen›.
Tag und Nacht blieb er allein, eingeriegelt, bei der Leiche der immer noch Geliebten, die er darauf mit höchsten kaiserlichen Ehren beisetzen ließ in der Sophienkirche. Amtlich wurde verkündet: die Kaiserin sei an Kohlendunst im Schlaf erstickt, und der Dreifuß mit den Kohlen ward öffentlich ausgestellt.
Justinian aber war in jener Nacht ein Greis geworden.—
Die nunmehr völlig übereinstimmenden Aussagen von Antonina, Anicius, Belisar, Photius, den Sklavinnen Antoninas, den Sänftenträgern, die dich kurz vor der Verhaftung Belisars an sein Haus getragen, deckten nun schlagend auf, daß du, im Bunde mit der Kaiserin, Belisar durch Antonina beredet habest, sich zum Schein an die Spitze der Verschworenen zu stellen: und ich beschwor, daß schon Wochen vorher Belisar mir seinen heiligen Zorn über das Ansinnen des Photius geäußert.
Justinian eilte in Belisars Kerker, umarmte ihn unter Tränen, erbat Verzeihung für sich—und Antonina, die all ihre unschuldigen Liebeständeleien reuig beichtete und volle Vergebung erhielt.
Der Kaiser bat Belisar, zur Sühne, den Oberbefehl in Italien anzunehmen. Belisar aber sprach: ‹Nein, Justinianus: meine Arbeit auf Erden ist getan! Ich gehe mit Antonina auf meine fernste Villa in Mesopotamien und begrabe dort mich und meine Vergangenheit. Ich bin geheilt von der Krankheit, dir dienen zu wollen. Willst du mir eine letzte Gnade erweisen, so gib meinem großen Freund und Erretter, gib Narses den Heerbefehl in Italien: er soll mich rächen an den Goten und an dem Satan, der Cethegus heißt.› Und vor unsern gerührten Augen umarmten sich die beiden großen Feinde.
Dies alles ist in tiefstes Geheimnis gehüllt, um das Andenken der Kaiserin zu schonen. Denn Justinian liebt sie noch immer. Es wurde verkündet: Belisars Unschuld sei von Narses, Tribonian und mir durch neu gefundene Briefe der Verschwornen aufgedeckt. Und Justinian begnadigte alle Verurteilten: auch Scävola und Albinus, die dereinst von dir Gestürzten.
Ich aber schreibe dir die Wahrheit, dich zu warnen und zu retten.
Denn, obzwar ich nicht weiß, in welcher Art und Weise, steht mir doch fest, daß Justinian deinen Untergang geschworen und Narses deine Vernichtung übertragen hat.
Flieh—: rette dich! Dein Ziel: ein freies, verjüngtes, von dir allein beherrschtes Rom war ein Wahn. Ihm hast du alles, auch unsre schöne Freundschaft geopfert.
Ich begleite Belisar und Antonina: und ich will suchen, in ihrer Nähe, an dem Anblick der vollversöhnten Gatten und ihres Glücks, den Ekel, Zweifel und Verdruß über alles Menschliche zu verwinden.»
Cethegus sprang auf vom Lager, warf den Brief nieder und machte einen hastigen Gang durch das Zelt.
«Schwächling Prokop! Und Schwächling Cethegus—: sich um eine dir verlorene Seele mehr zu ereifern! Hast du nicht Julius verloren, lang bevor du ihn getötet? Und lebst und ringst doch fort! Und dieser Narses, den sie alle fürchten, als sei er Gott Vater und der Teufel in einer Person:—soll er denn wirklich so gefährlich sein? Unmöglich! Er hat ja mir und den Meinigen blindlings Rom anvertraut! Nicht sein Verdienst, daß ich nicht in diesem Augenblick, unerreichbar seinen Händen, vom Kapitol herab Rom beherrsche und ihm Trotz biete. Bah: ich lerne es nicht mehr, mich zu fürchten auf meine alten Tage. Ich vertraue meinem Stern! Ist das Tollkühnheit? Ist's ruhigste Klugheit? Ich weiß es nicht. Aber mir ist: die gleiche Zuversicht hat Cäsar von Sieg zu Sieg geführt. Indes: hier habe ich kaum noch mehr zu erfahren aus den Badegesprächen des Narses, als ich aus diesem wortreichen Brief erfuhr.»
Und er zerriß die Papyrusrollen in kleine Stückchen.
«Ich breche auf, noch heute, auch wenn Syphax nichts weiter erlauscht in diesem Augenblick—: denn jetzt ist ja wohl die Badestunde.»
Da ward von den Isauriern Johannes der Archon gemeldet und, auf des Cethegus Wink, hereingeführt.
«Präfekt von Rom», sprach ihn dieser an, «ich habe dir ein altes Unrecht noch abzubitten. Der Schmerz um meinen Bruder Perseus hat mich damals argwöhnisch gemacht.»
«Laß das ruhn», sprach Cethegus, «es ist vergessen.»
«Aber unvergessen», fuhr jener fort, «ist mir deine heldenkühne Tapferkeit. Diese zu ehren und zu nützen zugleich komme ich mit einem Vorschlag zu dir. Ich und meine Kameraden, an Belisars frisches Drauflosgehen gewohnt,—wir finden diese vorsichtige Weise des großen Narses äußerst langweilig. Liegen wir nun doch bald zwei Monate vor jenem Paß, verlieren Leute und gewinnen wahrlich keinen Ruhm dabei. Aushungern will der Oberfeldherr die Barbaren! Wer weiß, wie lange das noch währt. Und dann wird es ein hübsches Gemetzel, wann sie endlich vorbrechen, von der Verzweiflung getrieben, jeden Tropfen Bluts teuer verkaufend. Es ist nun klar, wenn wir nun die Mündung des verfluchten Engpasses hätten...—»
«Ja, wenn!» lächelte Cethegus. «Er ist nicht schlecht gehütet von diesem Teja.»
«Eben deshalb muß er fallen. Er, der König, hält offenbar den ganzen Bündel lockerer Speere noch allein zusammen. Darum habe ich mit einer Schar—mehr als ein Dutzend etwa—der besten Klingen im Lager einen Bund geschlossen. Wir wollen—es kann ja immer nur einer zum Nahekampf heran, so schmal ist der Felsensteig—sooft den König die Wache trifft, einer nach dem andern—das Los entscheidet den Vortritt—den König bestehen. Die andern halten sich so nahe als möglich hinter dem Vorkämpfer, retten den Verwundeten, oder treten an des Gefallenen Stelle oder dringen mit dem Sieger nach des Goten Erlegung in den Paß. Außer mir sind dabei die Langobarden Alboin, Gisulf und Autharis, die Heruler Rodulf und Suartua, Ardarich der Gepide, Gundebad der Burgunde, Clothachar und Bertchramm, die Franken, Vadomar und Epurulf, die Alamannen, Garizo, der lange Bajuvare, Kabades der Perser, Althlas der Armenier, Taulantius der Illyrier.
Wir möchten auch gern dein gefürchtet Schwert dabei haben. Du hassest diesen schwarzlockigen Helden. Willst du, Cethegus, mit im Bunde sein?»
«Gern», sprach dieser, «solang' ich noch hier bin.
Aber ich werde das Lager hier bald mit dem Kapitol vertauschen.»
Ein seltsames, spöttisches Lächeln flog über des Archonten Antlitz, das Cethegus nicht entging. Aber er deutete es nicht richtig. «An meinem Mut kannst du, nach deinen eignen Worten, nicht wohl zweifeln», sagte er. «Aber es gibt für mich noch Wichtigeres, als hier die letzten glimmenden Kohlen des Gotenkrieges auszutreten. Die verwaiste Stadt verlangt ihren Präfekten. Mich ruft das Kapitol.»
«Das Kapitol!»——wiederholte Johannes. «Ich dächte, Cethegus, ein frischer, schöner Heldentod ist auch was wert.»
«Ja, nachdem des Lebens Ziele erreicht sind.»
«Keiner aber von uns weiß, o Cethegus, wie nah ihm dieses Ziel gerückt ist.—Aber noch eins.
Es kommt mir vor, als ob sich bei den Barbaren etwas vorbereite auf ihrem verfluchten Feuerberg. Von dem Hügel auf meiner Lagerseite kann man ein klein wenig durch eine Spalte über die Lavaspitzen gucken. Dein geübtes Auge möchte ich dahin richten. Sie sollen uns doch mit ihrem Hervorbrechen wenigstens nicht überraschen. Folge mir dorthin. Aber schweige von jenem Bund vor Narses:—er liebt das nicht—. Ich wählte die Stunde seines Bades zu diesem Besuch bei dir.»
«Ich folge», sagte Cethegus, vollendete seine Bewaffnung und ging, nachdem er vergeblich bei der isaurischen Schildwache nach Syphax gefragt, mit Johannes quer durch sein eignes, dann durch des Narses Mittellager und bog endlich in das äußerste rechte, das Lager des Johannes ein.
Auf der Krone des von diesem erwähnten Hügels standen bereits mehrere Heerführer, die eifrig über eine kleine Senkung der Lavawälle hinweg in den hier sichtbaren schmalen Teil der gotischen Lagerungen spähten.
Nachdem Cethegus einige Zeit hinübergeblickt, rief er: «Kein Zweifel! Sie räumen diesen Teil, den östlichsten, ihres Lagers: sie fahren die ineinandergeschobenen Wagen auseinander und ziehen sie weiter nach rechts, nach Westen: das deutet auf Zusammendrängung, vielleicht auf ein Hervorbrechen.»
«Was meinst du»,—fragte da rasch den Johannes ein junger, offenbar eben erst aus Byzanz angelangter Heerführer, den Cethegus nicht kannte «was meinst du? Könnten die neuen Ballisten nicht von jener Felsennase aus die Barbaren erreichen? Weißt du, des Martinus letzte Erfindung,—die mein Bruder nach Rom schaffen mußte?»
« Nach Rom?» rief Cethegus und warf einen blitzenden Blick auf den Frager und auf Johannes.
Heiße und kalte Schrecken jagten urplötzlich ihm durch Herz und Mark—: erschütternder, als da er die Nachricht von Belisars Landung, von Totilas Erhebung, von Totilas Abschwenkung nach Rom bei Pons padi, von Totilas Eindringen auf dem Tiber, von Narses' Ankunft in Italien erfahren. Ihm war, als kralle sich eine zerdrückende Hand ihm um Herz und Hirn. Scharf erkannte er, daß Johannes mit einem grimmigen Furchen der Brauen dem jungen Frager Schweigen gewinkt.
« Nach Rom?» wiederholte Cethegus tonlos, bald den Fremden, bald Johannes mit seinem Auge durchbohrend.
«Nun ja, freilich nach Rom!» rief endlich Johannes. «Zenon, dieser Mann ist Cethegus, der Präfekt von Rom.» Der junge Byzantiner neigte sich mit dem Ausdruck, mit welchem man etwa ein vielgenanntes Ungetüm zum erstenmal vor sich sieht. «Cethegus, Zenon hier, der Archon, der bisher am Euphrates gefochten, ist erst gestern abend mit persischen Bogenschützen aus Byzanz angekommen.»
«Und sein Bruder?» fragte Cethegus, « ist nach Rom!»
«Mein Bruder Megas», antwortete, nun gefaßt, der Byzantiner, «hat den Auftrag, dem Präfekten von Rom»—und hier neigte er abermals das Haupt—«die neu erfundenen Doppelballisten für die Wälle Roms zur Verfügung zu stellen. Er hat sich lange vor mir eingeschifft:—so glaubt' ich ihn schon vor mir eingetroffen und mit dir nach Rom abgezogen. Aber seine Fracht ist schwer.
Und ich freue mich, den gewaltigsten Mann des Abendlandes, den glorreichen Verteidiger des Hadrianusgrabes von Angesicht kennen zu lernen.»
Aber Cethegus warf noch Johannes einen scharfen Blick zu und wandte sich dann, mit kurzem Abschiedsgruß an alle Versammelten, zum Gehen. Nach einigen Schritten sah er sich rasch, plötzlich sich wendend, um und bemerkte, wie Johannes mit beiden Fäusten drohend auf den geschwätzigen jungen Archonten vom Euphrat hineinschalt.
Ein kalter Schauer rüttelte den Präfekten. Er wollte auf dem kürzesten Wege nach seinem Zelt zurückgehn und unverzüglich, ohne Syphax und dessen Entdeckungen abzuwarten, zu Pferde steigen und, sonder Abschied, nach Rom eilen. Um jenen kürzesten Weg zu erreichen, wollte er aus des Johannes Lager heraustreten und auf der Sehne des großen Lagerbogens seine eignen Zelte gewinnen.
Vor ihm ritten einige persische Schützen aus dem Lager: auch Bauern, die Wein verkauft hatten, ließen die Wachen unbehindert hindurch. Es waren Langobarden, denen, wie überall, auch in diesem Lagerteil Narses die Lagerausgänge übertragen. Sie hielten ihn an mit gefällten Speeren, als er den Landleuten folgen wollte. Er griff zornig in die Lanzen, rasch sie teilend.
Da stieß der eine der Langobarden ins Horn: die andern schlossen sich wieder fest vor Cethegus. «Befehl des Narses!» sprach Autharis, der Führer. «Und jene?» fragte der Präfekt, auf die Bauern und die Perser deutend. «Sind nicht du», sprach der Langobarde.
Eine Schar Lagerwachen war noch herbeigeeilt auf jenen Hornruf. Sie spannten die Bogen. Cethegus wandte ihnen schweigend den Rücken und ging auf dem gleichen Wege, der ihn hergeführt, zurück nach seinem Zelt.
Vielleicht war es nur sein plötzlich erregtes Mißtrauen, das ihm vorspiegelte, alle Byzantiner und Langobarden, durch die er dahin schritt, wichen ihm mit halb spöttischen, halb mitleidigen Blicken aus.
Vor seinem Zelt befragte er die isaurische Schildwache: «Syphax zurück?»—«Ja, Herr, längst. Er harrt deiner sehnlich im Zelt. Er ist verwundet.» Rasch schlug Cethegus die Vorhänge zurück und trat ein.
Da flog ihm Syphax, bleich unter seiner Bronzehaut, entgegen, umklammerte seine Knie und flüsterte mit leidenschaftlicher, verzweifelter Erregung:
«O mein Herr, mein großer Löwe! Du bist umgarnt—verloren—nichts kann dich mehr retten.»
«Mäßige dich, Sklave!» gebot Cethegus. «Du blutest...—»—«Es ist nichts! Sie wollten mich nicht in dein Lager zurücklassen—sie fingen in scheinbarem Scherz Streit mit mir an, aber ihre Messerstiche waren bitterer Ernst...—»—«Wer? Wessen Messerstiche?»—«Der Langobarden, Herr, die seit einer halben Stunde alle Ausgänge deines Lagers doppelt besetzt haben.»—«Ich werde Narses um den Grund fragen», drohte Cethegus.—«Der Grund, das heißt der Vorwand—er sandte Kabades, dir das zu melden—ist ein Ausfall der Goten.—Aber, o mein Löwe—mein Adler—mein Palmbaum—mein Brunnquell—mein Morgenstern—du bist verloren!» Und wieder warf sich der Numider auf das Antlitz vor seinen Herrn und bedeckte dessen Füße mit glühenden Tränen und Küssen.
«Erzähle—der Ordnung nach», sprach Cethegus, sich an den Mittelpfahl des Zeltes lehnend, mit auf den Rücken gekreuzten Armen und hoch das Haupt emporgerichtet: nicht auf Syphax' verzweifeltes Antlitz, in die leere Ferne schien er zu schauen.
«O Herr—ich werd's nicht können in klarer Folge.—Also—ich erreichte das Schilfversteck—ich brauchte kaum zu tauchen—mich barg das Geröhricht—das Badezelt ist von dünnem Holz und von Leinwand neu errichtet, nach den letzten Stürmen—Narses kam in seinem kleinen Boot, Alboin, Basiliskos und noch drei Männer als Langobarden verkleidet—aber ich erkannte Scävola, Alinus...»—«Ungefährlich», unterbrach Cethegus.—«Und—Anicius!»—«Irrst du dich nicht?» fuhr Cethegus auf.—«Herr, ich kenne das Auge und die Stimme! Aus dem Gespräch—ich verstand nicht alle Worte,—aber den Sinn ganz klar»—«Ei, hättest du mir doch die Worte sagen können!»—«Sie sprachen griechisch, Herr: ich verstehe das doch nicht so gut, wie deine Sprache, und die Wellen machten Geräusch, und der Wind war nicht günstig.»—«Nun, was sagten sie?»—«Die drei sind erst gestern abend aus Byzanz eingetroffen: sie forderten sofort deinen Kopf.
Narses aber sprach: ‹Nicht Mord: Richterspruch, nach voll durchgeführtem Prozeß: und Richterstrafe.›
‹Wann endlich?› drängte Anicius. ‹Sobald es an der Zeit.›—‹Und Rom?› fragte Basiliskos. ‹Rom sieht er niemals wieder.›»
«Halt», rief Cethegus, «halt inne! Einen Augenblick! Klar muß ich hierin sein.» Er schrieb ein paar Zeilen auf ein Wachstäfelchen. «Ist Narses zurück aus dem Bade?»—«Längst.»—«Gut.» Er gab einem der vor dem Zelte wachenden Isaurier die Wachstafel. «Augenblicklich bringst du Antwort.—Fahre fort!» Aber Cethegus vermochte nicht mehr still zu stehen, hastig ging er im Zelte auf und nieder.
«O Herr, in Rom muß ein Ungeheures geschehen sein:—ich konnte nicht genau verstehen, was. Anicius stellte eine Frage: darin nannte er deine Isaurier. ‹Den Führer Sandil bin ich losgeworden›, sagte Narses. ‹Und der Rest ist ja in Rom gut aufgehoben durch Aulus und die Brüder Macer, meine Lockvögel›, fügte er lachend bei.»—«Nannte er diese Namen?» forschte Cethegus ernst, «braucht' er dies Wort?»—«Ja, Herr. Dann sprach Alboin: ‹Gut ist's, daß die jungen Tribunen fort: es hätte scharf Gefecht gekostet.› Und Narses schloß: ‹Alle Isaurier mußten fort. Sollten wir eine blutige Schlacht im eignen Lager schlagen und König Teja plötzlich dazwischenfahren?›—O Herr, ich fürchte, sie haben deine Treuesten von dir hinweggelockt.»
«Ich glaub' es auch», sprach Cethegus finster. «Aber was sprachen sie von Rom?»—«Alboin fragte nach einem Führer, dessen Namen ich nie gehört.»—«Megas?» rief Cethegus.
«Ja, Megas! so hieß er—woher weißt du...—!»
«Gleichviel! Fahre fort! Was ist' mit diesem Megas?»
«Alboin fragte, wie lange wohl schon Megas in Rom sei?—‹Jedenfalls›, antwortete Narses, ‹frühe genug für die römischen Tribunen und die Isaurier.›»
Da stöhnte Cethegus laut und schmerzlich aus tiefster Brust.
«‹Aber die Bürger Roms?› forschte Scävola, ‹sie vergötterten diesen Tyrannen und seine jungen Ritter!›—‹Ja ehemals: jetzt aber hassen und fürchten sie nichts so sehr als den Mann, der sie mit Gewalt wieder zu Römern, zu Helden machen wollte.›—‹Aber wenn sie ihn doch wieder aufnehmen wollten? Allbezwingend ist seines Namens Gewalt!› fragte furchtsam Albinus.
‹Fünfundzwanzigtausend Armenier im Kapitol und im Grabmal Hadrians halten die Römer noch strenger gebunden...—›»
Da schlug sich Cethegus die linke Hand grimmig vor die Stirn.
«‹Noch strenger gebunden als Papst Pelagius und ihr Vertrag und Eid.›—‹Ihr Vertrag und Eid?› forschte Scävola. ‹Ja, ihr Vertrag und Eid! Sie haben geschworen: ihre Stadt nur dem Präfekten von Rom zu öffnen.› ‹Nun und?› rief Anicius.—‹Nun und: sie wissen und wußten damals schon: daß seit drei Monaten der Präfekt von Rom heißt—Narses! Mir, nicht ihm haben sie geschworen!›» Da warf sich Cethegus schweigend auf das Lager und verhüllte sein Haupt in seinem purpurgesäumten Mantel. Keine laute Klage entrang sich mehr der gewaltigen Brust.
«O mein teurer Herr—er wird dich töten!—Aber ich bin noch nicht zu Ende—du mußt alles wissen—auf daß dich Verzweiflung zum Äußersten kräftigt: wie der umstellte Löwe mehr als Löwenkraft gewinnt.»
Cethegus erhob sich wieder. «Vollende», sprach er. «Was ich noch zu hören habe, ist gleichgültig: es kann nur mich, nicht mehr Rom angehn.»
«Aber dich geht es furchtbar an!—‹Gestern›, fuhr Narses fort—nach einigen Reden, die das Wellengeräusch mir entzog, ‹gleichzeitig mit der langerwarteten Nachricht...—aus Rom...—›»—«Welche Nachricht?» fragte Cethegus.
«Das sagte er nicht.—‹Gleichzeitig brachte Zenon mir die Weisung, das versiegelte Schreiben des Kaisers zu öffnen: denn mit Recht nimmt dieser nach meinem letzten Bericht an, daß den Untergang der Goten jeder Tag heraufführen kann. Ich öffnete und›—o Herr—es ist schrecklich...—»
«Rede!»
«‹Des großen Justinians ganze Kleinheit spricht daraus›, sprach Narses. ‹Er würde ihm, glaub' ich, viel leichter verzeihn, daß er den Kaiser der Gerechtigkeit fast dahin verleitet, den allgetreuen Belisar zu blenden, als Justinianus ihm verzeiht, mit Theodora im Bunde, als Verführer Theodoras!—ein furchtbarer Anachron...› mehr verstand ich nicht—» «Anachronismus!» sagte Cethegus, ruhig verbessernd.
—«‹Den Kaiser hintergangen, überlistet zu haben. Das Los, das er Belisar um ein Haar bereitet hätte, soll ihn selbst treffen...—Blendung.›»
«Wirklich?» lächelte Cethegus. Doch er griff an den Dolch.
«‹Und jene Strafe, die er, gotteslästerlich Christi Tod entweihend und Kaiser Constantins Gesetz verletzend, in seinem Rom wieder eingeführt...—›—Was kann er damit meinen?» forschte Syphax bang.
«Kreuzigung!» antwortete Cethegus, den Dolch wieder bergend. «O Herr!»—«Gemach, noch hang' ich nicht in der Luft: noch schreite ich fest auf der heldennährenden Erde. Vollende.»
«‹Ich aber bin›, fuhr Narses fort, ‹der Feldherr und nicht der Folterknecht Justinians: und er wird sich wohl begnügen müssen, wenn ich des tapfern Mannes Haupt nach Byzanz schicke.› Aber o nur das nicht—nur das nicht, Herr! wenn wir sterben müssen.»
«Wir?» lächelte Cethegus, wieder ganz gesammelt. «Du hast nicht mit Theodora den großen Kaiser der Romäer überlistet. Dir droht nicht Gefahr.» Aber Syphax fuhr fort:
«Weißt du's denn nicht? O zweifle nur daran nicht:—ganz Afrika weiß es—fehlt der Leiche das Haupt, muß die Seele als unrein niedres Gewürm ohne Kopf äonenlang durch Schlamm und Kot schleichen. O nur nicht dein Haupt vom Rumpfe getrennt!»
«Noch ruht es fest auf diesem Nacken, wie auf dem Atlas das Himmelsgewölbe. Still—man kommt.»
Der Isaurier, den er an Narses gesendet, brachte die versiegelte Antwort: «An Cethegus Cäsarius Narses, Magister militum. Deinem Wunsch, nach Rom aufzubrechen, steht auch heute nichts im Wege.»—«Ich begreife jetzt», sprach Cethegus.
«Die Lagerwachen haben Befehl, dich abreiten zu lassen. Doch geb' ich dir, falls du auf der Abreise beharrst, tausend Langobarden, unter Alboin, zur Bedeckung mit.
Die Straßen sind unsicher durch versprengte Goten.
Da, allem Anschein nach, heute noch oder morgen ein Durchbruchversuch der Goten droht und wiederholt tollkühnes Verlassen der Lager den Verlust von Führern und Truppen herbeigeführt hat, ist niemand mehr ohne meine Erlaubnis das Lager zu überschreiten verstattet und haben alle Wachen, auch die Zeltwachen, meine verlässigen Langobarden bezogen.»
Rasch sprang Cethegus gegen die Türe seines Zeltes und riß sie auf: seine vier Isaurier wurden abgeführt, zwanzig Langobarden unter Autharis zogen vor seinem Zelte auf. «Ich dachte noch an Flucht für heute nacht», sprach er zu Syphax. «Sie ist abgeschnitten. Und es ist besser so, würdiger.
Lieber den Gotenspeer in die Brust als den Griechenpfeil in den Nacken. Aber Narses ist noch nicht zu Ende: ‹In meinem Zelt magst du vernehmen, welche Maßregeln ich gegen das durch den Ausfall der Barbaren drohende, vielleicht sehr große Blutbad getroffen. Noch aber habe ich eine dir schmerzliche Mitteilung zu machen. Gestern abend über See von Rom einlaufende Nachrichten melden, daß der größte Teil der Isaurier in Rom und deine Tribunen... ›»
«Ha, mein Licinius, Piso, Julianus!» schrie der Präfekt, aus seiner eisigen, todesverachtenden Ruhe durch heißen Schmerz emporgeschreckt: ‹Getötet worden sind. Sie weigerten, friedlich eingelassen›—ha, schändlich hineingelockt!—‹dem Kaiser den Gehorsamseid: sie wollten, gegen den Vertrag, Gewalt brauchen, Lucius Licinius wollte das Kapitol mit Sturm nehmen, Salvius Julianus das Grabmal Hadrians—Piso die Porta latina—sie fielen, jeder vor seinem Angriffsziel:—der Rest der Söldner ist gefangen.›
«Mein zweiter Julius folgt dem ersten nach!» sprach Cethegus. «Nun, ich brauche keinen Erben mehr:—denn Rom wird nicht mein Eigentum und Nachlaß.
Es ist vorbei.——
Der große Kampf um Rom ist aus.
Und die dumpfe Überzahl, die kleine Pfiffigkeit hat gesiegt, wie über der Goten Schwerter, so über des Cethegus Geist. O Römer—Römer, ‹ auch ihr, meine Söhne?› Ja, meine Bruti seid ihr!—
Syphax, du bist frei. Ich gehe in den Tod—: geh du frei zurück in deine freie Wüste.»
«O Herr», rief Syphax, laut aufschluchzend und sich auf den Knien vor ihm hinwälzend—«stoß mich nicht von dir: ich bin nicht minder treu als Aspa ihrer Herrin war:—laß mich mit dir sterben.»—«Es sei», sagte Cethegus ruhig, die Hand auf des Mauren Haupt legend «Ich hab' dich lieb gehabt—mein Panther—: spring denn mit mir in den Tod. Reiche mir Helm, Schild, Schwert und Speer.»—«Wohin?»—«Erst zu Narses.»—«Und dann?»—«Auf den Vesuvius!»
Die Absicht König Tejas war gewesen, in der kommenden Nacht mit allen Waffenfähigen, bis auf einige Wächter des Engpasses, sich vom Vesuv herab auf das Lager des Narses zu werfen und in demselben, begünstigt durch das Dunkel und die Überraschung, noch ein furchtbares Blutbad anzurichten: war der Letzte der Ausfallenden erlegen, und drohte nun, etwa bei Tagesanbruch, der Angriff auf den Engpaß, so sollten die Wehrunfähigen, die nicht die Knechtschaft dem Tode vorzogen, durch den Sprung in den nahen Krater des Vesuvs ein freies Grab suchen, wonach auch die Verteidiger des Passes durch Hervorbrechen aus der Schlucht ein rasches Ende machen sollten.
Es hatte den König mit freudigem Stolz erfüllt, daß auch nicht eine Stimme unter den Tausenden von Frauen und Mädchen—denn alle Knaben vom zehnten Jahre an und alle Greise wurden bewaffnet—die entehrende Sklaverei und das Leben statt des Todes im Vesuv gewählt hatte, als Teja den Versammelten in der Wagenburg die Wahl anheimgestellt.
Sein Heldenherz erfreute sich an dem Gedanken, daß sein ganzer Stamm in einer in der Geschichte der Völker unerhörten Tat, in glorreichem Heldentod, wie ein Mann, seine große Vergangenheit ruhmvoll besiegeln wollte. Dieser Verzweiflungsgedanke des tod-grimmen Helden wurde nicht verwirklicht: aber sein brechendes Auge sollte statt jenes grauenhaften Bildes ein helleres, ein versöhnendes schauen.
Narses, immer wachsam und vorsichtig, hatte schon vor Johannes und Cethegus die drohenden Vorbereitungen der Feinde wahrgenommen und den Rat der Feldherrn auf die fünfte Tagesstunde in sein Zelt berufen, seine Gegenmaßregeln zu erfahren.
Es war ein wunderbarer, goldner September: voll Schimmer des Lichts und Schimmer des Dufts über Land und Meer: wie er in solcher strahlenden Schönheit auch in Italien nur über den Golf von Bajä sich ergießt. In den lichtgesättigten Himmel stieg spielend die weiße Kräuselwolke des Vesuvs: Mit rhythmischem Anschlag rollten die letzten, leisen Meereswellen, wie huldigend, an das wunderschöne Land.
Da schritt hart an dem Saume der Flut hin, so daß die rollenden Wellen manchmal seine gepanzerten Füße berührten, langsam, den Speer über der Schulter, von dem linken Lagerflügel her, einsam ein gewaltiger Mann. Die Sonne glitzerte auf seinem runden Schild, auf dem prachtvollen Panzer: der Seewind spielte in seinem purpurnen Helmbusch.
Es war Cethegus: und er schritt auf dem Todesweg.
Nur von weitem folgte ihm, ehrfürchtig, der Maure.
Angelangt an einem schmalen Vorsprung des Küstensandes in den Golf hinein, ging er bis an die äußerste Spitze dieser kleinen Landzunge, wandte sich und blickte nach Nordwesten. Dort lag Rom: sein Rom.
«Lebt wohl», sprach er tief bewegt, «lebt wohl, ihr sieben Hügel der Unsterblichkeit. Leb' wohl, Tiberstrom, der du den ehrwürdigen Schutt der Jahrhunderte dahin spülst: zweimal hast du mein Blut getrunken, zweimal mich gerettet. Nun rettest du mich nicht mehr, befreundeter Flußgott! Gerungen hab' ich und gekämpft um dich, mein Rom, wie keiner, wie selbst Cäsar nicht, vor mir.
Die Schlacht ist aus: geschlagen ist der Feldherr ohne Heer. Ja, ich erkenne es nun: alles kann der gewaltige Geist des einzelnen ersetzen, nur nicht ein fehlend Volk.
Sich selbst jung erhalten kann der Geist, nicht andre verjüngen. Ich habe das Unmögliche gewollt. Aber das Mögliche erreichen ist—gewöhnlich. Und spränge mir noch einmal aus meines zertrümmerten Cäsar Marmorhaupt der große Gedanke entgegen dieses Kampfes um Rom:—gepanzert, wie Athene aus dem Haupte des Zeus——ich kämpfte ihn noch einmal, diesen Kampf. Denn besser ist's, um das Übermenschliche ringend erliegen, als in der dumpfen Ergebung unter das Gemeine dahingehn.
Du aber sei mir gesegnet»—und er kniete nieder und netzte die heiße Stirn unter dem ehernen Helm mit der salzigen Flut—«du aber sei mir gesegnet, Ausonias heilige Meerflut: sei mir gesegnet, Italias heiliger Boden»—und er griff mit der Hand tief in den Sand der Küste: «Dankbar scheidet von dir dein treuester Sohn—: erschüttert, nicht von dem Grauen des nahenden Todes, erschüttert allein von deiner Herrlichkeit. Lange Jahrhunderte ahn' ich für dich drückender Fremdherrschaft. Ich habe sie nicht von dir zu wenden vermocht: aber mein Herzblut bring' ich als Wunschopfer dar. Ist der Lorbeer deiner Weltherrschaft verdorrt für immer—dir lebe fort, unzertretbar, still grünend unter dem Staube, die Olive des Freiheitssinns und deines Volkes edle Eigenart. Und einst leuchte der Tag dir herauf, mein Rom, mein italisches Land, da kein Fremder mehr herrscht auf deinem geheiligten Boden, da du allein dir selber gehörst von den heiligen Alpen zum heiligen Meer.»
Und ruhig erhob er sich nun und schritt, rascheren Ganges, nach dem Mittellager und dem Feldherrnzelt des Narses.
Beim Eintreten fand er die Heerführer alle versammelt, und Narses rief ihm freundlich entgegen: «Zur guten Stunde kommst du, Cethegus. Zwölf meiner Feldherren, die ich auf einem Bund der Tollheit ertappt, wie sie etwa die Barbaren, aber nicht Schüler des Narses, begehen möchten, haben sich zur Entschuldigung auf dich berufen: es könne keine Tollheit sein, woran sich der geistesgewaltige Cethegus selbst beteilige. Sprich, bist du wirklich jenem Waffenbund gegen Teja beigetreten?»
«Ich bin's, und ich gehe gerad' von hier—laß mir den Vortritt, Johannes, ohne Losung—auf den Vesuv. Die Wachtstunde des Königs naht.»
«Das gefällt mir von dir, Cethegus.»
«Danke: es spart dir wohl manche Mühe, Präfekt von Rom», erwiderte Cethegus.
Eine Bewegung der höchsten Überraschung ging durch alle Anwesenden: denn auch die Eingeweihten staunten über seine Kenntnis der Lage.
Nur Narses blieb ruhig: leise sagte er zu Basiliskos: «Er weiß alles. Und das ist gut.»
«Nicht meine Schuld, Cethegus, daß ich dir nicht früher deine Ersetzung durch mich mitgeteilt: der Kaiser hatte es streng verboten. Ich lobe deinen Entschluß, Cethegus.—Denn er stimmt zu meinen besten Absichten.—Die Barbaren sollen nicht das Vergnügen haben, heute nacht nochmal eine Myriade unserer Leute zu schlachten. Wir rücken sofort mit allen unsern Truppen, auch den beiden Flügeln, bis auf Speerwurfweite vor den Engpaß: sie sollen nicht Raum zum Anlauf gewinnen: und ihr erster Schritt aus der Mündung der Schlucht soll sie in unsre Lanzen führen. Ich habe auch nichts dagegen, Cethegus, wenn Freiwillige jenen König der Schrecken bestehen—: mit seinem Tode, hoff' ich, löst sich der Barbaren Widerstand.
Nur eins macht mich besorgt. Ich habe die ‹jonische Flotte› längst hierher beschieden,—ich hatte die Entscheidung einige Tage früher erwartet—und sie bleibt aus. Sie soll mir die gefangenen Barbaren sofort aufnehmen und nach Byzanz schaffen. Kam noch der Schnellsegler nicht zurück, Nauarch Konon, den ich auf Kundschaft durch die Meerenge von Regium geschickt?»
«Nein, Feldherr! So wenig als ein zweites Eilschiff, das ich selber nachgesandt.»
«Sollte der letzte Sturm die Flotte geschädigt haben?»
«Unmöglich, Feldherr, er war nicht stark genug. Und sie lag ja, nach letzter Botschaft, sicher vor Anker im Hafen von Brundisium.»—«Nun, wir können nicht auf die Schiffe warten. Vorwärts, meine Feldherren, wir brechen alle, ich selber mit, sofort gegen den Engpaß auf. Leb' wohl, Cethegus! Laß dich die Entsetzung nicht anfechten. Ich besorge, es würde dir nach der Beendung des Krieges manch lästiger Prozeß drohen. Du hast viele Feinde: mit Recht und mit Unrecht. Böse Wahrzeichen drohen dir ringsumher. Aber ich weiß, du hast von jeher nur ein Wahrzeichen geehrt: ‹Ein Wahrzeichen nur gilt:›—»
«‹Für die Heimat kämpfend zu fallen.› Nur noch eine Gunst: verstatte mir—meine Isaurier und Tribunen ruhen ja in Rom—die Italier und Römer in deinem Heer, die du unter alle deine Scharen verteilt hast, um mich zu sammeln und sie gegen die Barbaren zu führen»
Einen Augenblick besann sich Narses. «Gut, sammle sie und führe sie!—Zum Tode», sagte er leise zu Basiliskos. «Es sind höchstens fünfzehnhundert Mann—ich gönne ihm die Freude, an der Spitze seiner Landsleute zu fallen—und sie hinter ihm! Leb' wohl, Cethegus.»
Stumm, mit dem erhobenen Speer ihn grüßend, schritt Cethegus hinaus.
«Hm», sagte Narses zu Alboin, «—schau' ihm nur ernsthaft nach, Langobarde. Da geht ein merkwürdiges Stück Weltgeschichte dahin. Weißt du, wer da hinausschritt?»
«Ein großer Feind seiner Feinde», sagte Alboin ernst.
«Ja, Wölflein, schau' dir ihn nochmal an: da geht zu sterben—: der letzte Römer!»——
Als alle Heerführer bis auf Basiliskos und Alboin Narses verlassen hatten, eilten aus dem durch Vorhänge abgesperrten Abschluß des Zeltes Anicius, Scävola und Albinus, noch in langobardischer Kleidung, mit bestürzten Mienen. «Wie?» rief Scävola, «du willst dem Richter diesen Mann entziehen?»—«Und dem Henker», sprach Albinus, «seinen Leib? und seinen Anklägern sein Vermögen?» Anicius nur schwieg und ballte die Faust um den Schwertgriff.
«Feldherr», rief Alboin, «laß die zwei Schreier meines Volkes Kleidung von sich legen. Mich ekelt dieser Kläffer.»
«Du hast nicht unrecht, Wölflein!—Ihr braucht euch nicht mehr zu vermummen», sprach Narses. «Ich bedarf euer nicht mehr als Ankläger.
Cethegus ist gerichtet: das Urteil vollstrecken wird—König Teja. Ihr aber, Rabenschnäbel, sollt nicht noch einhacken auf den toten Helden.»
«Und Kaiser Justinians Befehl?» trotzte hartnäckig Scävola.
«Tote Männer kann auch Justinianus nicht blenden und kreuzigen lassen. Wenn Cethegus Cäsarius gefallen, kann ich ihn nicht wieder aufwecken, für des Kaisers Grausamkeit. Von seinem Gold aber, Albinus, erhältst du keinen Solidus: und du, Scävola, von seinem Blute keinen Tropfen. Sein Gold ist dem Kaiser, sein Blut den Goten, sein Name der Unsterblichkeit verfallen.»
«Den Tod des Helden gönnst du diesem Bösewicht?» grollte jetzt Anicius.
«Ja, Sohn des Boëthius: denn er hat ihn verdient.
Du aber hast ein tüchtig Recht auf Rache an ihm:—du wirst dem Gefallenen das Haupt abschlagen und nach Byzanz dem Kaiser bringen! Hört ihr die Tuba? Das Gefecht begann!»
Als König Teja das ganze Heer des Narses gegen die Mündung des Engpasses in Bewegung sah, sprach er zu seinen Helden: «Wohlan: so schaut denn statt der Sterne die Mittagssonne den letzten Kampf der Goten. Das ist die einzige Änderung unsres Entschlusses.» Er stellte eine Anzahl von Kriegern vor der Lavahöhle auf, wies ihnen die Leiche Theoderichs, auf purpurner Bahre aufgerichtet, und den Königshort und trug ihnen auf, während der Kampf um den Engpaß toben würde, die Purpurbahre und die Truhen in den Vesuv zu schleudern auf Adalgoths Wink, dem er mit Wachis die letzte Obhut des Passes anbefahl.
Die Unwehrhaften drängten sich um die Lavahöhle zusammen—: man sah keine Träne, man hörte kein Schluchzen. Die Krieger aber ordnete Teja nach Hundertschaften, und innerhalb derselben nach den Sippen, so daß Väter und Söhne, Brüder und Vettern nebeneinander fochten: ein Gefüge der Schlachthaufen, dessen grimmige Zähigkeit die römischen Legionen seit den Tagen der Kimbern und Teutonen, des Ariovist und des Armin erprobt. Die natürliche Beschaffenheit des letzten Schlachtfeldes der Goten wies von selbst auf die alte, von Odin gelehrte Schlachtordnung zum Angriff aus dem Engpaß: dem Keil.
Die tiefen, dichten Kolonnen der Byzantiner standen nun, wohl gegliedert, staffelförmig von dem Meeresufer an bis auf Speerwurfweite vor des Passes Mündung hintereinander aufgestellt:—ein prachtvoll schöner, aber furchtbarer Anblick. Die Sonne glänzte auf ihren Waffen, indes die Goten im Schatten der Felsen standen. Weit über die Lanzen und Feldzeichen der Feinde hinweg blickten die Germanen bis in das lachende, schimmernde Meer, das in wonnigem Lichtblau strahlte.
König Teja stand neben Adalgoth, der das Banner Theoderichs trug, in der Mündung des Passes. Der Dichter regte sich in dem Heldenkönig.
«Sieh hin», sprach er zu seinem Liebling, «wo könnten wir schöner sterben? Nicht im Himmel der Christen, nicht in Meister Hildebrands Asgardh oder Breidablick kann es schöner sein. Auf, Adalgoth, laß uns hier sterben, unsres Volkes und dieser schönen Todesstätte wert.»
Und er warf den Purpurmantel zurück, den er über der schwarzen Erzrüstung getragen, nahm die kleine Harfe in den linken Arm und sang mit leiser verhaltener Stimme:
«Vom fernsten Nord bis vor Byzanz,
Bis Rom—welch Siegeswallen!
Der Goten Stern stieg auf in Glanz:—
In Glanz auch soll er fallen.
Die Schwerter hoch um letzten Ruhm
Mit letzter Kraft zu werben:—
Fahr wohl, du stolzes Heldentum:
Auf, Goten,—laßt uns sterben!»
Und mit kräftigem Schlag zerschmetterte er die im Tode noch hellaufklingende Harfe an dem Fels zu seiner Linken.
«Nun, Adalgoth, leb' wohl! Hätt' ich die Reste meines Volkes retten können! Nicht hier! Aber mit freiem Abzug gen Norden!
Es sollte nicht sein. Narses würd's kaum gewähren. Und die letzten Goten bitten nicht. Zum Tod!»
Und die mächtige Streitaxt an lanzengleichem Schaft erhebend, die gefürchtete Waffe, trat er an die Spitze des Keils. Hinter ihm Aligern, sein Vetter, und der alte Hildebrand. Hinter diesen Herzog Guntharis von Tuscien, der Wölsung, Graf Grippa von Ravenna und Graf Wisand von Volsinii, der Bandalarius. Hinter diesen Wisands Bruder: Ragnaris von Tarentum, und vier Grafen, dessen Gesippen. Darauf in steigender Breite, je sechs, acht, zehn Goten.
Den Schluß bildeten dichte Haufen, je nach Zehnschaften geordnet.
Wachis, neben Adalgoth in dem Engpaß haltend, gab, auf des Königs Wink, das Zeichen mit dem gotischen Heerhorn. Und nun brach die Sturmschar ausfallend aus der Schlucht.
Auf der nächsten breiteren Stelle vor dem Paß hielten die mit Johannes verbündeten Helden: nur Alboin, Gisulf und Cethegus fehlten noch. Hinter jenen zehn Führern standen zunächst Langobarden und Heruler, die sofort einen Hagel von Speeren und Pfeilen auf die vorbrechenden Goten schleuderten.
Zuerst sprang gegen den König, den die Zackenkrone auf dem schwarzen, geschlossenen Helm kenntlich machte, Althias, der Armenier. Sofort fiel er mit zerspaltenem Haupt.
Der zweite war der Heruler Rudolf. Er rannte den Speer mit beiden Händen, links gefällt, wider Teja. Dieser fing den Stoß unerschüttert mit dem schmalen Schild und stieß dem von dem Anprall Zurücktaumelnden die lanzengleiche Spitze des Schlachtbeils in den Leib.
Ehe er die Waffe aus dem Geschupp des Waffenrocks reißen konnte, waren zugleich Suartua, des gefallenen Herulers Neffe, der Perser Kabades und der Bajuvare Garizo heran. Letzterem, dem kühnsten und nächsten, stieß Teja den Schnabel des Schildes vor die Brust, daß er über den schmalen, glatten Lavasteig zur Rechten hinabstürzte. «Jetzt hilf, o heil'ge Waldfrau von Neapolis!» betete der Lange, dieweil er flog, «die du mir durch all diese Kriegsjahre geholfen»: und wenig geschädigt kam Miriams Bewunderer unten an, nur schwer betäubt vom Fall.
Dem Heruler Suartua, der das Schwert über Tejas Haupt schwang, schlug Aligern, hinzuspringend, den Arm samt dem Schwerte glatt vom Rumpf. Er schrie und fiel. Dem Perser Kabades, welcher den krummen Säbel von unten schlitzend gegen des König Weichen hob, zerschlug der alte Hildebrand mit der Streitaxt Visier, Antlitz und Gehirn.
Teja, seiner Streitaxt wieder mächtig und der nächsten Angreifer ledig, sprang nun selbst zum Ansturm vor. Er warf die Streitaxt im Schwung gegen einen im Eberhelm—Helm mit Haupt und Hauern des Wildebers—heranschreitenden Feind: Epurulf, der Alamanne war's: er stürzte rücklings. Über ihn beugte sich Vadomar, sein Gesippe, und wollte des Gotenkönigs schreckliche Waffe an sich reißen: aber im Flug war Teja zur Stelle, das kurze Schwert in der Rechten, hoch blitzte es, und Vadomar fiel tot auf seinen toten Freund.
Da rannten zugleich die beiden Franken Chlotachar und Bertchramm, die Francisca, eine Tejas Streitbeil ähnliche Waffe schwingend, herzu: beide Äxte sausten zugleich: die eine fing Teja mit dem Schild auf: die zweite, die hoch im Bogen, sein Haupt bedrohend, heranflog, parierte er mit dem eignen Beil: und rasch stand er zwischen den beiden Feinden, schwang die Axt im Kreise furchtbar um seinen Helm, und auf einen Schwung sanken beide Franken nach links und rechts mit zerspellten Sturmhauben.
Da traf sausend des Königs Schild ein Speer aus nächster Nähe: er durchbohrte den Stahlrand und streifte leicht den Arm. Während Teja sich gegen diesen Feind wandte—der Burgunde Gundobad war's—, lief ihn von hinten der Gepide Ardarich mit dem Schwerte an und schlug ihm einen schweren Streich auf das Helmdach, im Augenblick aber fiel Ardarich, von Herzog Guntharis' Wurfspeer durchbohrt. Und den Burgunden Gundobad, der sich grimmig wehrte, drückte der König mit dem Schild erst aufs Knie, er verlor den Helm, und Teja stieß ihm den Schildstachel in die Kehle.
Aber schon standen Taulantius, der Illyrier, und Autharis, der Langobarde, vor ihm. Mit schwerer Keule aus der Wurzel der Steineiche schmetterte der Illyrier auf des Königs Schild und schlug ein Stück des untern Stahlrandes heraus, gleichzeitig traf, dicht über diesem Sprung, des Langobarden Lanzenwurf den Schild und riß den Beschlag um den Schildnabel hinweg, schwer in dem Schilde haftend mit langem Widerhaken und ihn nach unten zerrend. Und Taulantius hob schon die Keule gegen des Königs Visier.
Da entschloß sich Teja kurz: den halbzertrümmerten Schild opfernd, schmetterte er diesen mit dem Stachel in des Illyriers Antlitz, den Schild fahren lassend, und fast gleichzeitig stieß er dem anstürmenden Autharis des Schlachtbeils Spitze durch den Ringpanzer in die Brust.
Aber nun stand der König ohne Schild: und die feindlichen Fernkämpfer verdoppelten ihre Speere und Pfeile. Mit Beil und Schwert nur wehrte Teja den von allen Seiten dicht heransausenden Geschossen. Und ein Hornruf von dem Paß her mahnte ihn, umzuschauen.
Da sah er den größten Teil der von ihm aus der Schlucht geführten Krieger gefallen. Die Ferngeschosse, die zahllosen, hatten sie niedergestreckt; und schon hatte sie, von der Linken einschwenkend, eine starke Schar Langobarden, Perser und Armenier von der Flanke erfaßt und im Nahkampf erreicht. Vom rechts aber sah der König eine Kolonne von Thrakiern, Makedonen und Franken mit gefällten Speeren auf die Wächter am Engpaß andringen, während eine dritte Abteilung, Gepiden, Alamannen, Isaurier und Illyrier ihn selbst und das schwache, noch hinter ihm haltende Häuflein von dem Rückweg nach dem Engpaß abzutrennen versuchte.
Scharf blickte Teja nach dem Engpaß, da verschwand für einen Augenblick das Banner Theoderichs: es schien gefallen. Dies entschied des Königs Entschluß. «Zurück, zum Paß! Rettet Theoderichs Panier!» so rief er den hinter ihm Kämpfenden zu und stürmte zurück, indem er die ihn umgarnende Schar durchbrechen wollte.
Aber dieser war es grimmiger Ernst, denn Johannes führte die Isaurier. «Auf den König!» schrie er. «Laßt ihn nicht durch! Laßt ihn nicht zurück! Speere! Werft!»
Nun war Aligern heran: «Nimm rasch meinen Schild.» Teja ergriff den dargebotenen Büffelschild—: in diesem Augenblick flog des Johannes Wurflanze und hätte des Königs Visier durchbohrt, hob dieser nicht gerade noch den neugewonnenen Schild. «Zurück zum Paß!» rief Teja nochmal und rannte mit solcher Gewalt gegen den anstürmenden Johannes, daß dieser rücklings niederstürzte, die zwei nächsten Isaurier erschlug der König. Und nun eilten Teja, Aligern, Guntharis, Hildebrand, Grippa, Wisand und Ragnaris schleunigst gegen den Paß.
Aber hier tobte bereits der Kampf. Alboin und Gisulf hatten hier gestürmt, und ein schwerer, spitzer Lavablock, von Alboin mit zwei Händen geschleudert, hatte Adalgoth auf den Schenkel getroffen und für einen Augenblick ins Knie gestürzt. Doch schon hatte Wachis das sinkende Banner Theoderichs ergriffen und Adalgoth selbst, sich aufraffend, den eindringenden Langobardenfürsten mit dem Schildstachel aus dem Engpaß gestoßen. Des Königs und seiner umgebenden Helden plötzliche Rückkehr machte den Bedrängten Luft: haufenweise fielen die Langobarden vor den unerwartet im Rücken Angreifenden. Mit Geschrei brachen zugleich die Wächter des Passes hervor, und rasch sprangen und liefen die Langobarden, ihre Führer mit fortreißend, über die Lavaklippen hinab. Aber nicht weit kamen sie. Da nahm sie der Isaurier und Illyrier, der Gepiden und Alamannen starker Schlachthaufe, geführt von Johannes, auf. Dieser hatte, zähneknirschend, sich erhoben, den Helm zurechtgeschoben und war sofort, Kehrt befehlend, gegen den Paß gerückt, den Teja nun erreicht hatte.
«Vorwärts», befahl er, «hierher zu mir, Alboin, Gisulf, Vitalianus, Zenon, drauf! Laßt sehn, ob dieser König denn wirklich ganz unsterblich ist.»
Teja hatte nun wieder seine alte Vorkämpferstellung, an der Mündung des Passes, eingenommen und lehnte, sich verkühlend, auf seinem Beilschaft.
«Nun, Barbarenkönig, geht's zum Ende. Bist du wieder in dein Schneckenhaus gekrochen? Komm heraus, oder ich schlag' dir ein Loch ins Haus! Komm heraus, wenn du ein Mann bist!» So rief Johannes und wog den Wurfspeer. «Gebt mir drei Speere!» sprach Teja und reichte Schild und Axt dem verwundet neben ihm stehenden Adalgoth. «So! Nun, sowie er gefallen, folgt mir.» Und ohne Schild trat er einen Schritt ins Freie, in jeder Hand Speere.
«Willkommen im Freien! Und im Tode!» rief Johannes und warf. Meisterhaft war sein Wurf gezielt, scharf auf des Königs Helmvisier. Aber Teja bog den Kopf zur Rechten, und an der Felswand splitterte die kräftig geschleuderte Eschenlanze.
Sowie Teja mit der Rechten nun seinen ersten Speer entsandte, warf sich Johannes auf das Antlitz: der Speer traf und tötete Zenon hinter ihm. Rasch war Johannes wieder auf den Füßen und schoß, wie der Blitz, auf den König los, den zweiten Speer, den des Königs Rechte entsandte, fing er mit dem Schild. Aber Teja hatte diesmal augenblicklich, nach dem Wurf aus der Rechten, auch aus der gleich geübten Linken eine Lanze geschleudert, und diese, von dem Anrennenden nicht bemerkt, durchbohrte den Schuppenpanzer und die Brust des tapfern Mannes, im Rücken hervordringend. Er fiel.
Da faßte seine Isaurier und Illyrier Entsetzen : denn er galt nach Belisar für den ersten Helden von Byzanz. Sie schrien laut auf, wandten den Rücken und flohen, in wilden Sätzen, ordnungslos, den Berg herabspringend, verfolgt von Teja und seinen Treuen.
Einen Augenblick hielten noch die wieder gesammelten Langobarden. «Komm, Gisulf—beiß die Zähne zusammen—bestehen wir diesen König des Todes», rief Alboin.—Aber da stand schon Teja zwischen ihnen—hoch blitzte sein schreckliches Beil: durch den Ringpanzer tief in die rechte Schulter gehaun stürzte Alboin und gleich darauf Gisulf mit zerschmettertem Helm. Da war kein Halten mehr: Langobarden, Gepiden, Alamannen, Heruler, Isaurier, Illyrier jagten in blinder Flucht entschart den Berg hinab.
Jauchzend verfolgten Tejas Genossen. Teja selbst hielt an dem Paß: er ließ sich nur von Wachis Speere reichen und, hoch über die gotischen Verfolger hinweg, im Bogenflug zielend, traf er Wurf auf Wurf und tötete, was er erreichte. Es waren des Kaisers beste Truppen: sie rissen die nachrückenden Makedonen, Thrakier, Perser, Armenier und Franken mit fort: bis an des Narses Seite fluteten die Versprengten, besorgt hob sich dieser aus seiner Sänfte.
«Johannes gefallen!»—«Alboin schwer wund», riefen sie, an ihm vorübereilend. «Flieht! Zurück ins Lager!»—«Eine Angriffsturmsäule muß neu—» sprach Narses, «ha sieh: da kommt Cethegus, zur rechten Zeit!»
Und er war's.
Vollendet hatte er den langen Umritt bei allen Scharen, denen Narses Römer und Italier zugeteilt, gegliedert hatte er sie in fünf Haufen von je dreihundert Mann: nun schritt er an ihrer Spitze, der zum Angriff Geordneten, ruhig voran. Anicius folgte von ferne: Syphax ging, zwei Speere tragend, hart hinter seinem Herrn.
Die flüchtenden Geschlagenen in ihren Zwischenräumen hindurchfluten lassend rückten die Italier vor: die meisten alten Legionäre aus Rom und Ravenna, Cethegus treu ergeben. Die gotischen Verfolger stutzten, als sie auf diese frische, übermächtige und wohlgeordnete Sturmschar stießen, und wichen langsam gegen den Engpaß zurück.
Aber Cethegus folgte.
Über die blutige, leichenbedeckte Stelle, wo Teja zuerst den Bund der Zwölf vernichtet, über den weiter oben gelegenen Kampfplatz, wo Johannes gefallen war, ging er in gleichmäßigem, ruhigem Schritt hinweg, Schild und Speer in der Linken, das Schwert in der Rechten: hinter ihm, die Lanzen gefällt, die Legionäre.
Schweigend, ohne Feldruf, ohne Tubatöne rückten sie den Berg empor.
Die gotischen Helden wollten nicht hinter ihren König in den Paß weichen. Sie hielten vor der Mündung. Guntharis war der erste, den Cethegus erreichte.
Des Herzogs Wurfspieß splitterte an seinem Schild, und gleich darauf stieß ihm Cethegus den Speer in die Weichen: in der Wunde brach der tödliche Schaft. Graf Grippa von Ravenna wollte den Wölsungen rächen: er schwang, weit ausholend, das lange Schwert über dem Haupt, aber Cethegus unterlief den Hieb und stieß dem alten Gefolgsmann Theoderichs das breite Römerschwert in die rechte Schulterhöhe—: er fiel und starb. Zornig schritt Wisand, der Bandalarius, gegen Cethegus heran: die Klingen kreuzten sich, Funken stoben aus den Schwertern und den Helmen: da parierte geschickt Cethegus einen allzu ungefügen Hieb, und ehe der Gote sich wieder gedeckt, stieß er ihm das Schwert in den Schenkel, daß das Blut hoch aufspritzte. Wisand wankte—: zwei Vettern trugen den Verwundeten davon. Sein Bruder, Ragnaris von Tarent, lief Cethegus von der Seite an, aber den sehr wohlgezielten Speerstoß riß Syphax, hinzuspringend, in die Höhe, und ehe Ragnaris den Speerschaft losgelassen und das Handbeil aus dem Gürtel gerissen, stieß ihm Cethegus das Schwert zwischen den Augen in die Stirn.
Erschrocken wichen die Goten vor dem Engpaß dem schrecklichen Römer aus und drängten sich, neben ihrem König vorbei, in die deckende Schlucht. Nur Aligern, Tejas Vetter, wollte nicht weichen: er warf den Speer so stark auf des Cethegus Schild, daß er diesen durchbohrte; aber Cethegus ließ den Schild sinken und fing den Wild-Anrennenden mit dem Schwert ab: in die Brust gestoßen fiel Aligern in des alten Hildebrand Arme, der, seinen schweren Steinhammer fallen lassend, mit Mühe den Verwundeten an Teja vorbei in den Engpaß tragen wollte.
Zwar auch Aligern hatte gut getroffen: stark blutete des Cethegus Schildarm. Doch er achtete es nicht: nachdringend wollte er beide Goten, Hildebrand und Aligern, töten, da ersah Adalgoth den verhaßten Verderber seines Vaters. «Alarich! Alarich!» rief er mit heller Stimme: und vorspringend raffte er des alten Waffenmeisters schwere Steinaxt vom Boden auf: «Alarich», rief er nochmal.
Hoch horchte Cethegus auf bei diesem Namen.
Da sauste die Steinaxt, scharf gezielt, heran und schlug schmetternd auf seinen stolz geschweiften Helm: betäubt sank Cethegus um. Syphax sprang hinzu, faßte ihn mit beiden Armen und riß ihn rückwärts aus dem Gefecht.
Aber die Legionäre wichen nicht; sie konnten gar nicht weichen; hinter ihnen drängten, von Narses nachgeschickt, zweitausend Perser und Thraker empor.
«Wurfspeere herbei», befahl ihr Führer Aniabedes. «Keinen Nahekampf! Mit Wurfspeeren überschüttet den König, bis er fällt. So hat Narses geboten!» Und gern gehorchten die Truppen dem Gebot, das ihr Blut zu sparen verhieß. Ein so furchtbarer Hagel von Geschossen schlug alsbald wider die schmale Mündung der Schlucht, daß kein Gote mehr heraus und vor den König zu treten vermochte.
Und nun verteidigte Teja, den Engpaß mit seinem Leib und seinem Schilde deckend, geraume, sehr geraume Zeit, ganz allein, sein Gotenvolk.
Bewunderungsvoll hat uns Prokop, nach der Augenzeugen Bericht, diesen letzten Kampf des Teja beschrieben. «Nun hab' ich das Gefecht zu schildern, das höchst denkwürdige, und eines Mannes Heldentum, das hinter keinem derer, die man Heroen nennt, zurücksteht—: des Teja. Er stand, allen sichtbar, mit dem Schilde gedeckt, den Speer zückend, vor der Schlachtreihe der Seinen. Alle tapfersten Römer, deren Zahl groß war, stürmten nur gegen ihn an, denn mit seinem Fall, meinten sie, sei der Kampf zu Ende. Alle schleuderten und stießen auf ihn die Lanzen: er aber fing die Lanzen sämtlich auf mit seinem Schild, und er tötete in plötzlichem Ansprung einen nach dem andern, Unzählige. Und wenn der Schild so schwer von Geschossen starrte, daß er ihn nicht mehr halten konnte, winkte er dem Schildträger, der ihm einen neuen reichte. So stand er, nicht sich wendend und etwa auf den Rücken den Schild werfend und weichend: sondern fest, wie in die Erde gemauert, stand er: dem Feinde mit der Rechten Tod bereitend, mit der Linken von sich den Tod abwehrend und immer dem Waffenträger nach neuen Schilden und neuen Speeren rufend.»
Wachis und Adalgoth waren es, die—aus dem Königshort waren Schilde und Speere haufenweise herangeschleppt worden—ihm immer neue Waffen reichten.
Endlich sank den Römern, Persern und Thrakern der Mut, als sie alle ihre Anstrengungen an dem lebendigen Schild der Goten scheitern und jeden Vordersten, Kühnsten der Ihrigen, von dem Speer des Königs erreicht, fallen sahen. Sie wankten—die Italier riefen ängstlich nach Cethegus—sie flohen.
Da fuhr Cethegus aus seiner langen Betäubung auf.
«Syphax, einen frischen Speer! Halt», rief er, «steht, ihr Römer! Roma, Roma eterna!» Und hoch sich aufrichtend schritt er gegen Teja heran.
Die Römer erkannten seine Stimme. ‹Roma! Roma eterna!› antworteten sie. und standen.
Aber auch Teja hatte diese Stimme erkannt.
Von zwölf Lanzen starrte sein Schild—er konnte ihn nicht mehr halten; aber da er den Heranschreitenden erkannte, dachte er nicht mehr des Schildwechsels.
«Keinen Schild! Mein Schlachtbeil! Rasch!» rief er. Und Wachis reichte ihm die Lieblingswaffe.
Da ließ König Teja den Schild fallen und sprang, das Schlachtbeil schwingend, aus dem Engpaß auf Cethegus. «Stirb, Römer!» rief er.
Scharf bohrten die beiden großen Feinde noch einmal Aug' in Auge. Dann sausten Speer und Beil durch die Luft—denn keiner dachte der Abwehr.
Und beide fielen. Tejas Beil drang mit der Speerspitze durch Schild und Harnisch in des Cethegus linke Brust. ‹Roma! Roma eterna!› rief er noch einmal. Dann sank er tot zurück.—
Sein Speer hatte den König in die rechte Brust getroffen: nicht tot, aber sterbenswund, trugen ihn Wachis und Adalgoth in den Paß. Und sie hatten Eile damit.
Denn als sie—endlich!—den König der Goten fallen gesehen—acht Stunden hatte er ununterbrochen gekämpft, und es neigte zum Abend—: da rannten alle Italier, Perser, Thraker und, von unten aufsteigend, neue Schlachthaufen gegen den Engpaß, den nun Adalgoth mit dem Schilde deckte, Hildebrand und Wachis standen hinter ihm.
Des Cethegus Leiche hatte Syphax mit beiden Armen umschlungen und seitwärts aus dem Getümmel getragen.
Laut aufschluchzend hielt er das edle Haupt, im Tode von hehrer Majestät fast über Menschenmaß hinaus verklärt, auf den Knien. Vor ihm, gegen den Engpaß hin, tobte der Kampf.
Da bemerkte der Maure, daß Anicius, gefolgt von einer Byzantinerschar—auch Scävola und Albinus erkannte er darunter—sich ihm, gebieterisch deutend, näherte.
«Halt», rief er aufspringend, «was wollt ihr?»
«Das Haupt des Präfekten dem Kaiser bringen», sprach Anicius. «Gehorche, Sklave!»
Aber Syphax stieß einen gellenden Schrei aus; sein Wurfspeer flog, und. Anicius fiel. Und pfeilschnell, ehe die andern, mit dem Sterbenden beschäftigt, näher gekommen waren, hatte Syphax die teure Last auf den Rücken gehoben und rannte damit, rasch wie der Wind, ungangbare Pfade, die fast senkrechten Lavaklippen hinauf, neben dem Engpaß, eine Wand empor, die Goten und Byzantiner bisher als unersteiglich betrachtet. Syphax klomm rasch und rascher hinauf. Sein Richtpunkt war die kleine Rauchsäule, die hart jenseits der Lavawand emporstieg. Denn dicht jenseits der Felsklippe gähnte einer der kleinen Kraterrisse des Vesuvs.
Einen Augenblick noch hielt Syphax inne auf dem Grat des schwarzen Felsens: auf beiden starken Armen hob er des Cethegus Leiche noch einmal waagrecht in die Höhe, der sinkenden Sonne die stolze Gestalt zeigend.
Und plötzlich waren Herr und Sklave verschwunden.
Der Feuerberg hatte mit Syphax, dem treuen, den toten Cethegus, seine Größe und seine Schuld in dem brennenden Schoße begraben. Er war entrückt dem kleinen Haß seiner Feinde.
Scävola und Albinus, die den Vorgang mit angesehen hatten, eilten zu Narses und forderten von ihm, man solle an dem Krater nach der Leiche forschen.
Narses aber sprach: «Gönnt dem Gewalt'gen sein gewaltig Grab. Er hat's verdient. Mit Lebenden und nicht mit Toten kämpf ich.»
Aber im gleichen Augenblick fast verstummte auch der laute klirrende Kampf um den Engpaß, an welchem Adalgoth, nicht unwürdig seines königlichen Harfen- und Speermeisters Teja, dem Ansturm der Feinde heldenmütig und todeskühn wehrte.
Denn während, hinter Adalgoth stehend, Hildebrand und Wachis plötzlich riefen: «Seht auf das Meer! Das Meer! Die Drachenschiffe! Die Nordlandhelden! Harald! Harald!» mahnten von unten, von der Sänfte des Narses her, feierliche Tubatöne zur Einstellung des Kampfes, zur Waffenruhe—sehr freudig senkten die kampfesmüden Byzantiner die Schwerter.
König Teja aber, der auf seinem Schilde lag—den Speer des Cethegus herauszuziehen hatte Hildebrand verboten «denn mit seinem Blute fließt sein Leben hin»—, forschte mit leiser Stimme: «Was hör' ich da rufen? Die Nordlandhelden? Ihre Schiffe? Harald ist da?»
«Ja: Harald und Errettung für den Rest des Volkes, für uns und—für die Frauen, die Kinder» jubelte Adalgoth, an seiner Seite kniend. «So war es nicht umsonst, du ewig teurer Held, dein unvergleichlich Heldentum, dein stundenlanges Ausharren über Menschenkraft!—Basiliskos kam soeben als Gesandter des Narses: Harald hat die ‹jonische Flotte› des Kaisers vernichtet im Hafen von Brundisium. Er droht mit Landung, mit neuem Angriff den müden Byzantinern; er fordert, was von uns noch lebt, davonzuführen, mit Wehr und Waffen und Gerät, in die Freiheit, nach Thuleland. Narses hat eingewilligt: er ehre, sagte er, König Tejas hohes Heldentum an seines Volkes Resten. Dürfen wir? O dürfen wir, mein König?»
«Ja», sprach Teja mit brechenden Augen. «Ihr dürft und sollt. Frei, gerettet unseres Volkes Reste! Die Frauen, die Kinder—Heil mir!—nicht in den Vesuv! Ja, führt nach Thuleland alle noch Lebenden; und nehmt auch mit die beiden Toten: den König Theoderich—»
«Und König Teja!» sprach Adalgoth und küßte des Toten Mund.
Und so war's geschehen, und also geschah's.
Schon gleich, nachdem Narses sein Zelt verlassen, ward ihm ein Fischer zugeführt, der, auf kleinem, schnellem Fahrzeug soeben um die Landzunge von Sorrentum gesegelt, versicherte, eine ungeheure Kriegsflotte der Goten sei im vollen Ansegeln begriffen. Narses lachte dazu: er wußte, daß auf allen Meeren kein Gotenkiel mehr schwamm. Näher befragt mußte der Fischer gestehn, die Flotte allerdings nicht selbst gesehen zu haben: Kaufleute hätten ihm davon erzählt und von einer großen Seeschlacht, in welcher die Goten bei Brundisium die «jonische Flotte» des Kaisers vernichtet. Das war nun unmöglich, wie Narses wohl wußte. Und nachdem der Fischer das Ansehen der angeblichen Gotenschiffe, nach Mitteilung seiner Gewährsmänner, geschildert, rief der Feldherr: «Nun, endlich kommen sie! Trieren und Galeeren: das sind ja unsere Schiffe, die also in Sicht sind, nicht gotische.»
An die Wikingerflotte, die seit vier Monden verschollen war und als nach Norden zurückgekehrt galt, dachte niemand.
Wenige Stunden darauf, während der Kampf um den Engpaß, alle Aufmerksamkeit fesselnd, tobte, ward Narses von den Küstenwächtern wirklich die Annäherung einer sehr großen kaiserlichen Flotte gemeldet: deutlich habe man das Schiff des Nauarchen, die Sophia, erkannt; doch sei die Zahl der Segel viel größer, als man erwartet, auch die von Narses entgegengeschickten Schiffe, die zur Eile hatten mahnen sollen, seien darunter; diese segelten in erster Linie, der frische Südostwind müsse sie bald auf die Höhe des Lagers führen. Und bald konnte Narses selbst von seiner Sänfte aus auf dem Hügel den prachtvollen Anblick der mit vollen Segeln und von eifriger Ruderkraft herangetriebenen Flotte genießen.
Beruhigt wandte er den Blick wieder den Kämpfenden auf dem Vesuv zu—als plötzlich aus dem Lager Boten ihn erreichten, die furchtbar jene Gerüchte bestätigten oder vielmehr noch Schlimmeres meldeten. Sie waren einer Gesandtschaft vorausgeeilt, die, gerade als Cethegus gegen Teja zum letzten Kampfe schritt, bei des Narses Sänfte anlangte: es waren, mit gebundenen Händen, die Nauarchen der «jonischen Flotte», die zugleich die Botschaft der vier sie begleitenden Nordmänner verdolmetschten.
Sie erzählten kurz, daß sie im Hafen von Brundisium, in stürmischer Nacht, von der für längst verschwunden erachteten Flotte der Wikinger überfallen und ihre Schiffe fast alle genommen seien; entkommen, um zu warnen, konnte nicht eines, da die Feinde den Hafen sperrten.
Nachdem Jarl Harald den drohenden Untergang des am Vesuv zusammengedrängten Restes der Goten erfahren, habe er geschworen, deren Fall zu wenden oder zu teilen: und nun seien sie, die genommenen Griechenschiffe vorausschickend und hinter diesen ihre Drachen weislich bergend, auf den Flügeln des Ostwinds herangebraust.
«Und so», schloß der Dolmetsch, «so spricht Harald der Wiking: Entweder ihr verstattet, daß alle noch lebenden Goten, mit Waffen und Habe, auf unseren Schiffen abziehen aus dem Südland, mit uns in die Heimat kehrend, wofür wir alle unsre Tausende von Gefangenen und alle genommenen Schiffe, die wir nicht zur Unterbringung der Goten brauchen, herausgeben. Oder wir töten sofort alle unsre Gefangenen, landen und fassen dein Lager und Heer im Rücken. Dann siehe zu, wie viele von euch, von den Goten und von uns, von Stirn und Rücken angegriffen, übrigbleiben werden: denn wir Nordmänner kämpfen dann bis zum letzten Mann: ich hab's geschworen bei Odin.»
Ohne Besinnen gewährte Narses den Abzug der Goten. «Ich habe nur geschworen, sie aus dem Reich, nicht aus der Welt zu schaffen. Wenig Ruhm brächte es, den armen Rest solch edeln Volkstums mit Übermacht zu Tod zu würgen; ich ehre dieses Teja Heldentum: in vierzig Jahren des Krieges hab' ich seinesgleichen nicht gesehen. Und durchaus nicht verlangt mich, zu erproben, wie mein tief erschüttert Heer, das einen Tag des furchtbarsten Kampfes hinter sich, fast alle seine Führer und die tapfersten Männer verloren hat, diesen Nordlandriesen, die frisch an Kraft und Mut daherkommen, widerstehn würde.»
Und so hatte denn Narses sofort Herolde auf die Schiffe Haralds und nach dem Engpaß geschickt: der Kampf ward eingestellt, der Abzug der Goten begann.
In langer, vom Berge bis an das Meer reichender Doppelreihe bildete das Heer des Narses ein Spalier; die Wikinger hatten vierhundert Helme gelandet, die an der Küste die schnell Heranschreitenden in Empfang nahmen.
Noch bevor jedoch der Zug begann, winkte Narses Basiliskos heran und sprach: «Der Gotenkrieg ist aus—der Edelhirsch erlegt—, jetzt fort mit den Wölfen, die ihn uns gehetzt: die Führer der Langobarden, wie steht's mit ihren Wunden?»
«Bevor ich antworte», sprach Basiliskos ehrerbietig, «nimm hier den Lorbeerkranz, den dir dein Heer gewunden hat: es ist Lorbeer vom Vesuvius, vom Paß da oben; Blut liegt auf den Blättern.»
Narses schob den Kranz zuerst abweisend mit der Hand zurück, dann sprach er: «Gib, 's ist gut.» Aber er legte ihn neben sich in die Sänfte.
«Autharis, Warnfrid, Grimoald, Aripert, Agilulf und Rotharis sind tot: sie haben über siebentausend Mann verloren; Alboin und Gisulf liegen reglos, tief wund in ihren Zelten.»
«Gut! Sehr gut! Sowie die Goten eingeschifft, läßt du die Langobarden sofort abführen, sie sind entlassen aus meinem Dienst, und Alboin sagst du zum Abschied von mir nur das eine: ‹Nach des Narses Tod, vielleicht, aber ganz gewiß nicht früher.› Ich aber bleibe hier in der Sänfte, stützt mich mit den Kissen—ich kann nicht mehr stehen—, dies wunderbare Schauspiel muß ich sehen.»
Und wahrlich, ein wunderbares, ein erschütternd großartiges Schauspiel war es: die letzten Goten, die dem Vesuv und Italien den Rücken wandten und die geschnäbelten Schiffe bestiegen, die sie nach dem sichern Norden bergend davontrugen.
Feierlich und ernst schollen die Rufe der gotischen Heerhörner aus der unbezwungenen, vom Feinde nicht betretenen Teja-Schlucht, in langen Pausen. Dazwischen erklang eintönig, ernst, ergreifend, aber nicht weichlich, der Gesang der Männer, Frauen und Kinder: die alten Totenlieder des Gotenvolks.
Hildebrand und Adalgoth—die letzten Führer, die silberweiße Vergangenheit und die goldne Zukunft hatten den Abzug geordnet.
Voran schritt, in vollen Waffen, aufrecht, in trotzig ernster Haltung, eine halbe Tausendschaft, geführt von Wisand, dem Bandalarius, der, trotz seiner Wunde, kräftig aufgerichtet, auf den Speer gestützt, den Zug eröffnete.
Darauf folgte, auf seinem letzten Schilde hingestreckt, den Speer des Cethegus in der Brust, ohne Helm, von den langen, schwarzen Locken das edle, bleiche Angesicht umrahmt, König Teja, bedeckt mit rotem Purpurmantel, von Kriegern getragen.
Hinter ihm schritten Adalgoth und Gotho.
Adalgoth aber sang und sprach mit ernster Stimme zu den leisen Klängen der Harfe in seinem linken Arm:
«Gebt Raum, ihr Völker, unserm Schritt:
Wir sind die letzten Goten!
Wir tragen keine Krone mit—
Wir tragen einen Toten.
Mit Schild an Schild und Speer an Speer
Wir ziehn nach Nordlands Winden,
Bis wir im fernsten grauen Meer
Die Insel Thule finden.
Das soll der Treue Insel sein,
Dort gilt noch Eid und Ehre.
Dort senken wir den König ein
Im Sarg der Eichenspeere.
Wir kommen her—gebt Raum dem Schritt—
Aus Romas falschen Toren:
Wir tragen nur den König mit—
Die Krone ging verloren.»
Als die Bahre an Narses' Sänfte gelangt war, gebot dieser Halt und rief auf lateinisch mit lauter Stimme:
«Mein ward der Sieg—aber ihm der Lorbeer. Da, nimm ihn hin! Ob kommende Geschlechter Größeres schauen, steht dahin: heute aber, König Teja, grüß ich dich, den größten Helden aller Zeiten!» Und er legte den Lorbeerkranz, den ihm sein siegreich Heer gewunden, auf des Toten bleiche Stirn nieder.
Die Träger nahmen die Bahre wieder auf, und langsam und feierlich, unter den Tönen der Hörner, der Totengesänge und von Adalgoths silberklingender Harfe, schritten sie weiter an das Meer, das nun schon prachtvoll im Abendgolde glühte.
Dicht hinter Teja wurde ein hochragender Purpurthron getragen, auf diesem ruhte die hehre, schweigende Gestalt Dietrichs von Bern: den Kronhelm auf dem Haupt, den hohen Schild am linken Arm, den Speer an die rechte Schulter gelehnt; zu seiner Linken schritt der alte Hildebrand, das Auge unverwandt auf seines Königs Leiche gerichtet, die im Strahl der untergehenden Sonne in dem Purpurmantel magisch gleißend glühte, hoch hielt er das ragende Amalungenbanner mit dem steigenden Löwen im blauen Feld über des großen Toten Haupt, der Abendwind des ausonischen Meeres rauschte in den Falten der gewaltigen Fahne, in Geistersprachen schienen sie Abschied zu nehmen von den italischen Lüften.
Als die Leiche an Narses' offener Sänfte vorübergetragen wurde, sprach Narses: «Am Schauer erkenn' ich es, der mich durchdringt—das ist der weise König von Ravenna! Erst ward ein Stärkerer—hier wird ein Größerer an uns vorbeigetragen. Tun wir danach.» Und mit Anstrengung erhob er sich und beugte verehrend vor der Leiche das Haupt.
Hierauf folgten, auf Tragbahren oder gestützt oder auch auf den Armen getragen, die Verwundeten; deren Zug eröffnete Aligern, den Wachis und Liuta mit zwei Kriegern auf breitem Schilde trugen.
Daran schlossen sich die Truhen und Laden, Kisten und Körbe, in welchen der Königshort Theoderichs und die bis dahin in der Wagenburg geborgene Fahrhabe der Einzelsippen, dem Vertrage gemäß, von dannen getragen wurde.
Hierauf wogte der große Haufe der Wehrunfähigen, der Frauen, Mädchen, Kinder und Greise; die Knaben aber vom zehnten Jahre ab hatten die ihnen anvertrauten Waffen nun und nimmer wieder abgeben wollen, und sie bildeten eine besondere Schar. Narses lächelte, als die kleinen, blonden Helden so trotzig und zornig zu ihm emporblickten. «Nun», sagte er, «es ist dafür gesorgt, daß des Kaisers Nachfolger und ihre Feldherren auch noch Arbeit finden.»
Den Schluß des ganzen Zuges bildete dann der Rest des gesamten Volksheeres, nach Hundertschaften gebildet.
Zahlreiche Boote vermittelten die Einschiffung der Menschen und ihrer Habe auf den hochbordigen Drachen der Nordmänner.
Tejas und Theoderichs Leiche, die Königsfahne und der Königshort wurden auf das Schiff Haralds und Haraldas gebracht, der große Dietrich von Bern ward auf seinem Purpurthron an den Hauptmast gelehnt und sein Löwenbanner aufgezogen als Hochflagge, zu seinen Füßen bettete sich der alte Hildebrand.
Vor dem Steuer aber ward von Adalgoth und Wisand König Tejas Leiche niedergelegt, trauervoll traten der gewaltige Harald und seine schöne Schwester heran.
Der Wiking legte die gepanzerte Hand auf des Toten Brust und sprach: «Nicht konnt' ich dich retten, todeskühner Schwarzkönig, dich und dein Volk. So laß dich mitfahren und den Rest der Deinen nach dem Land der Treu und Stärke, daraus ihr niemals hättet scheiden sollen. So bring ich denn dem König Frode doch das Gotenvolk zurück.»
Haralda aber sprach: «Ich aber will mit geheimen Künsten des edlen Toten Leib verwahren, daß er dauern soll, bis wir landen auf der Heimat Küste! Da wollen wir ihm und König Thidrekr das Hügelgrab wölben nahe der See, daß sie die Brandung rauschen hören mögen und Zwiesprach tauschen untereinander. Denn diese beiden sind einander wert.
Sieh hin, mein Bruder: am Strande steht geschart der Feinde Heer—ehrerbietig senken sie die Fahnen—und glühend sinkt die Sonne dort hinter Misenum und jenen Inseln—Purpur deckt das Meer wie ein weiter Königsmantel—Purpur färbt unsre weißen Segel, und Gold schimmert auf allen Waffen—sieh, wie der Südwind das Banner Thidrekrs hebt—nach Norden weist der Wind, der da der Götter Wille weiß—auf, Bruder Harald, laß die Anker lichten! Richte das Steuer, wende des Drachen Bug! Auf, Freias kluger Vogel, flieg, mein Falke.» Und hoch warf sie den Falken in die Luft «weise den Weg nach Norden, gen Thuleland! Heim bringen wir die letzten Goten.»